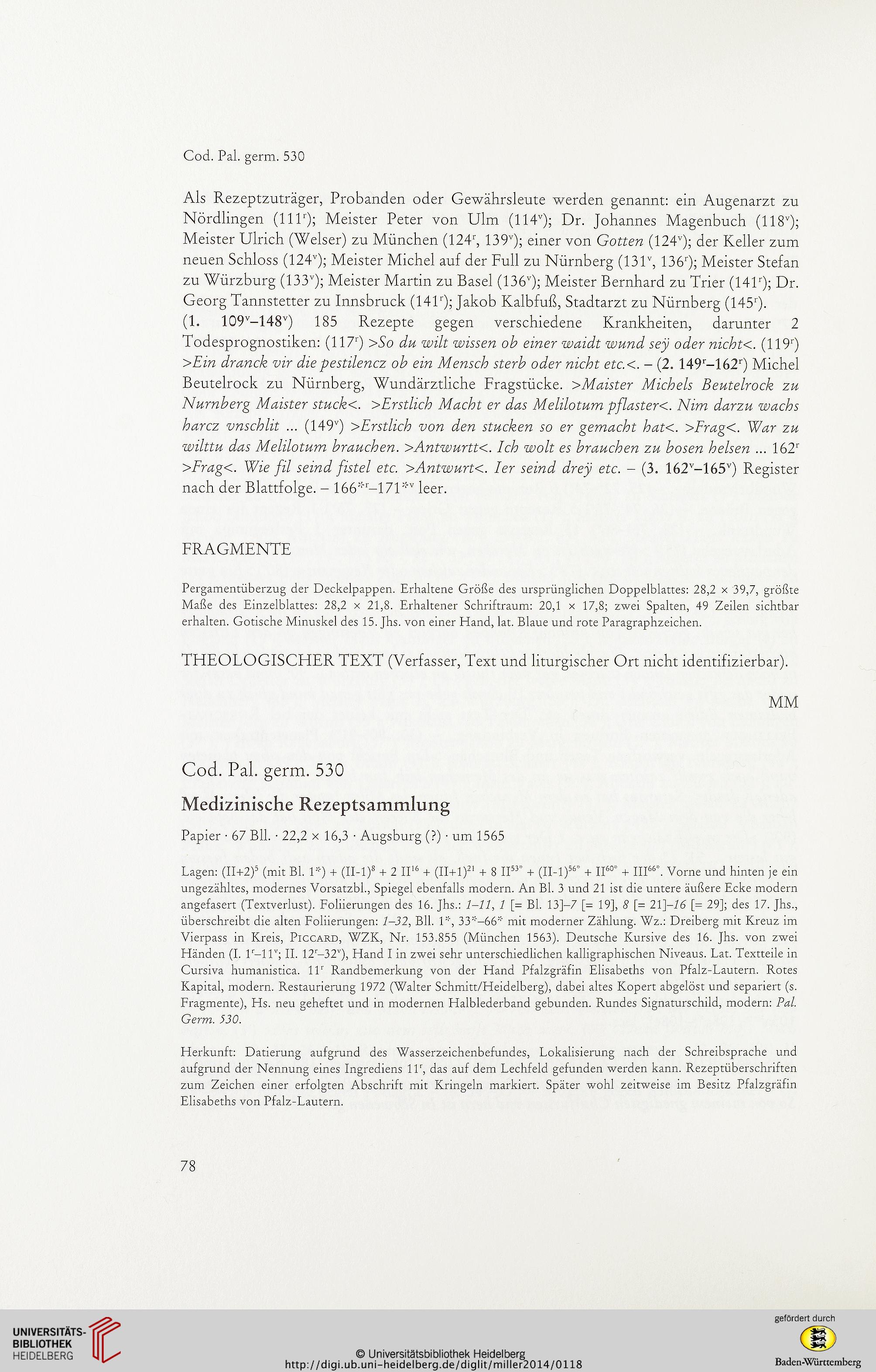Cod. Pal. germ. 530
Als Rezeptzuträger, Probanden oder Gewährsleute werden genannt: ein Augenarzt zu
Nördlingen (lll r); Meister Peter von Ulm (114 v); Dr. Johannes Magenbuch (118 v);
Meister Ulrich (Welser) zu München (124 r, 139 v); einer von Gotten (124 v); der Keller zum
neuen Schloss (124 v); Meister Michel auf der Full zu Nürnberg (131 v, 136 r); Meister Stefan
zu Wiirzburg (133 v); Meister Martin zu Basel (136 v); Meister Bernhard zu Trier (141 r); Dr.
Georg Tannstetter zu Innsbruck (141 r); Jakob Kalbfuß, Stadtarzt zu Nürnberg (145 r).
(1. 109 v-148 v) 185 Rezepte gegen verschiedene Krankheiten, darunter 2
Todesprognostiken: (117 r) >So du wilt wissen ob einer waidt wund sey oder nicht<. (119 r)
>Ein dranck vir diepestilencz ob ein Mensch sterb oder nicht etc.<. - (2. 149 r—162 r) Michel
Beutelrock zu Niirnberg, Wundärztliche Fragstücke. >Maister Michels Beutelrock zu
Nurnberg Maister stuck<. >Erstlich Macht er das Melilotum pflaster<. Nim darzu wachs
harcz vnschlit ... (149 v) >Erstlich von den stucken so er gemacht hat<. >Frag<. War zu
wilttu das Melilotum brauchen. >Antwurtt<. Ich wolt es brauchen zu bosen helsen ... 162 r
>Frag<. Wie fil seind fistel etc. >Antwurt<. Ier seind drey etc. - (3. 162 v-165 v) Register
nach der Blattfolge. - 166 ::' r-171 ;:' v leer.
FRAGMENTE
Pergamentüberzug der Deckelpappen. Erhaltene Größe des ursprünglichen Doppelblattes: 28,2 x 39,7, größte
Maße des Einzelblattes: 28,2 x 21,8. Erhaltener Schriftraum: 20,1 x 17,8; zwei Spalten, 49 Zeilen sichtbar
erhalten. Gotische Minuskel des 15. Jhs. von einer Hand, lat. Blaue und rote Paragraphzeichen.
THEOLOGISCHER TEXT (Verfasser, Text und liturgischer Ort nicht identifizierbar).
MM
Cod. Pal. germ. 530
Medizinische Rezeptsammlung
Papier • 67 Bll. • 22,2 x 16,3 ■ Augsburg (?) • um 1565
Lagen: (II+2) 5 (mit Bl. 1*) + (II-l) 8 + 2 II 16 + (II+l) 21 + 8 II 53" + (II-l) 56 + II 60" + III 66”. Vorne und hinten je ein
ungezähltes, modernes Vorsatzbl., Spiegel ebenfalls modern. An Bl. 3 und 21 ist die untere äußere Ecke modern
angefasert (Textverlust). Foliierungen des 16. Jhs.: 1-11, 1 [= Bl. 13]—7 [= 19], 8 [= 21]—16 [= 29]; des 17. Jhs.,
überschreibt die alten Foliierungen: 1-32, Bll. V', 33 ;:'-66”‘ mit moderner Zählung. Wz.: Dreiberg mit Kreuz im
Vierpass in Kreis, Piccard, WZK, Nr. 153.855 (München 1563). Deutsche Kursive des 16. Jhs. von zwei
Händen (I. 1 r—11 v; II. 12 r-32 v), Hand I in zwei sehr unterschiedlichen kalligraphischen Niveaus. Lat. Textteile in
Cursiva humanistica. ll r Randbemerkung von der Hand Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern. Rotes
Kapital, modern. Restaurierung 1972 (Walter Schmitt/Heidelberg), dabei altes Kopert abgelöst und separiert (s.
Fragmente), Hs. neu geheftet und in modernen Halblederband gebunden. Rundes Signaturschild, modern: Pal.
Germ. 530.
Herkunft: Datierung aufgrund des Wasserzeichenbefundes, Lokalisierung nach der Schreibsprache und
aufgrund der Nennung eines Ingrediens ll r, das auf dem Lechfeld gefunden werden kann. Rezeptüberschriften
zum Zeichen einer erfolgten Abschrift mit Kringeln markiert. Später wohl zeitweise im Besitz Pfalzgräfin
Elisabeths von Pfalz-Lautern.
78
Als Rezeptzuträger, Probanden oder Gewährsleute werden genannt: ein Augenarzt zu
Nördlingen (lll r); Meister Peter von Ulm (114 v); Dr. Johannes Magenbuch (118 v);
Meister Ulrich (Welser) zu München (124 r, 139 v); einer von Gotten (124 v); der Keller zum
neuen Schloss (124 v); Meister Michel auf der Full zu Nürnberg (131 v, 136 r); Meister Stefan
zu Wiirzburg (133 v); Meister Martin zu Basel (136 v); Meister Bernhard zu Trier (141 r); Dr.
Georg Tannstetter zu Innsbruck (141 r); Jakob Kalbfuß, Stadtarzt zu Nürnberg (145 r).
(1. 109 v-148 v) 185 Rezepte gegen verschiedene Krankheiten, darunter 2
Todesprognostiken: (117 r) >So du wilt wissen ob einer waidt wund sey oder nicht<. (119 r)
>Ein dranck vir diepestilencz ob ein Mensch sterb oder nicht etc.<. - (2. 149 r—162 r) Michel
Beutelrock zu Niirnberg, Wundärztliche Fragstücke. >Maister Michels Beutelrock zu
Nurnberg Maister stuck<. >Erstlich Macht er das Melilotum pflaster<. Nim darzu wachs
harcz vnschlit ... (149 v) >Erstlich von den stucken so er gemacht hat<. >Frag<. War zu
wilttu das Melilotum brauchen. >Antwurtt<. Ich wolt es brauchen zu bosen helsen ... 162 r
>Frag<. Wie fil seind fistel etc. >Antwurt<. Ier seind drey etc. - (3. 162 v-165 v) Register
nach der Blattfolge. - 166 ::' r-171 ;:' v leer.
FRAGMENTE
Pergamentüberzug der Deckelpappen. Erhaltene Größe des ursprünglichen Doppelblattes: 28,2 x 39,7, größte
Maße des Einzelblattes: 28,2 x 21,8. Erhaltener Schriftraum: 20,1 x 17,8; zwei Spalten, 49 Zeilen sichtbar
erhalten. Gotische Minuskel des 15. Jhs. von einer Hand, lat. Blaue und rote Paragraphzeichen.
THEOLOGISCHER TEXT (Verfasser, Text und liturgischer Ort nicht identifizierbar).
MM
Cod. Pal. germ. 530
Medizinische Rezeptsammlung
Papier • 67 Bll. • 22,2 x 16,3 ■ Augsburg (?) • um 1565
Lagen: (II+2) 5 (mit Bl. 1*) + (II-l) 8 + 2 II 16 + (II+l) 21 + 8 II 53" + (II-l) 56 + II 60" + III 66”. Vorne und hinten je ein
ungezähltes, modernes Vorsatzbl., Spiegel ebenfalls modern. An Bl. 3 und 21 ist die untere äußere Ecke modern
angefasert (Textverlust). Foliierungen des 16. Jhs.: 1-11, 1 [= Bl. 13]—7 [= 19], 8 [= 21]—16 [= 29]; des 17. Jhs.,
überschreibt die alten Foliierungen: 1-32, Bll. V', 33 ;:'-66”‘ mit moderner Zählung. Wz.: Dreiberg mit Kreuz im
Vierpass in Kreis, Piccard, WZK, Nr. 153.855 (München 1563). Deutsche Kursive des 16. Jhs. von zwei
Händen (I. 1 r—11 v; II. 12 r-32 v), Hand I in zwei sehr unterschiedlichen kalligraphischen Niveaus. Lat. Textteile in
Cursiva humanistica. ll r Randbemerkung von der Hand Pfalzgräfin Elisabeths von Pfalz-Lautern. Rotes
Kapital, modern. Restaurierung 1972 (Walter Schmitt/Heidelberg), dabei altes Kopert abgelöst und separiert (s.
Fragmente), Hs. neu geheftet und in modernen Halblederband gebunden. Rundes Signaturschild, modern: Pal.
Germ. 530.
Herkunft: Datierung aufgrund des Wasserzeichenbefundes, Lokalisierung nach der Schreibsprache und
aufgrund der Nennung eines Ingrediens ll r, das auf dem Lechfeld gefunden werden kann. Rezeptüberschriften
zum Zeichen einer erfolgten Abschrift mit Kringeln markiert. Später wohl zeitweise im Besitz Pfalzgräfin
Elisabeths von Pfalz-Lautern.
78