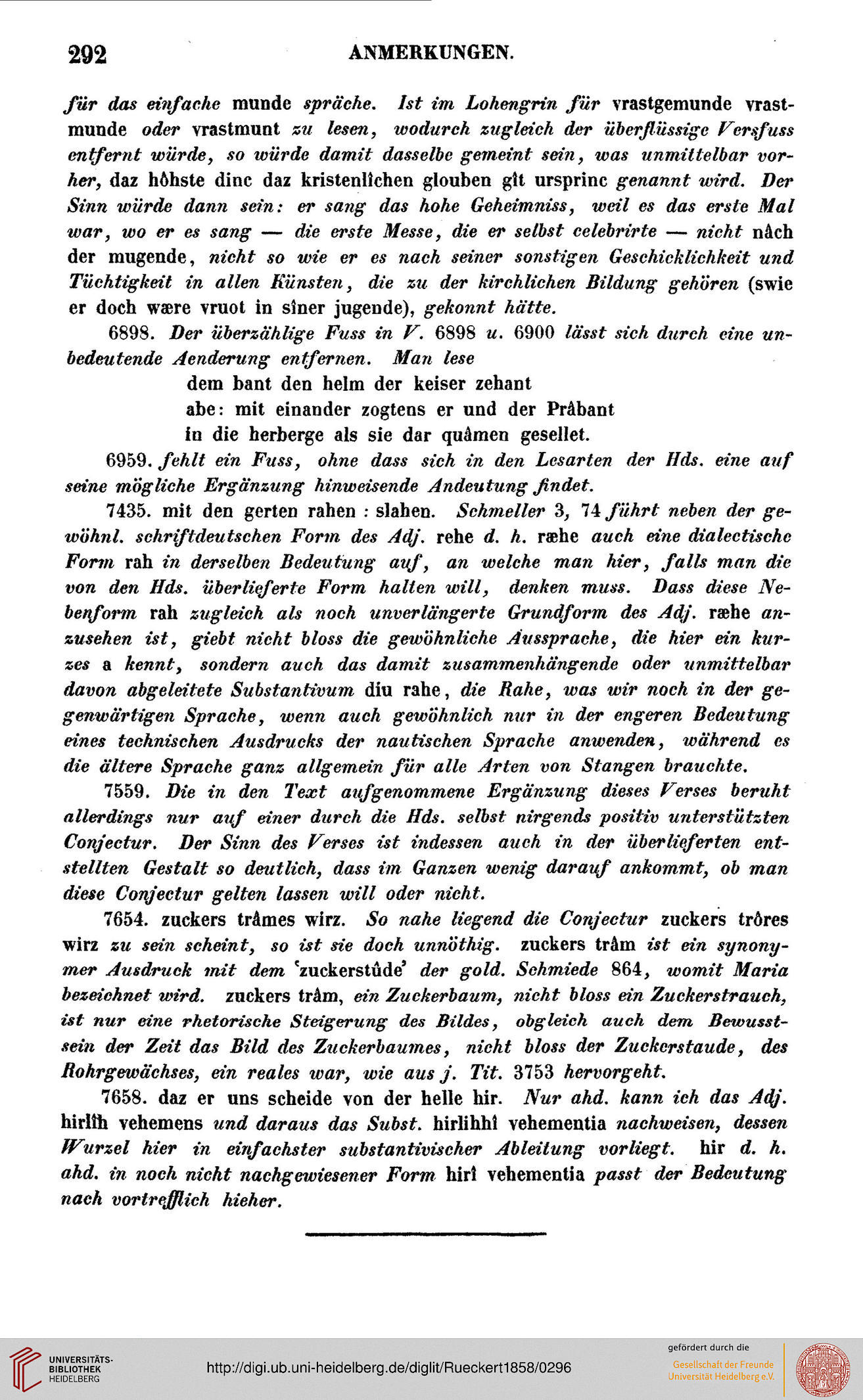292 ANMERKUNGEN.
für das einfache munde spräche. Ist im Lohengrin für vrastgemunde vrast-
raunde oder vrastmunt su lesen, wodurch zugleich der überflüssige Fersfuss
entfernt würde, so würde damit dasselbe gemeint sein, was unmittelbar vor-
her, daz hòhste dine daz kristenlîchen glouben gît ursprinc genannt wird. Der
Sinn würde dann sein: er sang das hohe Geheimniss, weil es das erste Mal
war, wo er es sang — die erste Messe, die er selbst celebrirte — nicht nach
der mugende, nicht so wie er es nach seiner sonstigen Geschicklichkeit und
Tüchtigkeit in allen Künsten, die zu der kirchlichen Bildung gehören (swie
er doch waere vruot in sîner jugende), gekonnt hätte.
6898. Der überzählige Fuss in F. 6898 u. 6900 lässt sich durch eine un-
bedeutende Aenderung entfernen. Man lese
dem bant den heim der keiser zehant
abe: mit einander zogtens er und der Prâbant
in die herberge als sie dar quâmen gesellet.
6959. fehlt ein Fuss, ohne dass sich in den Lesarten der Hds. eine auf
seine mögliche Ergänzung hinweisende Andeutung ßndet.
7435. mit den gerten rahen : slahen. Schindler 3, 74 führt neben der ge-
wöhnt, schriftdeutschen Form des Adj. rehe d. h. rame auch eine dialektische
Form rah in derselben Bedeutung auf, an welche man hier, falls man die
von den Hds. überlieferte Form halten will, denken muss. Dass diese Ne-
benform rah zugleich als noch unverlängerte Grundform des Adj. rame an-
zusehen ist, giebt nicht bloss die gewöhnliche Aussprache, die hier ein kur-
zes a kennt, sondern auch das damit zusammenhängende oder unmittelbar
davon abgeleitete Substantivum diu rahe, die Rahe, was wir noch in der ge-
genwärtigen Sprache, wenn auch gewöhnlich nur in der engeren Bedeutung
eines technischen Ausdrucks der nautischen Sprache anwenden, während es
die ältere Sprache ganz allgemein für alle Arten von Stangen brauchte.
7559. Die in den Text aufgenommene Ergänzung dieses Ferses beruht
allerdings nur auf einer durch die Hds. selbst nirgends positiv unterstützten
Conjectur. Der Sinn des Ferses ist indessen auch in der überlieferten ent-
stellten Gestalt so deutlich, dass im Ganzen wenig darauf ankommt, ob man
diese Conjectur gelten lassen will oder nicht.
7654. zuckers trames wirz. So nahe liegend die Conjectur zuckers trôres
wirz zu sein seheint, so ist sie doch unnöthig. zuckers tram ist ein synony-
mer Ausdruck mit dem 'zuckerstûde' der gold. Schmiede 864, womit Maria
bezeichnet wird, zackers tram, ein Zuckerbaum, nicht bloss ein Zuckerstrauch,
ist nur eine rhetorische Steigerung des Bildes, obgleich auch dem. Bewusst-
sein der Zeit das Bild des Zuckerbaumes, nicht bloss der Zuckerstaude, des
Rohrgewächses, ein reales war, wie aus j. Tit. 3753 hervorgeht.
7658. daz er uns scheide von der helle hir. Nur ahd. kann ich das Adj.
hirlîh vehemens und daraus das Subst. hirlihhl vehementia nachweisen, dessen
fFurzel hier in einfachster substantivischer Ableitung vorliegt, hir d. h.
ahd. in noch nicht nachgewiesener Form hirî vehementia passt der Bedeutung
nach vortrefflich hieher.
für das einfache munde spräche. Ist im Lohengrin für vrastgemunde vrast-
raunde oder vrastmunt su lesen, wodurch zugleich der überflüssige Fersfuss
entfernt würde, so würde damit dasselbe gemeint sein, was unmittelbar vor-
her, daz hòhste dine daz kristenlîchen glouben gît ursprinc genannt wird. Der
Sinn würde dann sein: er sang das hohe Geheimniss, weil es das erste Mal
war, wo er es sang — die erste Messe, die er selbst celebrirte — nicht nach
der mugende, nicht so wie er es nach seiner sonstigen Geschicklichkeit und
Tüchtigkeit in allen Künsten, die zu der kirchlichen Bildung gehören (swie
er doch waere vruot in sîner jugende), gekonnt hätte.
6898. Der überzählige Fuss in F. 6898 u. 6900 lässt sich durch eine un-
bedeutende Aenderung entfernen. Man lese
dem bant den heim der keiser zehant
abe: mit einander zogtens er und der Prâbant
in die herberge als sie dar quâmen gesellet.
6959. fehlt ein Fuss, ohne dass sich in den Lesarten der Hds. eine auf
seine mögliche Ergänzung hinweisende Andeutung ßndet.
7435. mit den gerten rahen : slahen. Schindler 3, 74 führt neben der ge-
wöhnt, schriftdeutschen Form des Adj. rehe d. h. rame auch eine dialektische
Form rah in derselben Bedeutung auf, an welche man hier, falls man die
von den Hds. überlieferte Form halten will, denken muss. Dass diese Ne-
benform rah zugleich als noch unverlängerte Grundform des Adj. rame an-
zusehen ist, giebt nicht bloss die gewöhnliche Aussprache, die hier ein kur-
zes a kennt, sondern auch das damit zusammenhängende oder unmittelbar
davon abgeleitete Substantivum diu rahe, die Rahe, was wir noch in der ge-
genwärtigen Sprache, wenn auch gewöhnlich nur in der engeren Bedeutung
eines technischen Ausdrucks der nautischen Sprache anwenden, während es
die ältere Sprache ganz allgemein für alle Arten von Stangen brauchte.
7559. Die in den Text aufgenommene Ergänzung dieses Ferses beruht
allerdings nur auf einer durch die Hds. selbst nirgends positiv unterstützten
Conjectur. Der Sinn des Ferses ist indessen auch in der überlieferten ent-
stellten Gestalt so deutlich, dass im Ganzen wenig darauf ankommt, ob man
diese Conjectur gelten lassen will oder nicht.
7654. zuckers trames wirz. So nahe liegend die Conjectur zuckers trôres
wirz zu sein seheint, so ist sie doch unnöthig. zuckers tram ist ein synony-
mer Ausdruck mit dem 'zuckerstûde' der gold. Schmiede 864, womit Maria
bezeichnet wird, zackers tram, ein Zuckerbaum, nicht bloss ein Zuckerstrauch,
ist nur eine rhetorische Steigerung des Bildes, obgleich auch dem. Bewusst-
sein der Zeit das Bild des Zuckerbaumes, nicht bloss der Zuckerstaude, des
Rohrgewächses, ein reales war, wie aus j. Tit. 3753 hervorgeht.
7658. daz er uns scheide von der helle hir. Nur ahd. kann ich das Adj.
hirlîh vehemens und daraus das Subst. hirlihhl vehementia nachweisen, dessen
fFurzel hier in einfachster substantivischer Ableitung vorliegt, hir d. h.
ahd. in noch nicht nachgewiesener Form hirî vehementia passt der Bedeutung
nach vortrefflich hieher.