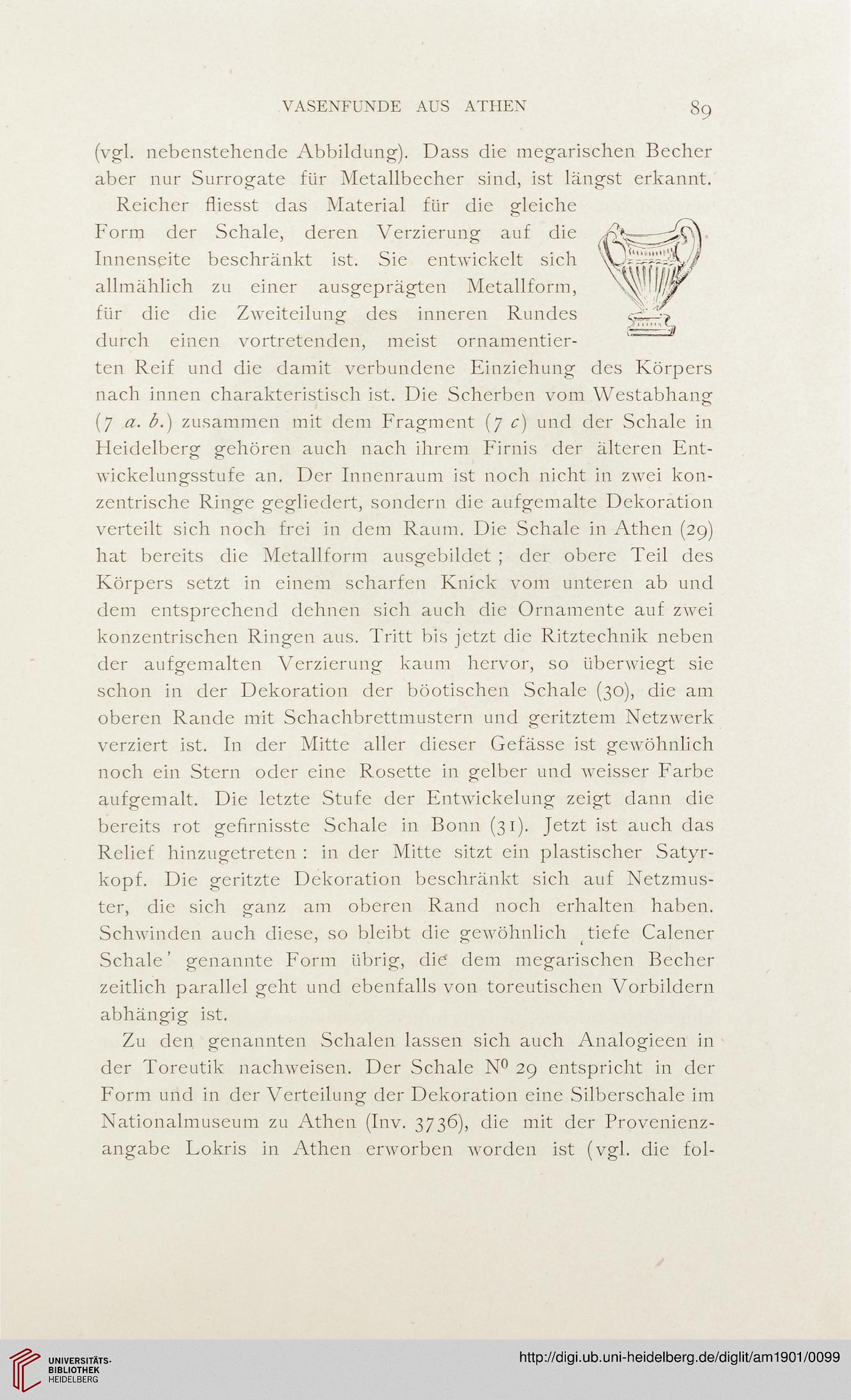VASENFUNDE AUS ATHEN
89
(vgl. nebenstehende Abbildung). Dass die megarischen Becher
aber nur Surrogate für Metallbecher sind, ist längst erkannt.
Reicher fliesst das Material für die gleiche
Form der Schale, deren Verzierung auf die Λ
Innenseite beschränkt ist. Sie entwickelt sich
allmählich zu einer ausgeprägten Metallform,
für die die Zweiteilung des inneren Rundes
durch einen vortretenden, meist ornamentier-
ten Reif und die damit verbundene Einziehung des Körpers
nach innen charakteristisch ist. Die Scherben vom Westabhang
(7 a. b.) zusammen mit dem Fragment (7 c) und der Schale in
Fleidelberg gehören auch nach ihrem Firnis der älteren Ent-
wickelungsstufe an. Der Innenraum ist noch nicht in zwei kon-
zentrische Ringe gegliedert, sondern die aufgemalte Dekoration
verteilt sich noch frei in dem Raum. Die Schale in Athen (29)
hat bereits die Metallform ausgebildet ; der obere Teil des
Körpers setzt in einem scharfen Knick vom unteren ab und
dem entsprechend dehnen sich auch die Ornamente auf zwei
konzentrischen Ringen aus. Tritt bis jetzt die Ritztechnik neben
der aufgemalten Verzierung kaum hervor, so überwiegt sie
schon in der Dekoration der böotischen Schale (30), die am
oberen Rande mit Schachbrettmustern und geritztem Netzwerk
verziert ist. In der Mitte aller dieser Gefässe ist gewöhnlich
noch ein Stern oder eine Rosette in gelber und weisser Farbe
aufgemalt. Die letzte Stufe der Entwickelung zeigt dann die
bereits rot gefirnisste Schale in Bonn (31). Jetzt ist auch das
Relief hinzugetreten : in der Mitte sitzt ein plastischer Satyr-
kopf. Die geritzte Dekoration beschränkt sich auf Netzmus-
ter, die sich ganz am oberen Rand noch erhalten haben.
Schwinden auch diese, so bleibt die gewöhnlich (ticfe^ Calener
Schale’ genannte Form übrig, die dem megarischen Becher
zeitlich parallel geht und ebenfalls von toreutischen Vorbildern
abhängig ist.
Zu den, genannten Schalen lassen sich auch Analogieen in
der Toreutik nachweisen. Der Schale N° 29 entspricht in der
Form und in der Verteilung der Dekoration eine Silberschale im
Nationalmuseum zu Athen (Inv. 3736), die mit der Provenienz-
angabe Lokris in Athen erworben worden ist (vgl. die fol-
89
(vgl. nebenstehende Abbildung). Dass die megarischen Becher
aber nur Surrogate für Metallbecher sind, ist längst erkannt.
Reicher fliesst das Material für die gleiche
Form der Schale, deren Verzierung auf die Λ
Innenseite beschränkt ist. Sie entwickelt sich
allmählich zu einer ausgeprägten Metallform,
für die die Zweiteilung des inneren Rundes
durch einen vortretenden, meist ornamentier-
ten Reif und die damit verbundene Einziehung des Körpers
nach innen charakteristisch ist. Die Scherben vom Westabhang
(7 a. b.) zusammen mit dem Fragment (7 c) und der Schale in
Fleidelberg gehören auch nach ihrem Firnis der älteren Ent-
wickelungsstufe an. Der Innenraum ist noch nicht in zwei kon-
zentrische Ringe gegliedert, sondern die aufgemalte Dekoration
verteilt sich noch frei in dem Raum. Die Schale in Athen (29)
hat bereits die Metallform ausgebildet ; der obere Teil des
Körpers setzt in einem scharfen Knick vom unteren ab und
dem entsprechend dehnen sich auch die Ornamente auf zwei
konzentrischen Ringen aus. Tritt bis jetzt die Ritztechnik neben
der aufgemalten Verzierung kaum hervor, so überwiegt sie
schon in der Dekoration der böotischen Schale (30), die am
oberen Rande mit Schachbrettmustern und geritztem Netzwerk
verziert ist. In der Mitte aller dieser Gefässe ist gewöhnlich
noch ein Stern oder eine Rosette in gelber und weisser Farbe
aufgemalt. Die letzte Stufe der Entwickelung zeigt dann die
bereits rot gefirnisste Schale in Bonn (31). Jetzt ist auch das
Relief hinzugetreten : in der Mitte sitzt ein plastischer Satyr-
kopf. Die geritzte Dekoration beschränkt sich auf Netzmus-
ter, die sich ganz am oberen Rand noch erhalten haben.
Schwinden auch diese, so bleibt die gewöhnlich (ticfe^ Calener
Schale’ genannte Form übrig, die dem megarischen Becher
zeitlich parallel geht und ebenfalls von toreutischen Vorbildern
abhängig ist.
Zu den, genannten Schalen lassen sich auch Analogieen in
der Toreutik nachweisen. Der Schale N° 29 entspricht in der
Form und in der Verteilung der Dekoration eine Silberschale im
Nationalmuseum zu Athen (Inv. 3736), die mit der Provenienz-
angabe Lokris in Athen erworben worden ist (vgl. die fol-