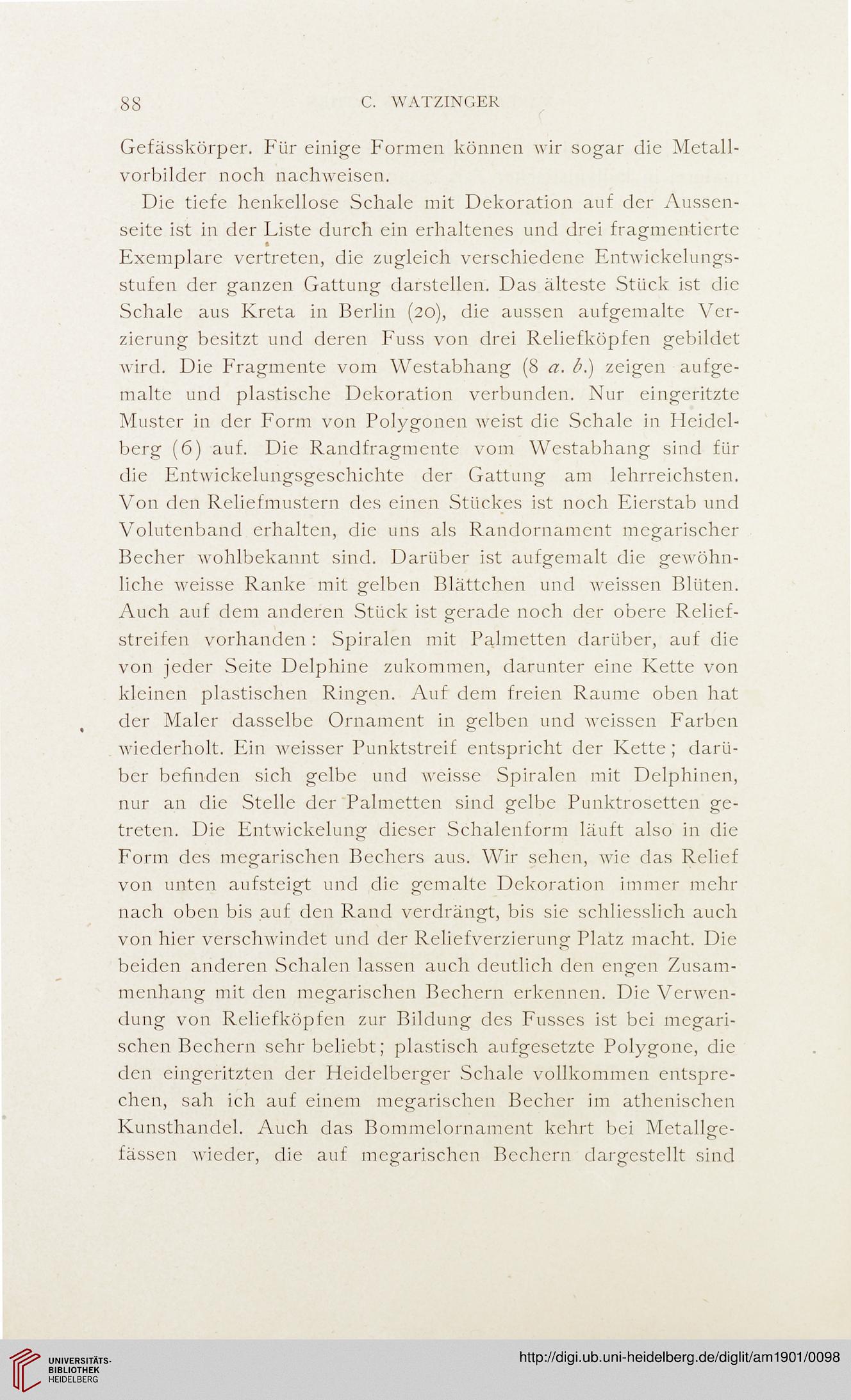88
C. WATZINGER
Gefässkörper. Für einige Formen können wir sogar die Metall-
vorbilder noch nachweisen.
Die tiefe henkellose Schale mit Dekoration auf der Aussen-
seite ist in der Liste durch ein erhaltenes und drei fragmentierte
Exemplare vertreten, die zugleich verschiedene Entwickelungs-
stufen der ganzen Gattung darstellen. Das älteste Stück ist die
Schale aus Kreta in Berlin (20), die aussen aufgemalte Ver-
zierung besitzt und deren Fuss von drei Reliefköpfen gebildet
wird. Die Fragmente vom Westabhang (8 a. b.) zeigen aufge-
malte und plastische Dekoration verbunden. Nur eingeritzte
Muster in der Form von Polygonen weist die Schale in Heidel-
berg (6) auf. Die Randfragmente vom Westabhang sind für
die Entwickelungsgeschichte der Gattung am lehrreichsten.
Von den Reliefmustern des einen Stückes ist noch Eierstab und
Volutenband erhalten, die uns als Randornament megarischer
Becher wohlbekannt sind. Darüber ist aufgemalt die gewöhn-
liche weisse Ranke mit gelben Blättchen und weissen Blüten.
Auch auf dem anderen Stück ist gerade noch der obere Relief-
streifen vorhanden: Spiralen mit Palmetten darüber, auf die
von jeder Seite Delphine zukommen, darunter eine Kette von
kleinen plastischen Ringen. Auf dem freien Raume oben hat
der Maler dasselbe Ornament in gelben und weissen Farben
wiederholt. Ein weisser Punktstreif entspricht der Kette ; darü-
ber befinden sich gelbe und weisse Spiralen mit Delphinen,
nur an die Stelle der Palmetten sind gelbe Punktrosetten ge-
treten. Die Entwickelung dieser Schalenform läuft also in die
Form des megarischen Bechers aus. Wir sehen, wie das Relief
von unten aufsteigt und die gemalte Dekoration immer mehr
nach oben bis auf den Rand verdrängt, bis sie schliesslich auch
von hier verschwindet und der Reliefverzierung Platz macht. Die
beiden anderen Schalen lassen auch deutlich den engen Zusam-
menhang mit den megarischen Bechern erkennen. Die Verwen-
dung von Reliefköpfen zur Bildung des Fusses ist bei megari-
schen Bechern sehr beliebt; plastisch aufgesetzte Polygone, die
den eingeritzten der Heidelberger Schale vollkommen entspre-
chen, sah ich auf einem megarischen Becher im athenischen
Kunsthandel. Auch das Bommelornament kehrt bei Metallge-
fässen wieder, die auf megarischen Bechern dargestellt sind
C. WATZINGER
Gefässkörper. Für einige Formen können wir sogar die Metall-
vorbilder noch nachweisen.
Die tiefe henkellose Schale mit Dekoration auf der Aussen-
seite ist in der Liste durch ein erhaltenes und drei fragmentierte
Exemplare vertreten, die zugleich verschiedene Entwickelungs-
stufen der ganzen Gattung darstellen. Das älteste Stück ist die
Schale aus Kreta in Berlin (20), die aussen aufgemalte Ver-
zierung besitzt und deren Fuss von drei Reliefköpfen gebildet
wird. Die Fragmente vom Westabhang (8 a. b.) zeigen aufge-
malte und plastische Dekoration verbunden. Nur eingeritzte
Muster in der Form von Polygonen weist die Schale in Heidel-
berg (6) auf. Die Randfragmente vom Westabhang sind für
die Entwickelungsgeschichte der Gattung am lehrreichsten.
Von den Reliefmustern des einen Stückes ist noch Eierstab und
Volutenband erhalten, die uns als Randornament megarischer
Becher wohlbekannt sind. Darüber ist aufgemalt die gewöhn-
liche weisse Ranke mit gelben Blättchen und weissen Blüten.
Auch auf dem anderen Stück ist gerade noch der obere Relief-
streifen vorhanden: Spiralen mit Palmetten darüber, auf die
von jeder Seite Delphine zukommen, darunter eine Kette von
kleinen plastischen Ringen. Auf dem freien Raume oben hat
der Maler dasselbe Ornament in gelben und weissen Farben
wiederholt. Ein weisser Punktstreif entspricht der Kette ; darü-
ber befinden sich gelbe und weisse Spiralen mit Delphinen,
nur an die Stelle der Palmetten sind gelbe Punktrosetten ge-
treten. Die Entwickelung dieser Schalenform läuft also in die
Form des megarischen Bechers aus. Wir sehen, wie das Relief
von unten aufsteigt und die gemalte Dekoration immer mehr
nach oben bis auf den Rand verdrängt, bis sie schliesslich auch
von hier verschwindet und der Reliefverzierung Platz macht. Die
beiden anderen Schalen lassen auch deutlich den engen Zusam-
menhang mit den megarischen Bechern erkennen. Die Verwen-
dung von Reliefköpfen zur Bildung des Fusses ist bei megari-
schen Bechern sehr beliebt; plastisch aufgesetzte Polygone, die
den eingeritzten der Heidelberger Schale vollkommen entspre-
chen, sah ich auf einem megarischen Becher im athenischen
Kunsthandel. Auch das Bommelornament kehrt bei Metallge-
fässen wieder, die auf megarischen Bechern dargestellt sind