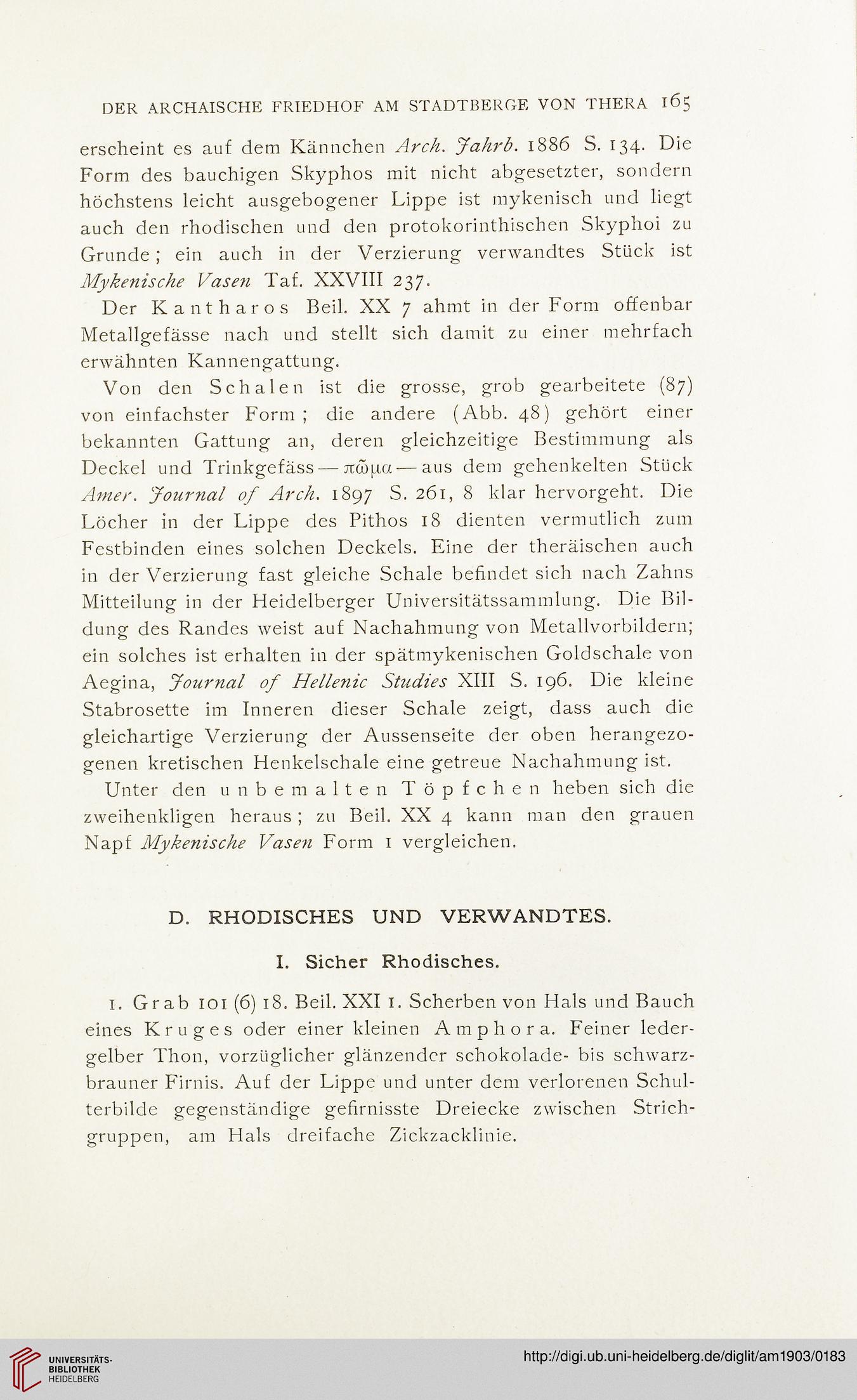DER ARCHAISCHE FRIEDHOF AM STADTBERGE VON THERA 165
erscheint es auf dem Kännchen Arch. Jahrb. 1886 S. 134. Die
Form des bauchigen Skyphos mit nicht abgesetzter, sondern
höchstens leicht ausgebogener Lippe ist mykenisch und liegt
auch den rhodischen und den protokorinthischen Skyphoi zu
Grunde; ein auch in der Verzierung verwandtes Stück ist
Mykenische Vasen Taf. XXVIII 237.
Der Kantharos Beil. XX 7 ahmt in der Form offenbar
Metallgefässe nach und stellt sich damit zu einer mehrfach
erwähnten Kannengattung.
Von den Schalen ist die grosse, grob gearbeitete (87)
von einfachster Form; die andere (Abb. 48) gehört einer
bekannten Gattung an, deren gleichzeitige Bestimmung als
Deckel und Trinkgefäss — πώμα — aus dem gehenkelten Stück
Amen. Journal of Arch. 1897 S. 261, 8 klar hervorgeht. Die
Löcher in der Lippe des Pithos 18 dienten vermutlich zum
Festbinden eines solchen Deckels. Eine der theräischen auch
in der Verzierung fast gleiche Schale befindet sich nach Zahns
Mitteilung in der Heidelberger Universitätssammlung. Die Bil-
dung des Randes weist auf Nachahmung von Metallvorbildern;
ein solches ist erhalten in der spätmykenischen Goldschale von
Aegina, Journal of Hellenic Studies XIII S. 196. Die kleine
Stabrosette im Inneren dieser Schale zeigt, dass auch die
gleichartige Verzierung der Aussenseite der oben herangezo-
genen kretischen Henkelschale eine getreue Nachahmung ist.
Unter den un bemalten Töpfchen heben sich die
zweihenkligen heraus ; zu Beil. XX 4 kann man den grauen
Napf Mykenische Vasen Form 1 vergleichen.
D. RHODISCHES UND VERWANDTES.
I. Sicher Rhodisches.
1. Grab 101 (6) 18. Beil. XXI I. Scherben von Hals und Bauch
eines Kruges oder einer kleinen Amphora. Feiner leder-
gelber Thon, vorzüglicher glänzender Schokolade- bis schwarz-
brauner Firnis. Auf der Lippe und unter dem verlorenen Schul-
terbilde gegenständige gefirnisste Dreiecke zwischen Strich-
gruppen, am Hals dreifache Zickzacklinie.
erscheint es auf dem Kännchen Arch. Jahrb. 1886 S. 134. Die
Form des bauchigen Skyphos mit nicht abgesetzter, sondern
höchstens leicht ausgebogener Lippe ist mykenisch und liegt
auch den rhodischen und den protokorinthischen Skyphoi zu
Grunde; ein auch in der Verzierung verwandtes Stück ist
Mykenische Vasen Taf. XXVIII 237.
Der Kantharos Beil. XX 7 ahmt in der Form offenbar
Metallgefässe nach und stellt sich damit zu einer mehrfach
erwähnten Kannengattung.
Von den Schalen ist die grosse, grob gearbeitete (87)
von einfachster Form; die andere (Abb. 48) gehört einer
bekannten Gattung an, deren gleichzeitige Bestimmung als
Deckel und Trinkgefäss — πώμα — aus dem gehenkelten Stück
Amen. Journal of Arch. 1897 S. 261, 8 klar hervorgeht. Die
Löcher in der Lippe des Pithos 18 dienten vermutlich zum
Festbinden eines solchen Deckels. Eine der theräischen auch
in der Verzierung fast gleiche Schale befindet sich nach Zahns
Mitteilung in der Heidelberger Universitätssammlung. Die Bil-
dung des Randes weist auf Nachahmung von Metallvorbildern;
ein solches ist erhalten in der spätmykenischen Goldschale von
Aegina, Journal of Hellenic Studies XIII S. 196. Die kleine
Stabrosette im Inneren dieser Schale zeigt, dass auch die
gleichartige Verzierung der Aussenseite der oben herangezo-
genen kretischen Henkelschale eine getreue Nachahmung ist.
Unter den un bemalten Töpfchen heben sich die
zweihenkligen heraus ; zu Beil. XX 4 kann man den grauen
Napf Mykenische Vasen Form 1 vergleichen.
D. RHODISCHES UND VERWANDTES.
I. Sicher Rhodisches.
1. Grab 101 (6) 18. Beil. XXI I. Scherben von Hals und Bauch
eines Kruges oder einer kleinen Amphora. Feiner leder-
gelber Thon, vorzüglicher glänzender Schokolade- bis schwarz-
brauner Firnis. Auf der Lippe und unter dem verlorenen Schul-
terbilde gegenständige gefirnisste Dreiecke zwischen Strich-
gruppen, am Hals dreifache Zickzacklinie.