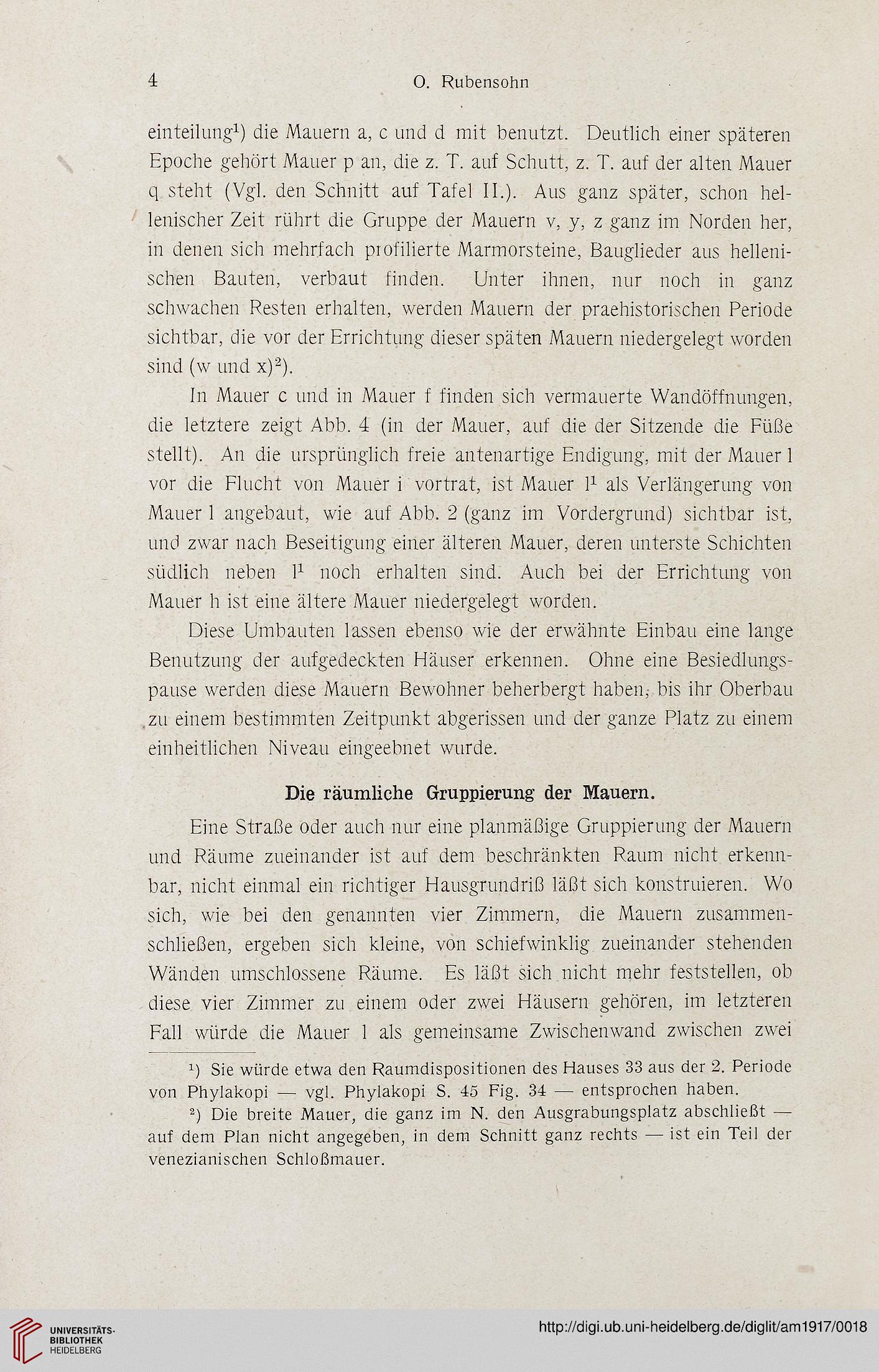4
0. Rubensohn
einteilungi) die Mauern a, c und d mit benutzt. Deutlich einer späteren
Epoche gehört Mauer p an, die z. T. auf Schutt, z. T. auf der alten Mauer
q steht (Vgl. den Schnitt auf Tafel 11.). Aus ganz später, schon hel-
lenischer Zeit rührt die Gruppe der Mauern v, y, z ganz im Norden her,
in denen sich mehrfach piofilierte Marmorsteine, Bauglieder aus helleni-
schen Bauten, verbaut finden. Unter ihnen, nur noch in ganz
schwachen Resten erhalten, werden Mauern der praehistorischen Periode
sichtbar, die vor der Errichtung dieser späten Mauern niedergelegt worden
sind (w und x)^).
ln Mauer c und in Mauer f finden sich vermauerte Wandöffnungen,
die letztere zeigt Abb. 4 (in der Mauer, auf die der Sitzende die Füße
stellt). An die ursprünglich freie antenartige Endigung, mit der Mauer 1
vor die Flucht von Mauer i vortrat, ist Mauer E als Verlängerung von
Mauer 1 angebaut, wie auf Abb. 2 (ganz im Vordergrund) sichtbar ist,
und zwar nach Beseitigung einer älteren Mauer, deren unterste Schichten
südlich neben E noch erhalten sind. Auch bei der Errichtung von
Mauer h ist eine ältere Mauer niedergelegt worden.
Diese Umbauten lassen ebenso wie der erwähnte Einbau eine lange
Benutzung der aufgedeckten Häuser erkennen. Ohne eine Besiedlungs-
pause werden diese Mauern Bewohner beherbergt haben, bis ihr Oberbau
.zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerissen und der ganze Platz zu einem
einheitlichen Niveau eingeebnet wurde.
Die räumliche Gruppierung der Mauern.
Eine Straße oder auch nur eine planmäßige Gruppierung der Mauern
und Räume zueinander ist auf dem beschränkten Raum nicht erkenn-
bar, nicht einmal ein richtiger Hausgrundriß läßt sich konstruieren. Wo
sich, wie bei den genannten vier Zimmern, die Mauern zusammen-
schließen, ergeben sich kleine, von schiefwinklig zueinander stehenden
Wänden umschlossene Räume. Es läßt sich nicht mehr feststellen, ob
diese vier Zimmer zu einem oder zwei Häusern gehören, im letzteren
Fall würde die Mauer 1 als gemeinsame Zwischenwand zwischen zwei
A Sie würde etwa den Raumdispositionen des Hauses 33 aus der 2. Periode
von Phyiakopi — vgi. Phyiakopi S. 45 Fig. 34 —- entsprochen haben.
h Die breite Mauer, die ganz im N. den Ausgrabungspiatz abschiießt —
auf dem Pian nicht angegeben, in dem Schnitt ganz rechts — ist ein Tei! der
venezianischen Schioßmauer.
0. Rubensohn
einteilungi) die Mauern a, c und d mit benutzt. Deutlich einer späteren
Epoche gehört Mauer p an, die z. T. auf Schutt, z. T. auf der alten Mauer
q steht (Vgl. den Schnitt auf Tafel 11.). Aus ganz später, schon hel-
lenischer Zeit rührt die Gruppe der Mauern v, y, z ganz im Norden her,
in denen sich mehrfach piofilierte Marmorsteine, Bauglieder aus helleni-
schen Bauten, verbaut finden. Unter ihnen, nur noch in ganz
schwachen Resten erhalten, werden Mauern der praehistorischen Periode
sichtbar, die vor der Errichtung dieser späten Mauern niedergelegt worden
sind (w und x)^).
ln Mauer c und in Mauer f finden sich vermauerte Wandöffnungen,
die letztere zeigt Abb. 4 (in der Mauer, auf die der Sitzende die Füße
stellt). An die ursprünglich freie antenartige Endigung, mit der Mauer 1
vor die Flucht von Mauer i vortrat, ist Mauer E als Verlängerung von
Mauer 1 angebaut, wie auf Abb. 2 (ganz im Vordergrund) sichtbar ist,
und zwar nach Beseitigung einer älteren Mauer, deren unterste Schichten
südlich neben E noch erhalten sind. Auch bei der Errichtung von
Mauer h ist eine ältere Mauer niedergelegt worden.
Diese Umbauten lassen ebenso wie der erwähnte Einbau eine lange
Benutzung der aufgedeckten Häuser erkennen. Ohne eine Besiedlungs-
pause werden diese Mauern Bewohner beherbergt haben, bis ihr Oberbau
.zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerissen und der ganze Platz zu einem
einheitlichen Niveau eingeebnet wurde.
Die räumliche Gruppierung der Mauern.
Eine Straße oder auch nur eine planmäßige Gruppierung der Mauern
und Räume zueinander ist auf dem beschränkten Raum nicht erkenn-
bar, nicht einmal ein richtiger Hausgrundriß läßt sich konstruieren. Wo
sich, wie bei den genannten vier Zimmern, die Mauern zusammen-
schließen, ergeben sich kleine, von schiefwinklig zueinander stehenden
Wänden umschlossene Räume. Es läßt sich nicht mehr feststellen, ob
diese vier Zimmer zu einem oder zwei Häusern gehören, im letzteren
Fall würde die Mauer 1 als gemeinsame Zwischenwand zwischen zwei
A Sie würde etwa den Raumdispositionen des Hauses 33 aus der 2. Periode
von Phyiakopi — vgi. Phyiakopi S. 45 Fig. 34 —- entsprochen haben.
h Die breite Mauer, die ganz im N. den Ausgrabungspiatz abschiießt —
auf dem Pian nicht angegeben, in dem Schnitt ganz rechts — ist ein Tei! der
venezianischen Schioßmauer.