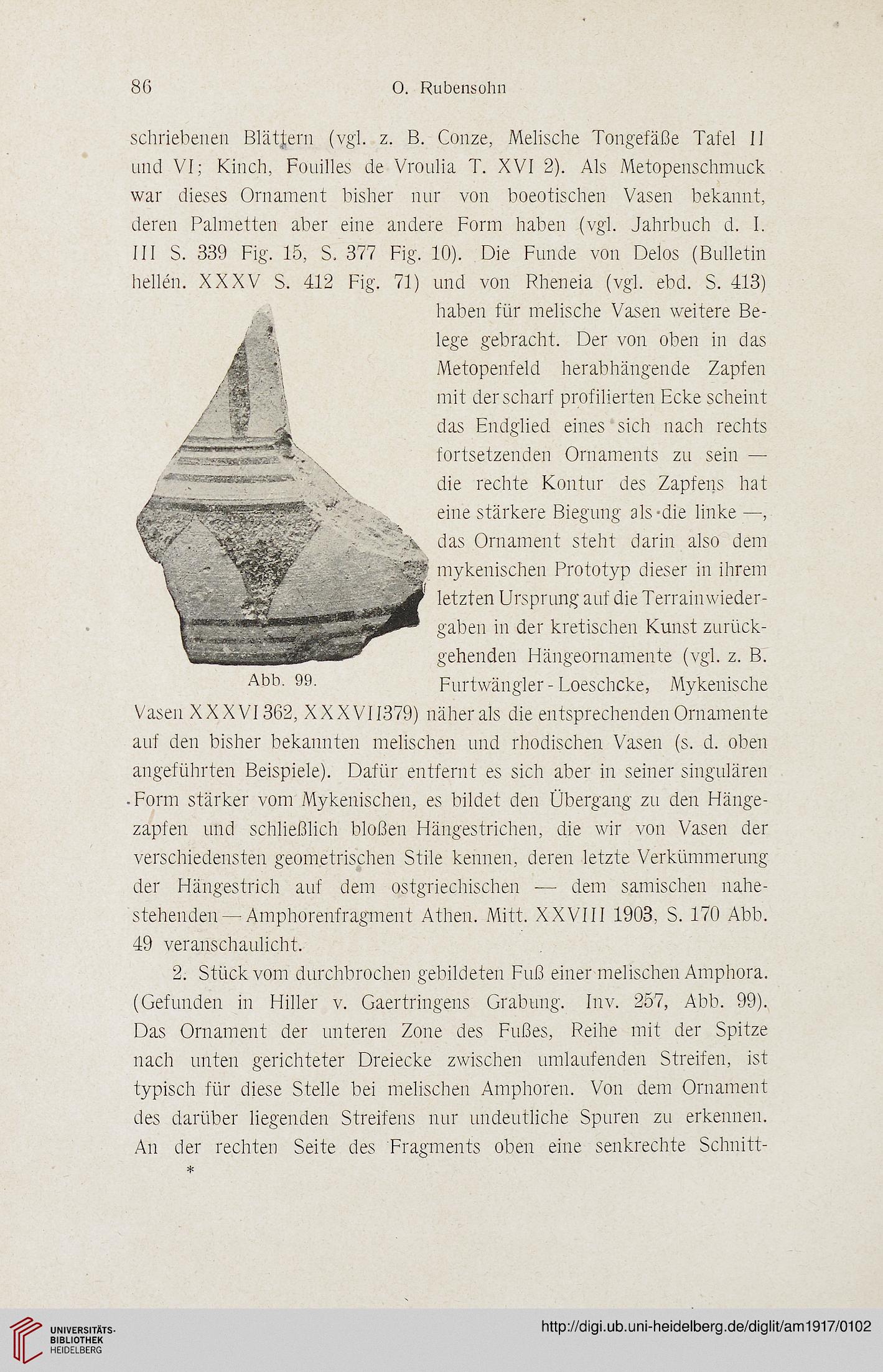86
O. Rubensohn
schriebenen Blättern (vgl. z. B. Conze, Mellsche Tongefäße Tafel 11
und VI; Kinch, Fouilles de Vroulia T. XVI 2). Als Metopenschmuck
war dieses Ornament bisher nur von boeotischen Vasen bekannt,
deren Palmetten aber eine andere Form haben (vgl. Jahrbuch d. 1.
111 S. 339 Fig. 15, S. 377 Fig. 10). Die Funde von Delos (Bulletin
hellen. XXXV S. 412 Fig. 71) und von Rheneia (vgl. ebd. S. 413)
haben für melische Vasen weitere Be-
lege gebracht. Der von oben in das
Metopenfeld herabhängende Zapfen
mit der scharf profilierten Ecke scheint
das Endglied eines sich nach rechts
fortsetzenden Ornaments zu sein —
die rechte Kontur des Zapfens hat
eine stärkere Biegung als-die linke—,
das Ornament steht darin also dem
mykenischen Prototyp dieser in ihrem
y letzten Ursprung auf die Terrainwieder-
* gaben in der kretischen Kunst zurück-
gehenden Hängeornamente (vgl. z. B.
Furtwängler - Loeschcke, Mykenische
Abb. 99.
Vasen XXXVI 362, XXXVI1379) näher als die entsprechenden Ornamente
auf den bisher bekannten nrelischen und rhodischen Vasen (s. d. oben
angeführten Beispiele). Dafür entfernt es sich aber in seiner singulären
-Form stärker vom Mykenischen, es bildet den Übergang zu den Hänge-
zapfen und schließlich bloßen Hängestrichen, die wir von Vasen der
verschiedensten geometrischen Stile kennen, deren letzte Verkümmerung
der Hängestrich auf dem ostgriechischen — dem samischen nahe-
stehenden— Amphorenfragment Athen. Mitt. XXVIII 1903, S. 170 Abb.
49 veranschaulicht.
2. Stück vom durchbrochen gebildeten Fuß einer nrelischen Amphora.
(Gefunden in Hiller v. Gaertringens Grabung. Inv. 257, Abb. 99).
Das Ornament der unteren Zone des Fußes, Reihe mit der Spitze
nach unten gerichteter Dreiecke zwischen umlaufenden Streifen, ist
typisch für diese Stelle bei melischen Amphoren. Von dem Ornament
des darüber liegenden Streifens nur undeutliche Spuren zu erkennen.
An der rechten Seite des Fragments oben eine senkrechte Schnitt-
O. Rubensohn
schriebenen Blättern (vgl. z. B. Conze, Mellsche Tongefäße Tafel 11
und VI; Kinch, Fouilles de Vroulia T. XVI 2). Als Metopenschmuck
war dieses Ornament bisher nur von boeotischen Vasen bekannt,
deren Palmetten aber eine andere Form haben (vgl. Jahrbuch d. 1.
111 S. 339 Fig. 15, S. 377 Fig. 10). Die Funde von Delos (Bulletin
hellen. XXXV S. 412 Fig. 71) und von Rheneia (vgl. ebd. S. 413)
haben für melische Vasen weitere Be-
lege gebracht. Der von oben in das
Metopenfeld herabhängende Zapfen
mit der scharf profilierten Ecke scheint
das Endglied eines sich nach rechts
fortsetzenden Ornaments zu sein —
die rechte Kontur des Zapfens hat
eine stärkere Biegung als-die linke—,
das Ornament steht darin also dem
mykenischen Prototyp dieser in ihrem
y letzten Ursprung auf die Terrainwieder-
* gaben in der kretischen Kunst zurück-
gehenden Hängeornamente (vgl. z. B.
Furtwängler - Loeschcke, Mykenische
Abb. 99.
Vasen XXXVI 362, XXXVI1379) näher als die entsprechenden Ornamente
auf den bisher bekannten nrelischen und rhodischen Vasen (s. d. oben
angeführten Beispiele). Dafür entfernt es sich aber in seiner singulären
-Form stärker vom Mykenischen, es bildet den Übergang zu den Hänge-
zapfen und schließlich bloßen Hängestrichen, die wir von Vasen der
verschiedensten geometrischen Stile kennen, deren letzte Verkümmerung
der Hängestrich auf dem ostgriechischen — dem samischen nahe-
stehenden— Amphorenfragment Athen. Mitt. XXVIII 1903, S. 170 Abb.
49 veranschaulicht.
2. Stück vom durchbrochen gebildeten Fuß einer nrelischen Amphora.
(Gefunden in Hiller v. Gaertringens Grabung. Inv. 257, Abb. 99).
Das Ornament der unteren Zone des Fußes, Reihe mit der Spitze
nach unten gerichteter Dreiecke zwischen umlaufenden Streifen, ist
typisch für diese Stelle bei melischen Amphoren. Von dem Ornament
des darüber liegenden Streifens nur undeutliche Spuren zu erkennen.
An der rechten Seite des Fragments oben eine senkrechte Schnitt-