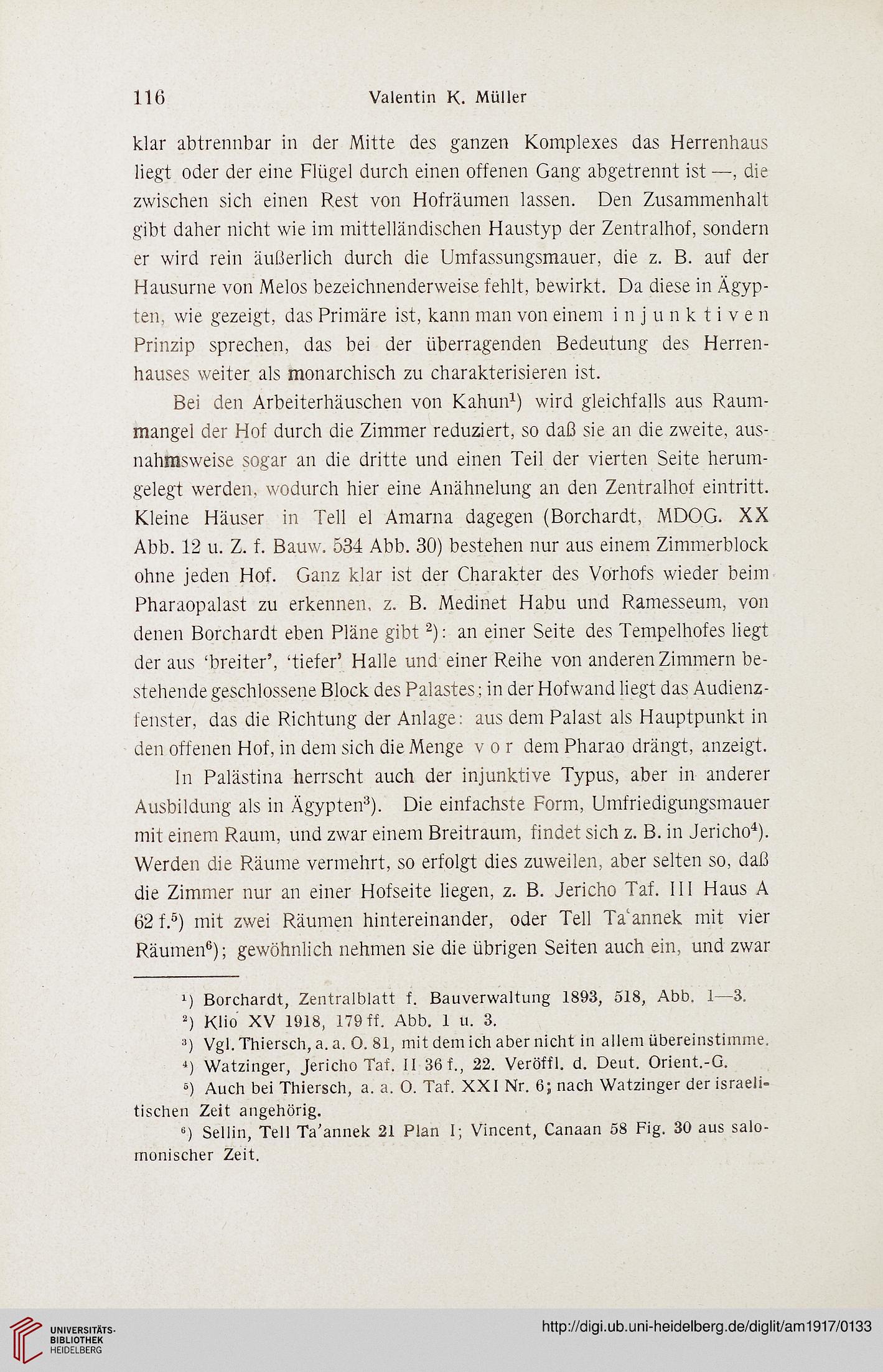116
Vaientin K. Müller
klar abtrennbar in der Mitte des ganzen Komplexes das Herrenhaus
liegt oder der eine Flügel durch einen offenen Gang abgetrennt ist —, die
zwischen sich einen Rest von Hofräumen lassen. Den Zusammenhalt
gibt daher nicht wie im mittelländischen Haustyp der Zentralhof, sondern
er wird rein äußerlich durch die Umfassungsmauer, die z. B. auf der
Hausurne von Melos bezeichnenderweise fehlt, bewirkt. Da diese in Ägyp-
ten, wie gezeigt, das Primäre ist, kann man von einem i n j u n k t i v e n
Prinzip sprechen, das bei der überragenden Bedeutung des Herren-
hauses weiter als monarchisch zu charakterisieren ist.
Bei den Arbeiterhäuschen von KahuiF) wird gleichfalls aus Raum-
mangel der Hof durch die Zimmer reduziert, so daß sie an die zweite, aus-
nahmsweise sogar an die dritte und einen Teil der vierten Seite herum-
gelegt werden, wodurch hier eine Anähnelung an den Zentralhof eintritt.
Kleine Häuser in Teil el Amarna dagegen (Borchardt, MDOG. XX
Abb. 12 u. Z. f. Bauw. 534 Abb. 30) bestehen nur aus einem Zimmerblock
ohne jeden Hof. Ganz klar ist der Charakter des Vorhofs wieder beim
Pharaopalast zu erkennen, z. B. Medinet Habu und Ramesseum, von
denen Borchardt eben Pläne gibt ^): an einer Seite des Tempelhofes liegt
der aus 'breiter', 'tiefer' Halle und einer Reihe von anderen Zimmern be-
stehendegeschlossene Block des Palastes ; in der Hofwand liegt das Audienz-
fenster. das die Richtung der Anlage: aus dem Palast als Hauptpunkt in
den offenen Hof, in dem sich die Menge vor dem Pharao drängt, anzeigt.
ln Palästina herrscht auch der injunktive Typus, aber in anderer
Ausbildung als in Ägypten^). Die einfachste Form, Umfriedigungsmauer
mit einem Raum, und zwar einem Breitraum, findet sich z. B. in Jericho* **)).
Werden die Räume vermehrt, so erfolgt dies zuweilen, aber selten so, daß
die Zimmer nur an einer Hofseite liegen, z. B. Jericho Tat. Hl Haus A
62f.3) mit zwei Räumen hintereinander, oder Teil Ta'annek mit vier
Räumen^); gewöhnlich nehmen sie die übrigen Seiten auch ein, und zwar
*) Borchardt, Zentraibiatt f. Bauverwaltung 1893, 518, Abb. 1—3.
3) Rho XV 1918, 179 ff. Abb. 1 u. 3.
3) Vgl. Thiersch, a. a. 0. 81, mit dem ich aber nicht in allem übereinstimme.
**) Watzinger, Jericho Tat. 11 36 f., 22. Veröffl. d. Deut. Orient.-G.
5) Auch bei Thiersch, a. a. O. Taf. XXI Nr. 6; nach Watzinger der israeli-
tischen Zeit angehörig.
") Sellin, Teil Ta'annek 21 Plan 1; Vincent, Canaan 58 Fig. 30 aus salo-
monischer Zeit.
Vaientin K. Müller
klar abtrennbar in der Mitte des ganzen Komplexes das Herrenhaus
liegt oder der eine Flügel durch einen offenen Gang abgetrennt ist —, die
zwischen sich einen Rest von Hofräumen lassen. Den Zusammenhalt
gibt daher nicht wie im mittelländischen Haustyp der Zentralhof, sondern
er wird rein äußerlich durch die Umfassungsmauer, die z. B. auf der
Hausurne von Melos bezeichnenderweise fehlt, bewirkt. Da diese in Ägyp-
ten, wie gezeigt, das Primäre ist, kann man von einem i n j u n k t i v e n
Prinzip sprechen, das bei der überragenden Bedeutung des Herren-
hauses weiter als monarchisch zu charakterisieren ist.
Bei den Arbeiterhäuschen von KahuiF) wird gleichfalls aus Raum-
mangel der Hof durch die Zimmer reduziert, so daß sie an die zweite, aus-
nahmsweise sogar an die dritte und einen Teil der vierten Seite herum-
gelegt werden, wodurch hier eine Anähnelung an den Zentralhof eintritt.
Kleine Häuser in Teil el Amarna dagegen (Borchardt, MDOG. XX
Abb. 12 u. Z. f. Bauw. 534 Abb. 30) bestehen nur aus einem Zimmerblock
ohne jeden Hof. Ganz klar ist der Charakter des Vorhofs wieder beim
Pharaopalast zu erkennen, z. B. Medinet Habu und Ramesseum, von
denen Borchardt eben Pläne gibt ^): an einer Seite des Tempelhofes liegt
der aus 'breiter', 'tiefer' Halle und einer Reihe von anderen Zimmern be-
stehendegeschlossene Block des Palastes ; in der Hofwand liegt das Audienz-
fenster. das die Richtung der Anlage: aus dem Palast als Hauptpunkt in
den offenen Hof, in dem sich die Menge vor dem Pharao drängt, anzeigt.
ln Palästina herrscht auch der injunktive Typus, aber in anderer
Ausbildung als in Ägypten^). Die einfachste Form, Umfriedigungsmauer
mit einem Raum, und zwar einem Breitraum, findet sich z. B. in Jericho* **)).
Werden die Räume vermehrt, so erfolgt dies zuweilen, aber selten so, daß
die Zimmer nur an einer Hofseite liegen, z. B. Jericho Tat. Hl Haus A
62f.3) mit zwei Räumen hintereinander, oder Teil Ta'annek mit vier
Räumen^); gewöhnlich nehmen sie die übrigen Seiten auch ein, und zwar
*) Borchardt, Zentraibiatt f. Bauverwaltung 1893, 518, Abb. 1—3.
3) Rho XV 1918, 179 ff. Abb. 1 u. 3.
3) Vgl. Thiersch, a. a. 0. 81, mit dem ich aber nicht in allem übereinstimme.
**) Watzinger, Jericho Tat. 11 36 f., 22. Veröffl. d. Deut. Orient.-G.
5) Auch bei Thiersch, a. a. O. Taf. XXI Nr. 6; nach Watzinger der israeli-
tischen Zeit angehörig.
") Sellin, Teil Ta'annek 21 Plan 1; Vincent, Canaan 58 Fig. 30 aus salo-
monischer Zeit.