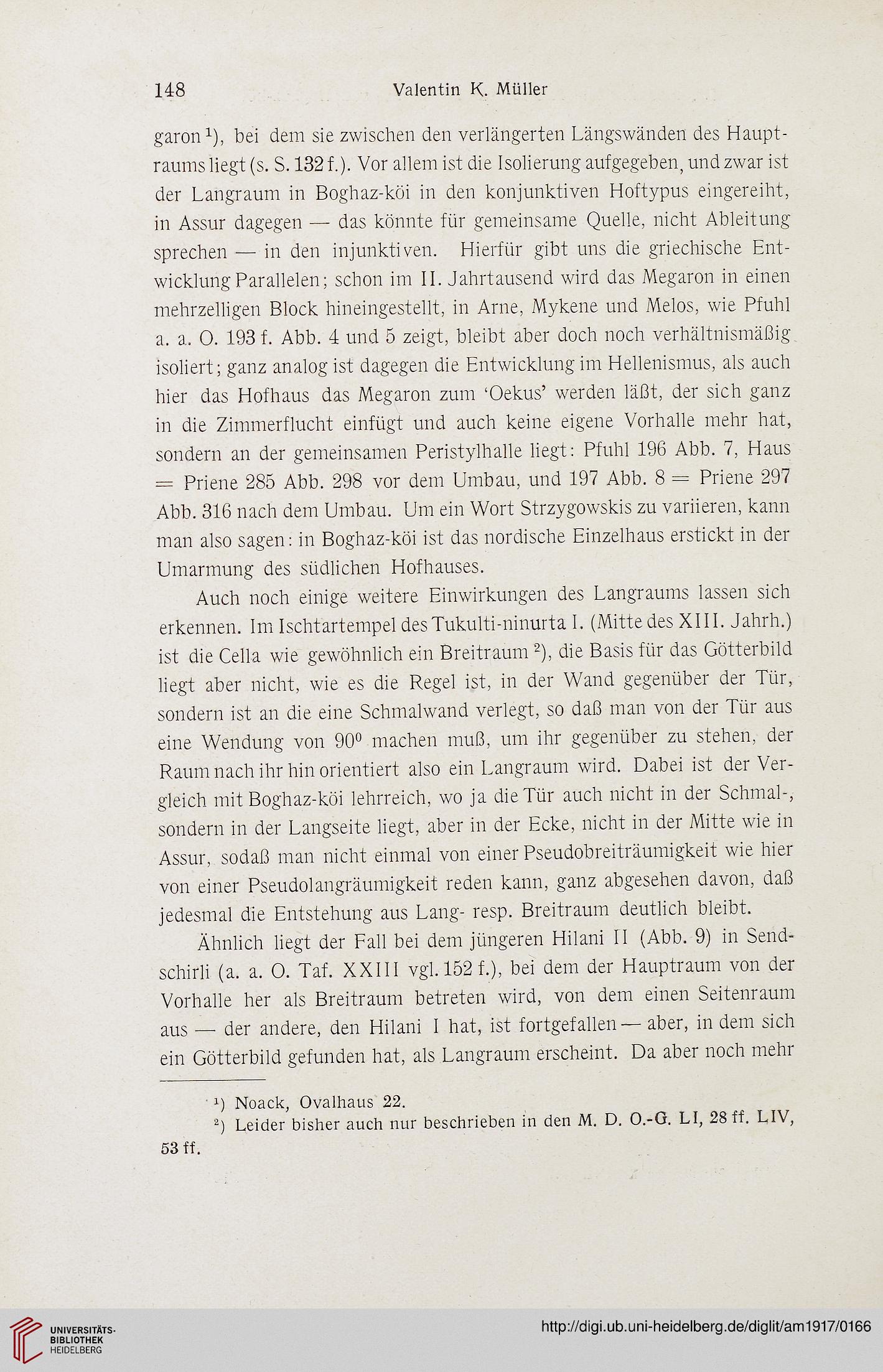148
Valentin K. Müiler
garon^), bei dem sie zwischen den verlängerten Längswänden des Haupt-
raums liegt (s. S. 132 f.). Vor allem ist die Isolierung aufgegeben, und zwar ist
der Langraum in Boghaz-köi in den konjunktiven Hoftypus eingereiht,
in Assur dagegen — das könnte für gemeinsame Quelle, nicht Ableitung
sprechen — in den injunktiven. Hierfür gibt uns die griechische Ent-
wicklung Parallelen; schon im II. Jahrtausend wird das Megaron in einen
mehrzelligen Block hineingestellt, in Arne, Mykene und Melos, wie Pfuhl
a. a. 0. 193 f. Abb. 4 und 5 zeigt, bleibt aber doch noch verhältnismäßig
isoliert; ganz analog ist dagegen die Entwicklung im Hellenismus, als auch
hier das Hofhaus das Megaron zum 'Oekus' werden läßt, der sich ganz
in die Zimmerflucht einfügt und auch keine eigene Vorhalle mehr hat,
sondern an der gemeinsamen Peristylhalle liegt: Pfuhl 196 Abb. 7, Haus
— Priene 285 Abb. 298 vor dem Umbau, und 197 Abb. 8 = Priene 297
Abb. 316 nach dem Umbau. Um ein Wort Strzygowskis zu variieren, kann
man also sagen: in Boghaz-köi ist das nordische Einzelhaus erstickt in der
Umarmung des südlichen Hofhauses.
Auch noch einige weitere Einwirkungen des Langraums lassen sich
erkennen. Im Ischtartempel desTukulti-ninurta I. (Mitte des XIII. Jahrh.)
ist die Cella wie gewöhnlich ein Breitraum ^), die Basis für das Götterbild
liegt aber nicht, wie es die Regel ist, in der Wand gegenüber der Tür,
sondern ist an die eine Schmalwand verlegt, so daß man von der Tür aus
eine Wendung von 90° machen muß, um ihr gegenüber zu stehen, der
Raum nach ihr hin orientiert also ein Langraum wird. Dabei ist der Ver-
gleich mit Boghaz-köi lehrreich, wo ja die Tür auch nicht in der Schmal-,
sondern in der Langseite liegt, aber in der Ecke, nicht in der Mitte wie in
Assur, sodaß man nicht einmal von einer Pseudobreiträumigkeit wie hier
von einer Pseudolangräumigkeit reden kann, ganz abgesehen davon, daß
jedesmal die Entstehung aus Lang- resp. Breitraum deutlich bleibt.
Ähnlich liegt der Fall bei dem jüngeren Hilani II (Abb. 9) in Send-
schirli (a. a. 0. Tat. XXIII vgl. 152 f.), bei dem der Hauptraum von der
Vorhalle her als Breitraum betreten wird, von dem einen Seitenraum
aus — der andere, den Hilani I hat, ist fortgefallen— aber, in dem sich
ein Götterbild gefunden hat, als Langraum erscheint. Da aber noch mehr
i) Noack, Ovaihaus 22.
H Leider bisher auch nur beschrieben in den M. D. O.-G. LI, 28 ff. LIV,
53 ff.
Valentin K. Müiler
garon^), bei dem sie zwischen den verlängerten Längswänden des Haupt-
raums liegt (s. S. 132 f.). Vor allem ist die Isolierung aufgegeben, und zwar ist
der Langraum in Boghaz-köi in den konjunktiven Hoftypus eingereiht,
in Assur dagegen — das könnte für gemeinsame Quelle, nicht Ableitung
sprechen — in den injunktiven. Hierfür gibt uns die griechische Ent-
wicklung Parallelen; schon im II. Jahrtausend wird das Megaron in einen
mehrzelligen Block hineingestellt, in Arne, Mykene und Melos, wie Pfuhl
a. a. 0. 193 f. Abb. 4 und 5 zeigt, bleibt aber doch noch verhältnismäßig
isoliert; ganz analog ist dagegen die Entwicklung im Hellenismus, als auch
hier das Hofhaus das Megaron zum 'Oekus' werden läßt, der sich ganz
in die Zimmerflucht einfügt und auch keine eigene Vorhalle mehr hat,
sondern an der gemeinsamen Peristylhalle liegt: Pfuhl 196 Abb. 7, Haus
— Priene 285 Abb. 298 vor dem Umbau, und 197 Abb. 8 = Priene 297
Abb. 316 nach dem Umbau. Um ein Wort Strzygowskis zu variieren, kann
man also sagen: in Boghaz-köi ist das nordische Einzelhaus erstickt in der
Umarmung des südlichen Hofhauses.
Auch noch einige weitere Einwirkungen des Langraums lassen sich
erkennen. Im Ischtartempel desTukulti-ninurta I. (Mitte des XIII. Jahrh.)
ist die Cella wie gewöhnlich ein Breitraum ^), die Basis für das Götterbild
liegt aber nicht, wie es die Regel ist, in der Wand gegenüber der Tür,
sondern ist an die eine Schmalwand verlegt, so daß man von der Tür aus
eine Wendung von 90° machen muß, um ihr gegenüber zu stehen, der
Raum nach ihr hin orientiert also ein Langraum wird. Dabei ist der Ver-
gleich mit Boghaz-köi lehrreich, wo ja die Tür auch nicht in der Schmal-,
sondern in der Langseite liegt, aber in der Ecke, nicht in der Mitte wie in
Assur, sodaß man nicht einmal von einer Pseudobreiträumigkeit wie hier
von einer Pseudolangräumigkeit reden kann, ganz abgesehen davon, daß
jedesmal die Entstehung aus Lang- resp. Breitraum deutlich bleibt.
Ähnlich liegt der Fall bei dem jüngeren Hilani II (Abb. 9) in Send-
schirli (a. a. 0. Tat. XXIII vgl. 152 f.), bei dem der Hauptraum von der
Vorhalle her als Breitraum betreten wird, von dem einen Seitenraum
aus — der andere, den Hilani I hat, ist fortgefallen— aber, in dem sich
ein Götterbild gefunden hat, als Langraum erscheint. Da aber noch mehr
i) Noack, Ovaihaus 22.
H Leider bisher auch nur beschrieben in den M. D. O.-G. LI, 28 ff. LIV,
53 ff.