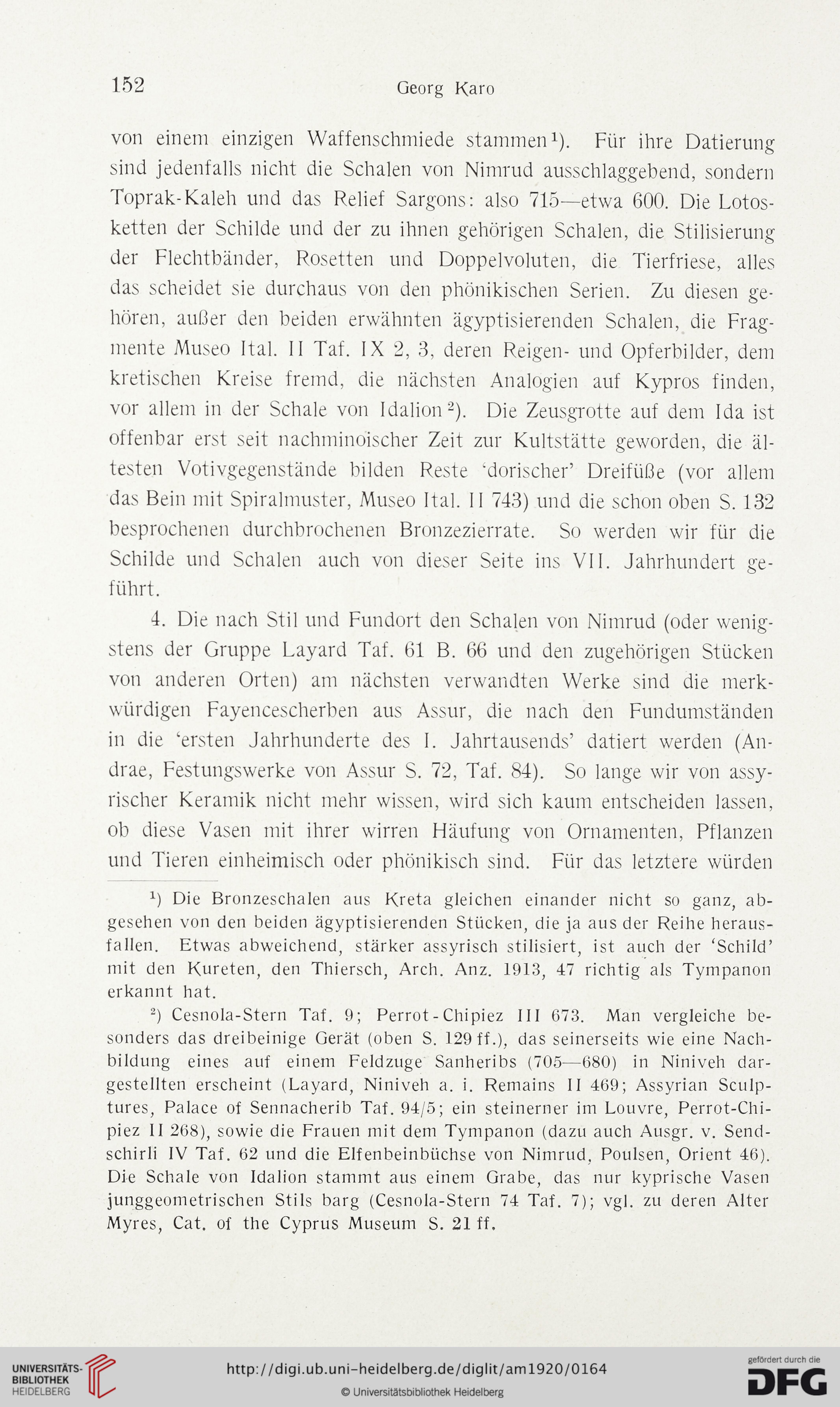152
Georg Karo
von einem einzigen Waffenschmiede stammen 1). Für ihre Datierung
sind jedenfalls nicht die Schalen von Nimrud ausschlaggebend, sondern
Toprak-Kaleh und das Relief Sargons: also 715—etwa 600. Die Lotos-
ketten der Schilde und der zu ihnen gehörigen Schalen, die Stilisierung
der Flechtbänder, Rosetten und Doppelvoluten, die Tierfriese, alles
das scheidet sie durchaus von den phönikischen Serien. Zu diesen ge-
hören, außer den beiden erwähnten ägyptisierenden Schalen, die Frag-
mente Museo Ital. II Taf. IX 2, 3, deren Reigen- und Opferbilder, dem
kretischen Kreise fremd, die nächsten Analogien auf Kypros finden,
vor allem in der Schale von Idalion 2). Die Zeusgrotte auf dem Ida ist
offenbar erst seit nachminoischer Zeit zur Kultstätte geworden, die äl-
testen Votivgegenstände bilden Reste ’dorischer’ Dreifüße (vor allem
das Bein mit Spiralmuster, Museo Ital. II 743) und die schon oben S. 132
besprochenen durchbrochenen Bronzezierrate. So werden wir für die
Schilde und Schalen auch von dieser Seite itis VII. Jahrhundert ge-
führt.
4. Die nach Stil und Fundort den Schalen von Niinrud (oder wenig-
stens der Gruppe Layard Taf. 61 B. 66 und den zugehörigen Stücken
von atideren Orten) am nächsten verwandten Werke sind die merk-
würdigen Fayencescherben aus Assur, die nach den Fundumständen
in die ‘ersten Jahrhunderte des I. Jahrtausends’ datiert werden (An-
drae, Festungswerke von Assur S. 72, Taf. 84). So lange wir von assy-
rischer Keramik nicht mehr wissen, wird sich kaum entscheiden lassen,
ob diese Vasen mit ihrer wirren Häufung von Ornamenten, Pflanzen
und Tieren einheimisch oder phönikisch sind. Für das letztere würden
V Die Bronzeschalen aus Kreta gleichen einander nicht so ganz, ab-
gesehen von den beiden ägyptisierenden Stücken, die ja aus der Reihe heraus-
fallen. Etwas abweichend, stärker assyrisch stilisiert, ist auch der ‘Schild’
mit den Kureten, den Thiersch, Arch. Anz. 1913, 47 richtig als Tympanon
erkannt hat.
2) Cesnola-Stern Taf. 9; Perrot- Chipiez III 673. Man vergleiche be-
sonders das dreibeinige Gerät (oben S. 129 ff.), üas seinerseits wie eine Nach-
bildung eines auf einem Feldzuge Sanheribs (705—680) in Niniveh dar-
gestellten erscheint (Layard, Niniveh a. i. Remains II 469; Assyrian Sculp-
tures, Palace of Sennacherib Taf. 94/5; ein steinerner im Louvre, Perrot-Chi-
piez II 268), sowie die Frauen mit denr Tympanon (dazu auch Ausgr. v. Send-
schirli IV Taf. 62 und die Elfenbeinbüchse von Nimrud, Poulsen, Orient 46).
Die Schale von Idalion stammt aus einem Grabe, das nur kyprische Vasen
junggeometrischen Stils barg (Cesnola-Stern 74 Taf. 7); vgl. zu deren Alter
Myres, Cat. of the Cyprus Museum S. 21 ff.
Georg Karo
von einem einzigen Waffenschmiede stammen 1). Für ihre Datierung
sind jedenfalls nicht die Schalen von Nimrud ausschlaggebend, sondern
Toprak-Kaleh und das Relief Sargons: also 715—etwa 600. Die Lotos-
ketten der Schilde und der zu ihnen gehörigen Schalen, die Stilisierung
der Flechtbänder, Rosetten und Doppelvoluten, die Tierfriese, alles
das scheidet sie durchaus von den phönikischen Serien. Zu diesen ge-
hören, außer den beiden erwähnten ägyptisierenden Schalen, die Frag-
mente Museo Ital. II Taf. IX 2, 3, deren Reigen- und Opferbilder, dem
kretischen Kreise fremd, die nächsten Analogien auf Kypros finden,
vor allem in der Schale von Idalion 2). Die Zeusgrotte auf dem Ida ist
offenbar erst seit nachminoischer Zeit zur Kultstätte geworden, die äl-
testen Votivgegenstände bilden Reste ’dorischer’ Dreifüße (vor allem
das Bein mit Spiralmuster, Museo Ital. II 743) und die schon oben S. 132
besprochenen durchbrochenen Bronzezierrate. So werden wir für die
Schilde und Schalen auch von dieser Seite itis VII. Jahrhundert ge-
führt.
4. Die nach Stil und Fundort den Schalen von Niinrud (oder wenig-
stens der Gruppe Layard Taf. 61 B. 66 und den zugehörigen Stücken
von atideren Orten) am nächsten verwandten Werke sind die merk-
würdigen Fayencescherben aus Assur, die nach den Fundumständen
in die ‘ersten Jahrhunderte des I. Jahrtausends’ datiert werden (An-
drae, Festungswerke von Assur S. 72, Taf. 84). So lange wir von assy-
rischer Keramik nicht mehr wissen, wird sich kaum entscheiden lassen,
ob diese Vasen mit ihrer wirren Häufung von Ornamenten, Pflanzen
und Tieren einheimisch oder phönikisch sind. Für das letztere würden
V Die Bronzeschalen aus Kreta gleichen einander nicht so ganz, ab-
gesehen von den beiden ägyptisierenden Stücken, die ja aus der Reihe heraus-
fallen. Etwas abweichend, stärker assyrisch stilisiert, ist auch der ‘Schild’
mit den Kureten, den Thiersch, Arch. Anz. 1913, 47 richtig als Tympanon
erkannt hat.
2) Cesnola-Stern Taf. 9; Perrot- Chipiez III 673. Man vergleiche be-
sonders das dreibeinige Gerät (oben S. 129 ff.), üas seinerseits wie eine Nach-
bildung eines auf einem Feldzuge Sanheribs (705—680) in Niniveh dar-
gestellten erscheint (Layard, Niniveh a. i. Remains II 469; Assyrian Sculp-
tures, Palace of Sennacherib Taf. 94/5; ein steinerner im Louvre, Perrot-Chi-
piez II 268), sowie die Frauen mit denr Tympanon (dazu auch Ausgr. v. Send-
schirli IV Taf. 62 und die Elfenbeinbüchse von Nimrud, Poulsen, Orient 46).
Die Schale von Idalion stammt aus einem Grabe, das nur kyprische Vasen
junggeometrischen Stils barg (Cesnola-Stern 74 Taf. 7); vgl. zu deren Alter
Myres, Cat. of the Cyprus Museum S. 21 ff.