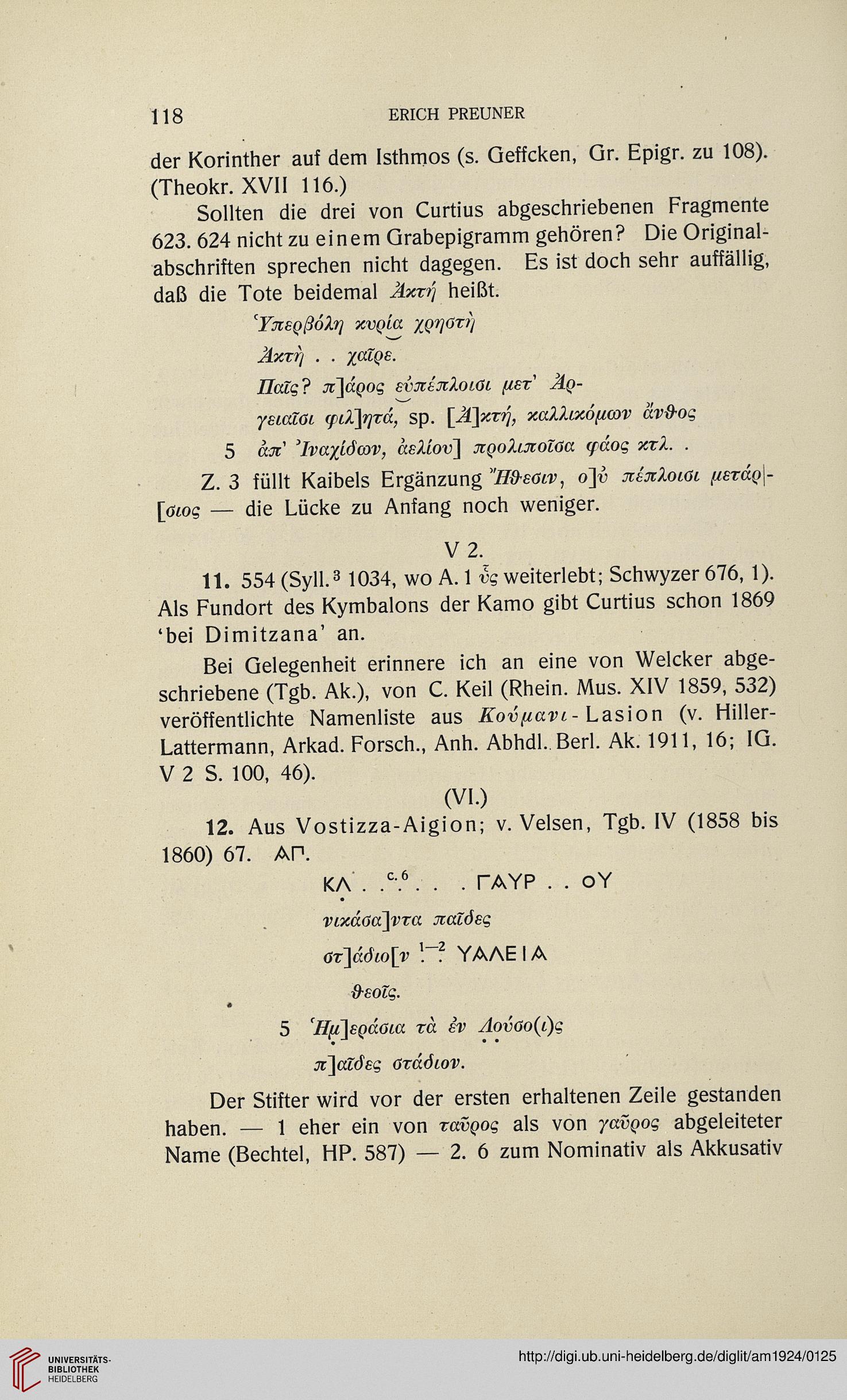118
ERICH PREUNER
der Korinther auf dem Isthmos (s. Geffcken, Gr. Epigr. zu 108).
(Theokr. XVII 116.)
Sollten die drei von Curtius abgeschriebenen Fragmente
623. 624 nicht zu einem Grabepigramm gehören? Die Original-
abschriften sprechen nicht dagegen. Es ist doch sehr auffällig,
daß die Tote beidemal Äxvrj heißt.
CYjl£Qß6b] XVQta XQt]GTQ
Äxtt] . . yalQE.
JJatq ? ji\aQoq TVJttJiXo/.öt (zet Äq-
ystatöt (ftX\r]Td, sp. [Ä\xt?], xaXbxo(tcov ävO-og
5 aJi' Jvaytdoiv, deUov\ JiQoltJiolöa qdoq xt 1. .
Z. 3 füllt Kaibels Ergänzung *'HJsötv, o\v jisjilotöt (israQ\-
[ötoq — die Lücke zu Anfang noch weniger.
V 2.
11. 554 (Syll. 3 1034, wo A. 1 vg weiterlebt; Schwyzer 676, 1).
Als Fundort des Kymbalons der Kamo gibt Curtius schon 1869
‘bei Dimitzana’ an.
Bei Gelegenheit erinnere ich an eine von Welcker abge-
schriebene (Tgb. Ak.), von C. Keil (Rhein. Mus. XIV 1859, 532)
veröffentlichte Namenliste aus Kov(iavt- Lasion (v. Hiller-
Lattermann, Arkad. Forsch., Anh. Abhdl. Berl. Ak. 1911, 16; IG.
V 2 S. 100, 46).
(VI.)
12. Aus Vostizza-Aigion; v. Velsen, Tgb. IV (1858 bis
1860) 67. AP.
KA . , c\ 6. . . rAYP . . oY
vtxdöa\vva Jtatösq
öT\aöto[v 'r 2 YAAE IA
Q-sotq.
5 cH(i\sQdöta va sv Aovöo(t)q
ji\atösq öTaötov.
Der Stifter wird vor der ersten erhaltenen Zeile gestanden
haben. — 1 eher ein von vavQoq als von yavQoq abgeleiteter
Name (Bechtel, HP. 587) — 2. 6 zum Nominativ als Akkusativ
ERICH PREUNER
der Korinther auf dem Isthmos (s. Geffcken, Gr. Epigr. zu 108).
(Theokr. XVII 116.)
Sollten die drei von Curtius abgeschriebenen Fragmente
623. 624 nicht zu einem Grabepigramm gehören? Die Original-
abschriften sprechen nicht dagegen. Es ist doch sehr auffällig,
daß die Tote beidemal Äxvrj heißt.
CYjl£Qß6b] XVQta XQt]GTQ
Äxtt] . . yalQE.
JJatq ? ji\aQoq TVJttJiXo/.öt (zet Äq-
ystatöt (ftX\r]Td, sp. [Ä\xt?], xaXbxo(tcov ävO-og
5 aJi' Jvaytdoiv, deUov\ JiQoltJiolöa qdoq xt 1. .
Z. 3 füllt Kaibels Ergänzung *'HJsötv, o\v jisjilotöt (israQ\-
[ötoq — die Lücke zu Anfang noch weniger.
V 2.
11. 554 (Syll. 3 1034, wo A. 1 vg weiterlebt; Schwyzer 676, 1).
Als Fundort des Kymbalons der Kamo gibt Curtius schon 1869
‘bei Dimitzana’ an.
Bei Gelegenheit erinnere ich an eine von Welcker abge-
schriebene (Tgb. Ak.), von C. Keil (Rhein. Mus. XIV 1859, 532)
veröffentlichte Namenliste aus Kov(iavt- Lasion (v. Hiller-
Lattermann, Arkad. Forsch., Anh. Abhdl. Berl. Ak. 1911, 16; IG.
V 2 S. 100, 46).
(VI.)
12. Aus Vostizza-Aigion; v. Velsen, Tgb. IV (1858 bis
1860) 67. AP.
KA . , c\ 6. . . rAYP . . oY
vtxdöa\vva Jtatösq
öT\aöto[v 'r 2 YAAE IA
Q-sotq.
5 cH(i\sQdöta va sv Aovöo(t)q
ji\atösq öTaötov.
Der Stifter wird vor der ersten erhaltenen Zeile gestanden
haben. — 1 eher ein von vavQoq als von yavQoq abgeleiteter
Name (Bechtel, HP. 587) — 2. 6 zum Nominativ als Akkusativ