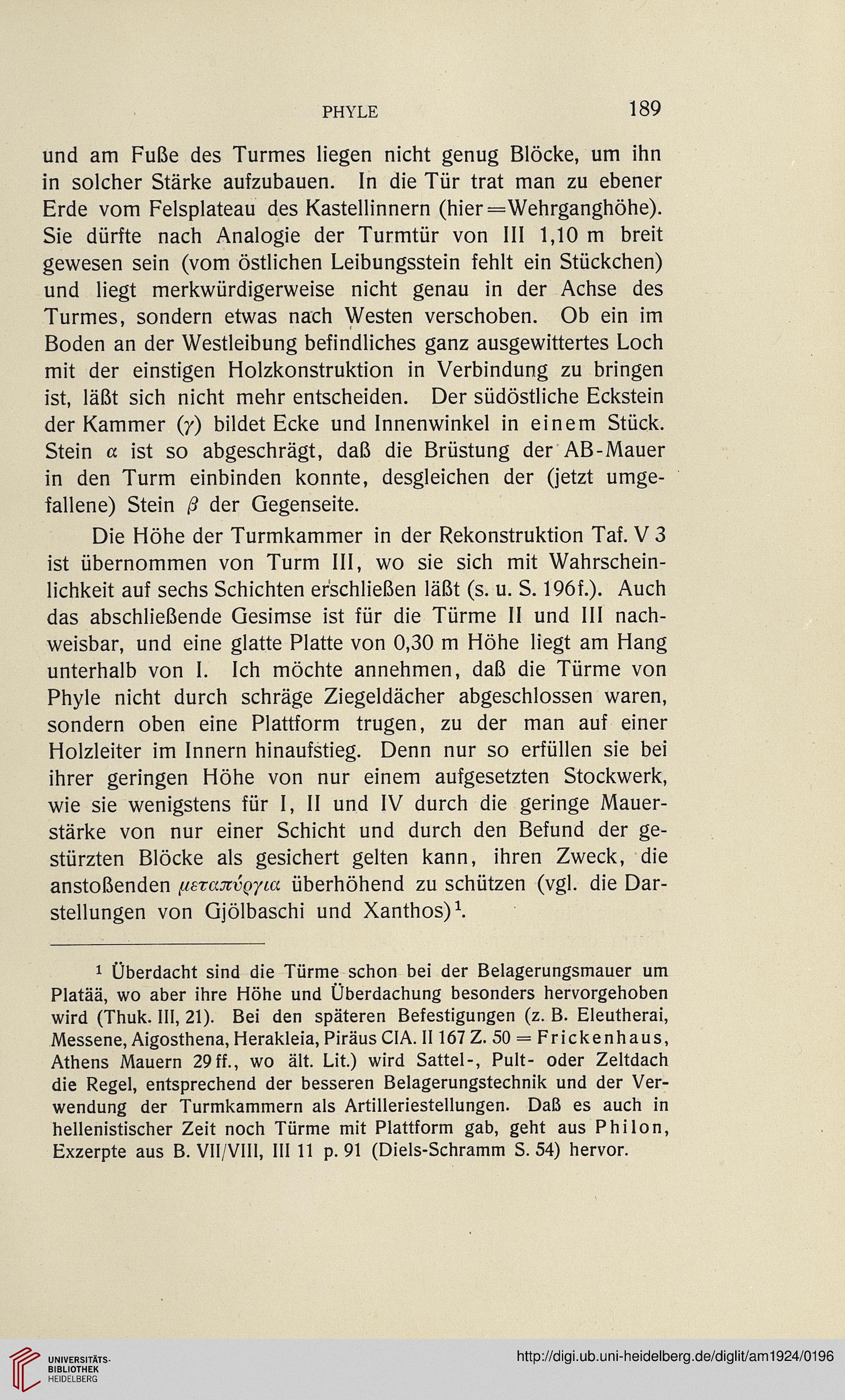PHYLE
189
und am Fuße des Turmes liegen nicht genug Blöcke, um ihn
in solcher Stärke aufzubauen. In die Tür trat man zu ebener
Erde vom Felsplateau des Kastellinnern (hier=Wehrganghöhe).
Sie dürfte nach Analogie der Turmtür von III 1,10 m breit
gewesen sein (vom östlichen Leibungsstein fehlt ein Stückchen)
und liegt merkwürdigerweise nicht genau in der Achse des
Turmes, sondern etwas nach Westen verschoben. Ob ein im
Boden an der Westleibung befindliches ganz ausgewittertes Loch
mit der einstigen Holzkonstruktion in Verbindung zu bringen
ist, läßt sich nicht mehr entscheiden. Der südöstliche Eckstein
der Kammer (/) bildet Ecke und Innenwinkel in einem Stück.
Stein a ist so abgeschrägt, daß die Brüstung der AB-Mauer
in den Turm einbinden konnte, desgleichen der (jetzt umge-
fallene) Stein ß der Qegenseite.
Die Höhe der Turmkammer in der Rekonstruktion Taf. V 3
ist übernommen von Turm III, wo sie sich mit Wahrschein-
lichkeit auf sechs Schichten erschließen läßt (s. u. S. 196f.). Auch
das abschließende Qesimse ist für die Türme II und III nach-
weisbar, und eine glatte Platte von 0,30 m Höhe liegt am Hang
unterhalb von I. Ich möchte annehmen, daß die Türme von
Phyle nicht durch schräge Ziegeldächer abgeschlossen waren,
sondern oben eine Plattform trugen, zu der man auf einer
Holzleiter im Innern hinaufstieg. Denn nur so erfüllen sie bei
ihrer geringen Höhe von nur einem aufgesetzten Stockwerk,
wie sie wenigstens für I, II und IV durch die geringe Mauer-
stärke von nur einer Schicht und durch den Befund der ge-
stürzten Blöcke als gesichert gelten kann, ihren Zweck, die
anstoßenden f/svajtvQyia überhöhend zu schützen (vgl. die Dar-
stellungen von Gjölbaschi und Xanthos) 1.
1 Überdacht sind die Türme schon bei der Belagerungsmauer um
Platää, wo aber ihre Höhe und Überdachung besonders hervorgehoben
wird (Thuk. III, 21). Bei den späteren Befestigungen (z. B. Eleutherai,
Messene, Aigosthena, Herakleia, Piräus CIA. II167 Z. 50 = Frickenhaus,
Athens Mauern 29ff., wo ält. Lit.) wird Sattel-, Pult- oder Zeltdach
die Regel, entsprechend der besseren Belagerungstechnik und der Ver-
wendung der Turmkammern als Artilleriestellungen. Daß es auch in
hellenistischer Zeit noch Türme mit Plattform gab, geht aus Philon,
Exzerpte aus B. VII/VIII, III 11 p. 91 (Diels-Schramm S. 54) hervor.
189
und am Fuße des Turmes liegen nicht genug Blöcke, um ihn
in solcher Stärke aufzubauen. In die Tür trat man zu ebener
Erde vom Felsplateau des Kastellinnern (hier=Wehrganghöhe).
Sie dürfte nach Analogie der Turmtür von III 1,10 m breit
gewesen sein (vom östlichen Leibungsstein fehlt ein Stückchen)
und liegt merkwürdigerweise nicht genau in der Achse des
Turmes, sondern etwas nach Westen verschoben. Ob ein im
Boden an der Westleibung befindliches ganz ausgewittertes Loch
mit der einstigen Holzkonstruktion in Verbindung zu bringen
ist, läßt sich nicht mehr entscheiden. Der südöstliche Eckstein
der Kammer (/) bildet Ecke und Innenwinkel in einem Stück.
Stein a ist so abgeschrägt, daß die Brüstung der AB-Mauer
in den Turm einbinden konnte, desgleichen der (jetzt umge-
fallene) Stein ß der Qegenseite.
Die Höhe der Turmkammer in der Rekonstruktion Taf. V 3
ist übernommen von Turm III, wo sie sich mit Wahrschein-
lichkeit auf sechs Schichten erschließen läßt (s. u. S. 196f.). Auch
das abschließende Qesimse ist für die Türme II und III nach-
weisbar, und eine glatte Platte von 0,30 m Höhe liegt am Hang
unterhalb von I. Ich möchte annehmen, daß die Türme von
Phyle nicht durch schräge Ziegeldächer abgeschlossen waren,
sondern oben eine Plattform trugen, zu der man auf einer
Holzleiter im Innern hinaufstieg. Denn nur so erfüllen sie bei
ihrer geringen Höhe von nur einem aufgesetzten Stockwerk,
wie sie wenigstens für I, II und IV durch die geringe Mauer-
stärke von nur einer Schicht und durch den Befund der ge-
stürzten Blöcke als gesichert gelten kann, ihren Zweck, die
anstoßenden f/svajtvQyia überhöhend zu schützen (vgl. die Dar-
stellungen von Gjölbaschi und Xanthos) 1.
1 Überdacht sind die Türme schon bei der Belagerungsmauer um
Platää, wo aber ihre Höhe und Überdachung besonders hervorgehoben
wird (Thuk. III, 21). Bei den späteren Befestigungen (z. B. Eleutherai,
Messene, Aigosthena, Herakleia, Piräus CIA. II167 Z. 50 = Frickenhaus,
Athens Mauern 29ff., wo ält. Lit.) wird Sattel-, Pult- oder Zeltdach
die Regel, entsprechend der besseren Belagerungstechnik und der Ver-
wendung der Turmkammern als Artilleriestellungen. Daß es auch in
hellenistischer Zeit noch Türme mit Plattform gab, geht aus Philon,
Exzerpte aus B. VII/VIII, III 11 p. 91 (Diels-Schramm S. 54) hervor.