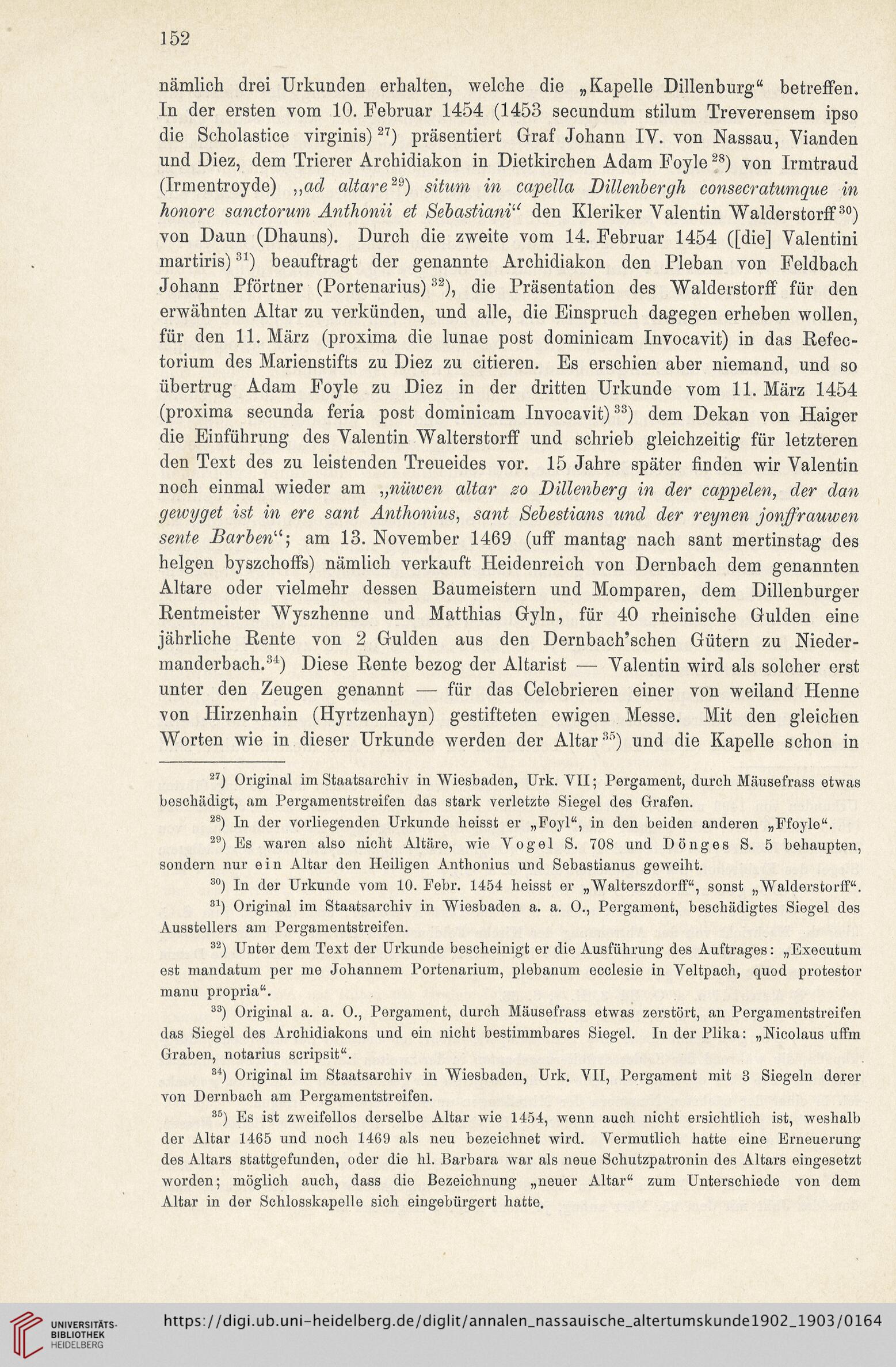152
nämlich drei Urkunden erhalten, welche die „Kapelle Dillenburg" betreffen.
In der ersten vom 10. Februar 1454 (1453 secundum stilum Treverensem ipso
die Seholastice virginis) 27) präsentiert Graf Johann IV. von Nassau, Vianden
und Diez, dem Trierer Archidiakon in Dietkirchen Adam Foyle 28) von Irmtraud
(Irmentroyde) „ad altare29) situm in capella Dillenbergh consecratumgue in
honore sanctorum Anthonii et Sebastiani" den Kleriker Valentin Walderstorff3°)
von Daun (Dhauns). Durch die zweite vom 14. Februar 1454 ([die] Valentini
martiris) 31) beauftragt der genannte Archidiakon den Pleban von Feldbach
Johann Pförtner (Portenarius) 32), die Präsentation des Walderstorff für den
erwähnten Altar zu verkünden, und alle, die Einspruch dagegen erheben wollen,
für den 11. März (proxima die lunae post dominicam Invocavit) in das Refee-
torium des Marienstifts zu Diez zu citieren. Es erschien aber niemand, und so
übertrug Adam Foyle zu Diez in der dritten Urkunde vom 11. März 1454
(proxima secunda feria post dominicam Invocavit) 33) dem Dekan von Haiger
die Einführung des Valentin Walterstorff und schrieb gleichzeitig für letzteren
den Text des zu leistenden Treueides vor. 15 Jahre später finden wir Valentin
noch einmal wieder am „nüwen altar ^o Dillenberg in der cappelen, der dan
gewyget ist in ere sant Anthonius, sant Sebestians und der regnen jonffrauwen
sente Darben"; am 13. November 1469 (uff mantag nach sant mertinstag des
helgen byszchoffs) nämlich verkauft Heidenreich von Dernbach dem genannten
Altäre oder vielmehr dessen Baumeistern und Momparen, dem Dillenburger
Rentmeister Wyszhenne und Matthias Gyln, für 40 rheinische Gulden eine
jährliche Rente von 2 Gulden aus den Dernbach'schen Gütern zu Nieder-
manderbach.34) Diese Rente bezog der Altarist — Valentin wird als solcher erst
unter den Zeugen genannt — für das Celebrieren einer von weiland Henne
von Hirzenhain (Hyrtzenhayn) gestifteten ewigen Messe. Mit den gleichen
Worten wie in dieser Urkunde werden der Altar35) und die Kapelle schon in
") Original im Staatsarchiv in Wiesbaden, Urk. VII; Pergament, durch Mäusefrass etwas
beschädigt, am Pergamentstreifen das stark verletzte Siegel des Grafen.
28) In der vorliegenden Urkunde heisst er „Foyl", in den beiden anderen „Ffoyle".
29) Es waren also nicht Altäre, wie Vogel B. 708 und Dönges 8. 5 behaupten,
sondern nur ein Altar den Heiligen Anthonius und Sebastianus geweiht.
3°) In der Urkunde vom 10. Febr. 1454 heisst er „Walterszdorff", sonst „Walderstorff".
31) Original im Staatsarchiv in Wiesbaden a. a. 0., Pergament, beschädigtes Siegel des
Ausstellers am Pergamentstreifen.
32) Unter dem Text der Urkunde bescheinigt er die Ausführung des Auftrages: „Executum
est mandatum per me Johannem Portenarium, plebanum ecclesie in Veltpach, quod protestor
manu propria".
33) Original a. a. 0., Pergament, durch Mäusefrass etwas zerstört, an Pergamentstreifen
das Siegel des Archidiakons und ein nicht bestimmbares Siegel. In der Plika: „Nicolaus uffm
Graben, notarius scripsit".
") Original im Staatsarchiv in Wiesbaden, Urk. VII, Pergament mit 3 Siegeln derer
von Dernbach am Pergamentstreifen.
35) Es ist zweifellos derselbe Altar wie 1454, wenn auch nicht ersichtlich ist, weshalb
der Altar 1465 und noch 1469 als neu bezeichnet wird. Vermutlich hatte eine Erneuerung
des Altars stattgefunden, oder die hl. Barbara war als neue Schutzpatronin des Altars eingesetzt
worden; möglich auch, dass die Bezeichnung „neuer Altar" zum Unterschiede von dem
Altar in der Schlosskapelle sich eingebürgert hatte.
nämlich drei Urkunden erhalten, welche die „Kapelle Dillenburg" betreffen.
In der ersten vom 10. Februar 1454 (1453 secundum stilum Treverensem ipso
die Seholastice virginis) 27) präsentiert Graf Johann IV. von Nassau, Vianden
und Diez, dem Trierer Archidiakon in Dietkirchen Adam Foyle 28) von Irmtraud
(Irmentroyde) „ad altare29) situm in capella Dillenbergh consecratumgue in
honore sanctorum Anthonii et Sebastiani" den Kleriker Valentin Walderstorff3°)
von Daun (Dhauns). Durch die zweite vom 14. Februar 1454 ([die] Valentini
martiris) 31) beauftragt der genannte Archidiakon den Pleban von Feldbach
Johann Pförtner (Portenarius) 32), die Präsentation des Walderstorff für den
erwähnten Altar zu verkünden, und alle, die Einspruch dagegen erheben wollen,
für den 11. März (proxima die lunae post dominicam Invocavit) in das Refee-
torium des Marienstifts zu Diez zu citieren. Es erschien aber niemand, und so
übertrug Adam Foyle zu Diez in der dritten Urkunde vom 11. März 1454
(proxima secunda feria post dominicam Invocavit) 33) dem Dekan von Haiger
die Einführung des Valentin Walterstorff und schrieb gleichzeitig für letzteren
den Text des zu leistenden Treueides vor. 15 Jahre später finden wir Valentin
noch einmal wieder am „nüwen altar ^o Dillenberg in der cappelen, der dan
gewyget ist in ere sant Anthonius, sant Sebestians und der regnen jonffrauwen
sente Darben"; am 13. November 1469 (uff mantag nach sant mertinstag des
helgen byszchoffs) nämlich verkauft Heidenreich von Dernbach dem genannten
Altäre oder vielmehr dessen Baumeistern und Momparen, dem Dillenburger
Rentmeister Wyszhenne und Matthias Gyln, für 40 rheinische Gulden eine
jährliche Rente von 2 Gulden aus den Dernbach'schen Gütern zu Nieder-
manderbach.34) Diese Rente bezog der Altarist — Valentin wird als solcher erst
unter den Zeugen genannt — für das Celebrieren einer von weiland Henne
von Hirzenhain (Hyrtzenhayn) gestifteten ewigen Messe. Mit den gleichen
Worten wie in dieser Urkunde werden der Altar35) und die Kapelle schon in
") Original im Staatsarchiv in Wiesbaden, Urk. VII; Pergament, durch Mäusefrass etwas
beschädigt, am Pergamentstreifen das stark verletzte Siegel des Grafen.
28) In der vorliegenden Urkunde heisst er „Foyl", in den beiden anderen „Ffoyle".
29) Es waren also nicht Altäre, wie Vogel B. 708 und Dönges 8. 5 behaupten,
sondern nur ein Altar den Heiligen Anthonius und Sebastianus geweiht.
3°) In der Urkunde vom 10. Febr. 1454 heisst er „Walterszdorff", sonst „Walderstorff".
31) Original im Staatsarchiv in Wiesbaden a. a. 0., Pergament, beschädigtes Siegel des
Ausstellers am Pergamentstreifen.
32) Unter dem Text der Urkunde bescheinigt er die Ausführung des Auftrages: „Executum
est mandatum per me Johannem Portenarium, plebanum ecclesie in Veltpach, quod protestor
manu propria".
33) Original a. a. 0., Pergament, durch Mäusefrass etwas zerstört, an Pergamentstreifen
das Siegel des Archidiakons und ein nicht bestimmbares Siegel. In der Plika: „Nicolaus uffm
Graben, notarius scripsit".
") Original im Staatsarchiv in Wiesbaden, Urk. VII, Pergament mit 3 Siegeln derer
von Dernbach am Pergamentstreifen.
35) Es ist zweifellos derselbe Altar wie 1454, wenn auch nicht ersichtlich ist, weshalb
der Altar 1465 und noch 1469 als neu bezeichnet wird. Vermutlich hatte eine Erneuerung
des Altars stattgefunden, oder die hl. Barbara war als neue Schutzpatronin des Altars eingesetzt
worden; möglich auch, dass die Bezeichnung „neuer Altar" zum Unterschiede von dem
Altar in der Schlosskapelle sich eingebürgert hatte.