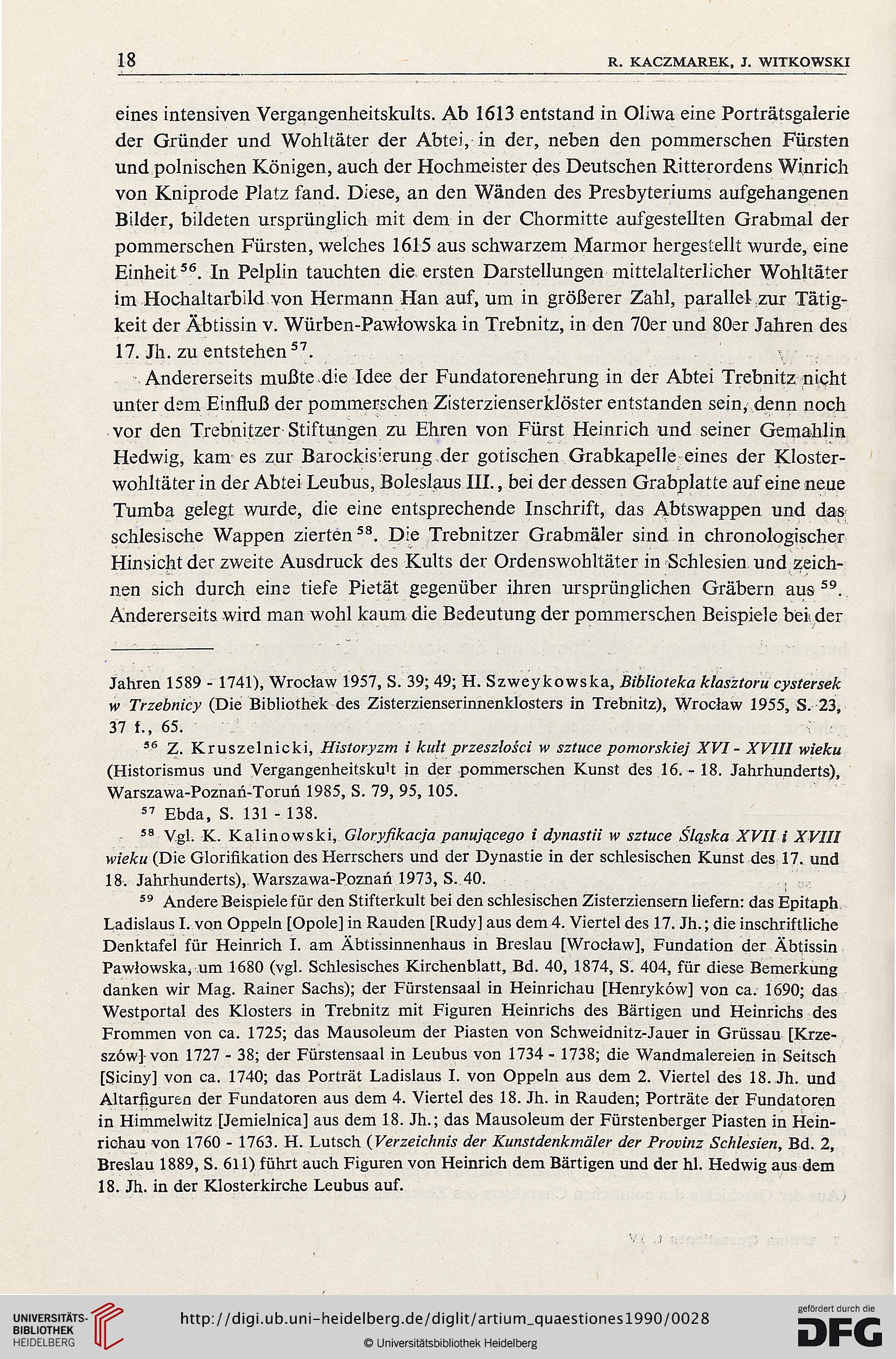18
R. KACZMAREK, J. WITKOWSKI
eines intensiven Vergangenheitskults. Ab 1613 entstand in Oliwa eine Portratsgalerie
der Griinder und Wohltater der Abtei, in der, neben den pommerschen Fiirsten
und polnischen Konigen, auch der Hochmeister des Deutschen Ritterordens Winrich
von Kniprode Platz fand. Diese, an den Wanden des Presbyteriums aufgehangenen
Bilder, bildeten urspriinglich mit dem in der Chormitte aufgestellten Grabmal der
pommerschen Fiirsten, welches 1615 aus schwarzem Marmor hergestellt wurde, eine
Einheit 56. In Pelplin tauchten die ersten Darstellungen mittelalterlicher Wohltater
im Hochaltarbild von Hermann Han auf, um in groBerer Zahl, parallel zur Tatig-
keit der Abtissin v. Wiirben-Pawłowska in Trebnitz, in den 70er und 80er Jahren des
17. Jh. zu entstehen 57.
Andererseits muBte die Idee der Fundatorenehrung in der Abtei Trebnitz nięht
unter dem EinfluB der pommerschen Zisterzienserkloster entstanden sein, denn noch
vor den Trebnitzer Stiftungen zu Ehren von Fiirst Heinrich und seiner Gemahlin
Hedwig, kam es zur Barockisierung der gotischen Grabkapelle eines der Kloster-
wohltater in der Abtei Leubus, Boleslaus III., bei der dessen Grabplatte auf eine neue
Tumba gelegt wurde, die eine entsprechende Inschrift, das Abtswappen und das
schlesische Wappen zierten 58. Die Trebnitzer Grabmaler sind in chronologischer
Hinsicht der zweite Ausdruck des Kults der Ordenswohltater in Schlesien und zeich-
nen sich durch eine tiefe Pietat gegeniiber ihren urspriinglichen Grabern aus S9.
Andererseits wird man wolil kaum die Bedeutung der pommerschen Beispiele bei der
Jahren 1589 - 1741), Wrocław 1957, S. 39; 49; H. Szweykowska, Biblioteka klasztoru cystersek
w Trzebnicy (Die Bibliothek des Zisterzienserinnenklosters in Trebnitz), Wrocław 1955, S. 23,
37 1., 65.
56 Z. Kruszełnicki, Historyzm i kult przeszłości w sztuce pomorskiej XVI- XVIII wieku
(Historismus und VergangenheitskuU in der pommerschen Kunst des 16. - 18. Jahrhunderts),
Warszawa-Poznań-Toruń 1985, S. 79, 95, 105.
57 Ebda, S. 131 - 138.
58 Vgl. K. Kalinowski, Gloryfikacja panującego i dynastii w sztuce Śląska XVII i XVIII
wieku (Die Glorifikation des Herrschers und der Dynastie in der schlesischen Kunst des 17. und
18. Jahrhunderts), Warszawa-Poznań 1973, S. 40.
59 Andere Beispielefiir den Stifterkult bei den schlesischen Zisterziensern liefern: das Epitaph
Ladislaus I. von Oppeln [Opole] in Rauden [Rudy] aus dem 4. Viertel des 17. Jh.; die inschriftliche
Denktafel fur Heinrich I. am Abtissinnenhaus in Breslau [Wrocław], Fundation der Abtissin
Pawłowska, um 1680 (vgl. Schlesisches Kirchenblatt, Bd. 40, 1874, S. 404, fur diese Bemerkung
danken wir Mag. Rainer Sachs); der Furstensaal in Heinrichau [Henryków] von ca. 1690; das
Westportal des Klosters in Trebnitz mit Figuren Heinrichs des Bartigen und Heinrichs des
Frommen von ca. 1725; das Mausoleum der Piasten von Schweidnitz-Jauer in Grussau [Krze-
szów] von 1727 - 38; der Furstensaal in Leubus von 1734 - 1738; die Wandmalereien in Seitsch
[Siciny] von ca. 1740; das Portriit Ladislaus I. von Oppeln aus dem 2. Viertel des 18. Jh. und
Altarfiguren der Fundatoren aus dem 4. Viertel des 18. Jh. in Rauden; Portrate der Fundatoren
in Himmelwitz [Jemielnica] aus dem 18. Jh.; das Mausoleum der Fiirstenberger Piasten in Hein-
richau von 1760 - 1763. H. Lutsch (Verzeichnis der Kunstdenkmdler der Provinz Schlesien, Bd. 2,
Breslau 1889, S. 611) fuhrt auch Figuren von Heinrich dem Bartigen und der hl. Hedwig aus dem
18. Jh. in der Klosterkirche Leubus auf.
R. KACZMAREK, J. WITKOWSKI
eines intensiven Vergangenheitskults. Ab 1613 entstand in Oliwa eine Portratsgalerie
der Griinder und Wohltater der Abtei, in der, neben den pommerschen Fiirsten
und polnischen Konigen, auch der Hochmeister des Deutschen Ritterordens Winrich
von Kniprode Platz fand. Diese, an den Wanden des Presbyteriums aufgehangenen
Bilder, bildeten urspriinglich mit dem in der Chormitte aufgestellten Grabmal der
pommerschen Fiirsten, welches 1615 aus schwarzem Marmor hergestellt wurde, eine
Einheit 56. In Pelplin tauchten die ersten Darstellungen mittelalterlicher Wohltater
im Hochaltarbild von Hermann Han auf, um in groBerer Zahl, parallel zur Tatig-
keit der Abtissin v. Wiirben-Pawłowska in Trebnitz, in den 70er und 80er Jahren des
17. Jh. zu entstehen 57.
Andererseits muBte die Idee der Fundatorenehrung in der Abtei Trebnitz nięht
unter dem EinfluB der pommerschen Zisterzienserkloster entstanden sein, denn noch
vor den Trebnitzer Stiftungen zu Ehren von Fiirst Heinrich und seiner Gemahlin
Hedwig, kam es zur Barockisierung der gotischen Grabkapelle eines der Kloster-
wohltater in der Abtei Leubus, Boleslaus III., bei der dessen Grabplatte auf eine neue
Tumba gelegt wurde, die eine entsprechende Inschrift, das Abtswappen und das
schlesische Wappen zierten 58. Die Trebnitzer Grabmaler sind in chronologischer
Hinsicht der zweite Ausdruck des Kults der Ordenswohltater in Schlesien und zeich-
nen sich durch eine tiefe Pietat gegeniiber ihren urspriinglichen Grabern aus S9.
Andererseits wird man wolil kaum die Bedeutung der pommerschen Beispiele bei der
Jahren 1589 - 1741), Wrocław 1957, S. 39; 49; H. Szweykowska, Biblioteka klasztoru cystersek
w Trzebnicy (Die Bibliothek des Zisterzienserinnenklosters in Trebnitz), Wrocław 1955, S. 23,
37 1., 65.
56 Z. Kruszełnicki, Historyzm i kult przeszłości w sztuce pomorskiej XVI- XVIII wieku
(Historismus und VergangenheitskuU in der pommerschen Kunst des 16. - 18. Jahrhunderts),
Warszawa-Poznań-Toruń 1985, S. 79, 95, 105.
57 Ebda, S. 131 - 138.
58 Vgl. K. Kalinowski, Gloryfikacja panującego i dynastii w sztuce Śląska XVII i XVIII
wieku (Die Glorifikation des Herrschers und der Dynastie in der schlesischen Kunst des 17. und
18. Jahrhunderts), Warszawa-Poznań 1973, S. 40.
59 Andere Beispielefiir den Stifterkult bei den schlesischen Zisterziensern liefern: das Epitaph
Ladislaus I. von Oppeln [Opole] in Rauden [Rudy] aus dem 4. Viertel des 17. Jh.; die inschriftliche
Denktafel fur Heinrich I. am Abtissinnenhaus in Breslau [Wrocław], Fundation der Abtissin
Pawłowska, um 1680 (vgl. Schlesisches Kirchenblatt, Bd. 40, 1874, S. 404, fur diese Bemerkung
danken wir Mag. Rainer Sachs); der Furstensaal in Heinrichau [Henryków] von ca. 1690; das
Westportal des Klosters in Trebnitz mit Figuren Heinrichs des Bartigen und Heinrichs des
Frommen von ca. 1725; das Mausoleum der Piasten von Schweidnitz-Jauer in Grussau [Krze-
szów] von 1727 - 38; der Furstensaal in Leubus von 1734 - 1738; die Wandmalereien in Seitsch
[Siciny] von ca. 1740; das Portriit Ladislaus I. von Oppeln aus dem 2. Viertel des 18. Jh. und
Altarfiguren der Fundatoren aus dem 4. Viertel des 18. Jh. in Rauden; Portrate der Fundatoren
in Himmelwitz [Jemielnica] aus dem 18. Jh.; das Mausoleum der Fiirstenberger Piasten in Hein-
richau von 1760 - 1763. H. Lutsch (Verzeichnis der Kunstdenkmdler der Provinz Schlesien, Bd. 2,
Breslau 1889, S. 611) fuhrt auch Figuren von Heinrich dem Bartigen und der hl. Hedwig aus dem
18. Jh. in der Klosterkirche Leubus auf.