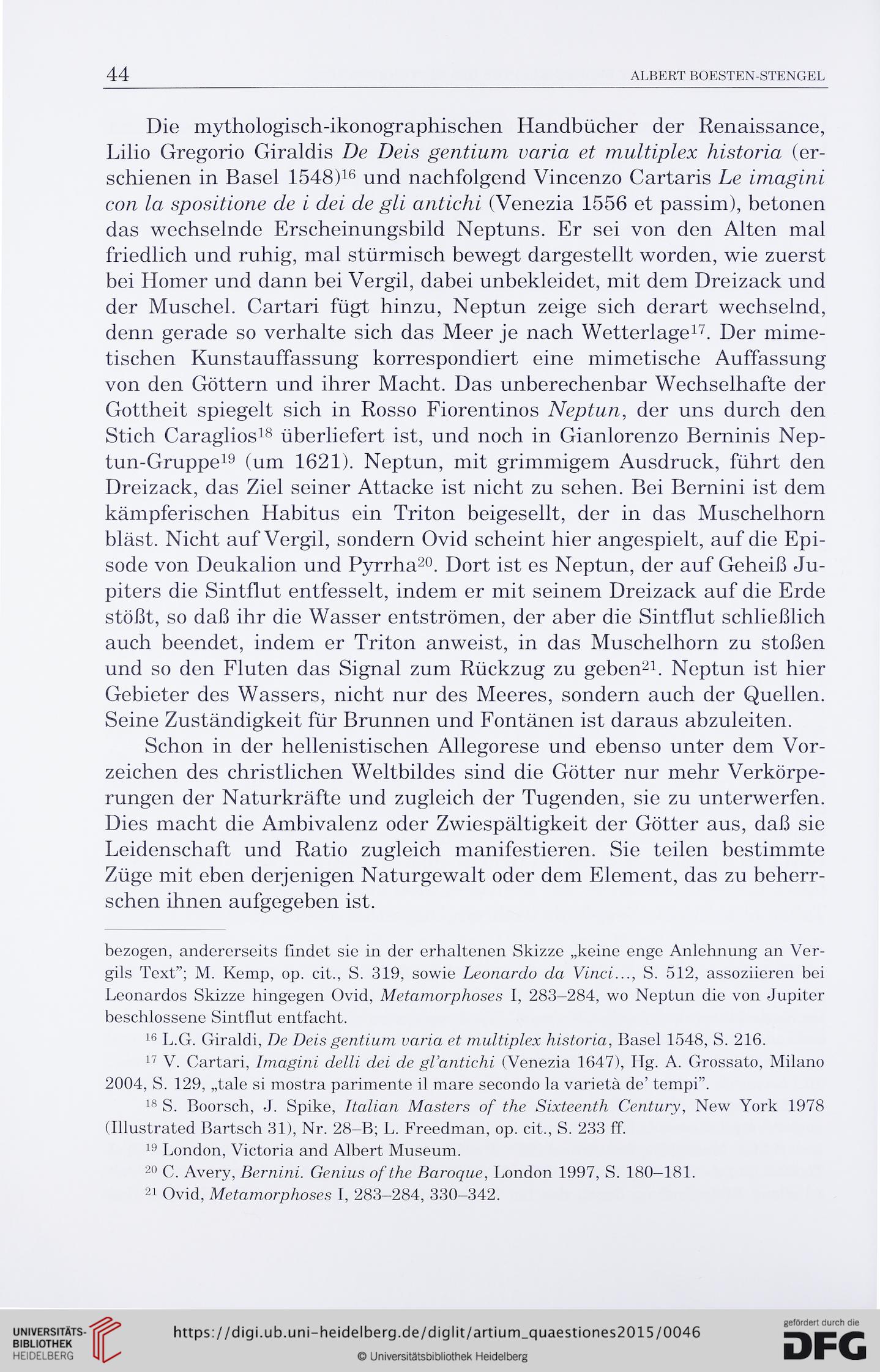44
ALBERT BOESTEN-STENGEL
Die mythologisch-ikonographischen Handbücher der Renaissance,
Lilio Gregorio Giraldis De Deis gentium varia et multiplex historia (er-
schienen in Basel 1548)16 und nachfolgend Vincenzo Cartaris Le imagini
con la spositione de i dei de gli antichi (Venezia 1556 et passim), betonen
das wechselnde Erscheinungsbild Neptuns. Er sei von den Alten mal
friedlich und ruhig, mal stürmisch bewegt dargestellt worden, wie zuerst
bei Homer und dann bei Vergil, dabei unbekleidet, mit dem Dreizack und
der Muschel. Cartari fügt hinzu, Neptun zeige sich derart wechselnd,
denn gerade so verhalte sich das Meer je nach Wetterlage17. Der mime-
tischen Kunstauffassung korrespondiert eine mimetische Auffassung
von den Göttern und ihrer Macht. Das unberechenbar Wechselhafte der
Gottheit spiegelt sich in Rosso Fiorentinos Neptun, der uns durch den
Stich Caraglios18 überliefert ist, und noch in Gianlorenzo Berninis Nep-
tun-Gruppe19 (um 1621). Neptun, mit grimmigem Ausdruck, führt den
Dreizack, das Ziel seiner Attacke ist nicht zu sehen. Bei Bernini ist dem
kämpferischen Habitus ein Triton beigesellt, der in das Muschelhorn
bläst. Nicht auf Vergil, sondern Ovid scheint hier angespielt, auf die Epi-
sode von Deukalion und Pyrrha20. Dort ist es Neptun, der auf Geheiß Ju-
piters die Sintflut entfesselt, indem er mit seinem Dreizack auf die Erde
stößt, so daß ihr die Wasser entströmen, der aber die Sintflut schließlich
auch beendet, indem er Triton anweist, in das Muschelhorn zu stoßen
und so den Fluten das Signal zum Rückzug zu geben21. Neptun ist hier
Gebieter des Wassers, nicht nur des Meeres, sondern auch der Quellen.
Seine Zuständigkeit für Brunnen und Fontänen ist daraus abzuleiten.
Schon in der hellenistischen Allegorese und ebenso unter dem Vor-
zeichen des christlichen Weltbildes sind die Götter nur mehr Verkörpe-
rungen der Naturkräfte und zugleich der Tugenden, sie zu unterwerfen.
Dies macht die Ambivalenz oder Zwiespältigkeit der Götter aus, daß sie
Leidenschaft und Ratio zugleich manifestieren. Sie teilen bestimmte
Züge mit eben derjenigen Naturgewalt oder dem Element, das zu beherr-
schen ihnen aufgegeben ist.
bezogen, andererseits findet sie in der erhaltenen Skizze „keine enge Anlehnung an Ver-
gils Text”; M. Kemp, op. cit., S. 319, sowie Leonardo da Vinci..., S. 512, assoziieren bei
Leonardos Skizze hingegen Ovid, Metamorphoses I, 283-284, wo Neptun die von Jupiter
beschlossene Sintflut entfacht.
16 L.G. Giraldi, De Deis gentium varia et multiplex historia, Basel 1548, S. 216.
17 V. Cartari, Imagini delli dei de gVantichi (Venezia 1647), Hg. A. Grossato, Milano
2004, S. 129, „tale si mostra parimente il mare secondo la varietà de’ tempi”.
18 S. Boorsch, J. Spike, Italian Masters of the Sixteenth Century, New York 1978
(Illustrated Bartsch 31), Nr. 28-B; L. Freedman, op. cit., S. 233 ff.
19 London, Victoria and Albert Museum.
20 C. Avery, Bernini. Genius of the Baroque, London 1997, S. 180-181.
21 Ovid, Metamorphoses I, 283-284, 330-342.
ALBERT BOESTEN-STENGEL
Die mythologisch-ikonographischen Handbücher der Renaissance,
Lilio Gregorio Giraldis De Deis gentium varia et multiplex historia (er-
schienen in Basel 1548)16 und nachfolgend Vincenzo Cartaris Le imagini
con la spositione de i dei de gli antichi (Venezia 1556 et passim), betonen
das wechselnde Erscheinungsbild Neptuns. Er sei von den Alten mal
friedlich und ruhig, mal stürmisch bewegt dargestellt worden, wie zuerst
bei Homer und dann bei Vergil, dabei unbekleidet, mit dem Dreizack und
der Muschel. Cartari fügt hinzu, Neptun zeige sich derart wechselnd,
denn gerade so verhalte sich das Meer je nach Wetterlage17. Der mime-
tischen Kunstauffassung korrespondiert eine mimetische Auffassung
von den Göttern und ihrer Macht. Das unberechenbar Wechselhafte der
Gottheit spiegelt sich in Rosso Fiorentinos Neptun, der uns durch den
Stich Caraglios18 überliefert ist, und noch in Gianlorenzo Berninis Nep-
tun-Gruppe19 (um 1621). Neptun, mit grimmigem Ausdruck, führt den
Dreizack, das Ziel seiner Attacke ist nicht zu sehen. Bei Bernini ist dem
kämpferischen Habitus ein Triton beigesellt, der in das Muschelhorn
bläst. Nicht auf Vergil, sondern Ovid scheint hier angespielt, auf die Epi-
sode von Deukalion und Pyrrha20. Dort ist es Neptun, der auf Geheiß Ju-
piters die Sintflut entfesselt, indem er mit seinem Dreizack auf die Erde
stößt, so daß ihr die Wasser entströmen, der aber die Sintflut schließlich
auch beendet, indem er Triton anweist, in das Muschelhorn zu stoßen
und so den Fluten das Signal zum Rückzug zu geben21. Neptun ist hier
Gebieter des Wassers, nicht nur des Meeres, sondern auch der Quellen.
Seine Zuständigkeit für Brunnen und Fontänen ist daraus abzuleiten.
Schon in der hellenistischen Allegorese und ebenso unter dem Vor-
zeichen des christlichen Weltbildes sind die Götter nur mehr Verkörpe-
rungen der Naturkräfte und zugleich der Tugenden, sie zu unterwerfen.
Dies macht die Ambivalenz oder Zwiespältigkeit der Götter aus, daß sie
Leidenschaft und Ratio zugleich manifestieren. Sie teilen bestimmte
Züge mit eben derjenigen Naturgewalt oder dem Element, das zu beherr-
schen ihnen aufgegeben ist.
bezogen, andererseits findet sie in der erhaltenen Skizze „keine enge Anlehnung an Ver-
gils Text”; M. Kemp, op. cit., S. 319, sowie Leonardo da Vinci..., S. 512, assoziieren bei
Leonardos Skizze hingegen Ovid, Metamorphoses I, 283-284, wo Neptun die von Jupiter
beschlossene Sintflut entfacht.
16 L.G. Giraldi, De Deis gentium varia et multiplex historia, Basel 1548, S. 216.
17 V. Cartari, Imagini delli dei de gVantichi (Venezia 1647), Hg. A. Grossato, Milano
2004, S. 129, „tale si mostra parimente il mare secondo la varietà de’ tempi”.
18 S. Boorsch, J. Spike, Italian Masters of the Sixteenth Century, New York 1978
(Illustrated Bartsch 31), Nr. 28-B; L. Freedman, op. cit., S. 233 ff.
19 London, Victoria and Albert Museum.
20 C. Avery, Bernini. Genius of the Baroque, London 1997, S. 180-181.
21 Ovid, Metamorphoses I, 283-284, 330-342.