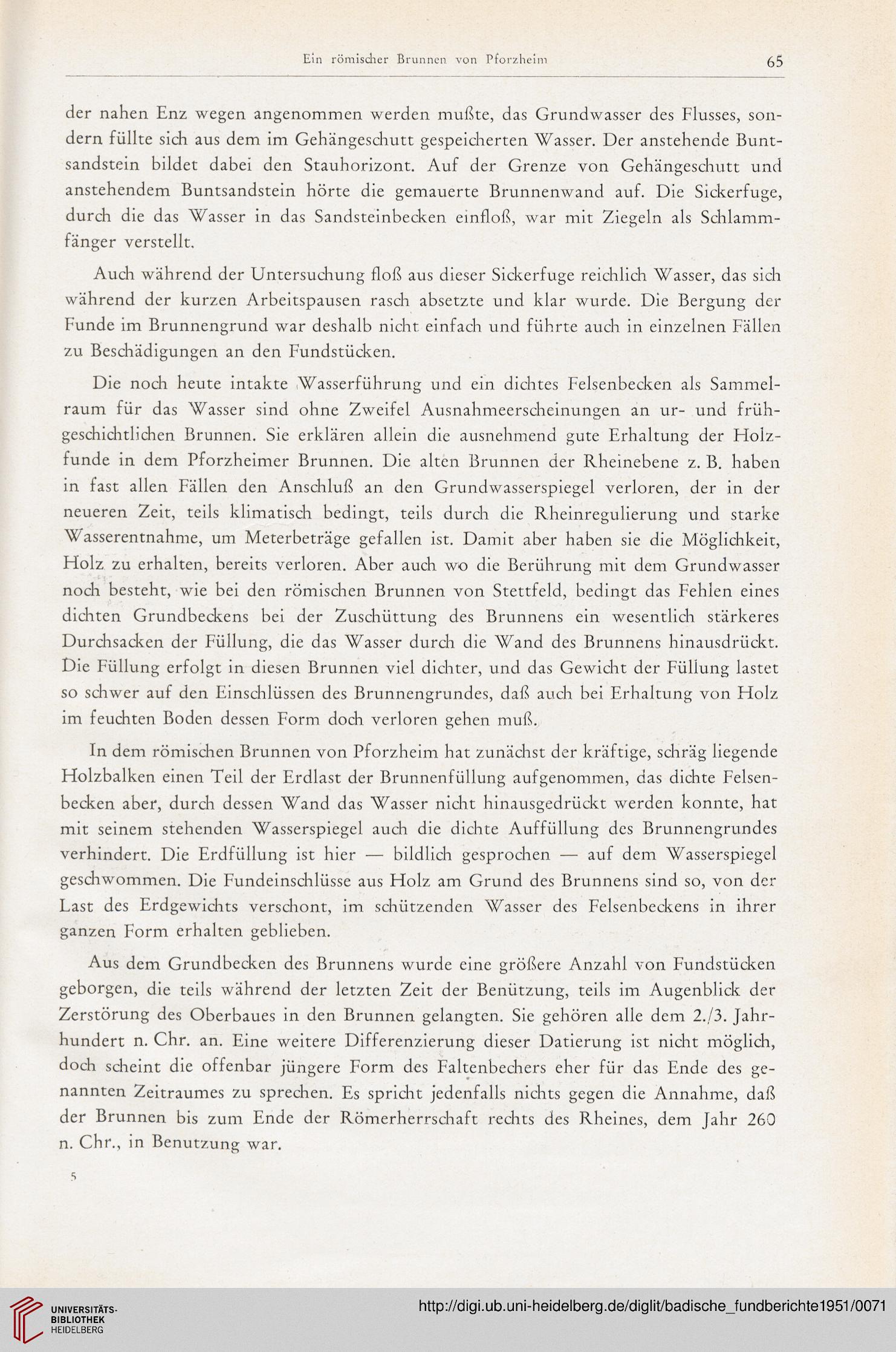65
Ein römischer Brunnen von Pforzheim
der nahen Enz wegen angenommen werden mußte, das Grundwasser des Flusses, son-
dern füllte sich aus dem im Gehängeschutt gespeicherten Wasser. Der anstehende Bunt-
sandstein bildet dabei den Stauhorizont. Auf der Grenze von Gehängeschutt und
anstehendem Buntsandstein hörte die gemauerte Brunnenwand auf. Die Sickerfuge,
durch die das Wasser in das Sandsteinbecken einfloß, war mit Ziegeln als Schlamm-
fänger verstellt.
Auch während der Untersuchung floß aus dieser Sickerfuge reichlich Wasser, das sich
während der kurzen Arbeitspausen rasch absetzte und klar wurde. Die Bergung der
Funde im Brunnengrund war deshalb nicht einfach und führte auch in einzelnen Fällen
zu Beschädigungen an den Fundstücken.
Die noch heute intakte Wasserführung und ein dichtes Felsenbecken als Sammel-
raum für das Wasser sind ohne Zweifel Ausnahmeerscheinungen an ur- und früh-
geschichtlichen Brunnen. Sie erklären allein die ausnehmend gute Erhaltung der Holz-
funde in dem Pforzheimer Brunnen. Die alten Brunnen der Rheinebene z. B. haben
in fast allen Fällen den Anschluß an den Grundwasserspiegel verloren, der in der
neueren Zeit, teils klimatisch bedingt, teils durch die Rheinregulierung und starke
W asserentnahme, um Meterbeträge gefallen ist. Damit aber haben sie die Möglichkeit,
Holz zu erhalten, bereits verloren. Aber auch wo die Berührung mit dem Grundwasser
noch besteht, wie bei den römischen Brunnen von Stettfeld, bedingt das Fehlen eines
dichten Grundbeckens bei der Zuschüttung des Brunnens ein wesentlich stärkeres
Durchsacken der Füllung, die das Wasser durch die Wand des Brunnens hinausdrückt.
Die Füllung erfolgt in diesen Brunnen viel dichter, und das Gewicht der Füllung lastet
so schwer auf den Einschlüssen des Brunnengrundes, daß auch bei Erhaltung von Holz
im feuchten Boden dessen Form doch verloren gehen muß.
In dem römischen Brunnen von Pforzheim hat zunächst der kräftige, schräg liegende
Holzbalken einen Teil der Erdlast der Brunnenfüllung aufgenommen, das dichte Felsen-
becken aber, durch dessen Wand das Wasser nicht hinausgedrückt werden konnte, hat
mit seinem stehenden Wasserspiegel auch die dichte Auffüllung des Brunnengrundes
verhindert. Die Erdfüllung ist hier ■— bildlich gesprochen — auf dem Wasserspiegel
geschwommen. Die Fundeinschlüsse aus Holz am Grund des Brunnens sind so, von der
Last des Erdgewichts verschont, im schützenden Wasser des Felsenbeckens in ihrer
ganzen Form erhalten geblieben.
Aus dem Grundbecken des Brunnens wurde eine größere Anzahl von Fundstücken
geborgen, die teils während der letzten Zeit der Benützung, teils im Augenblick der
Zerstörung des Oberbaues in den Brunnen gelangten. Sie gehören alle dem 2./3. Jahr-
hundert n. Chr. an. Eine weitere Differenzierung dieser Datierung ist nicht möglich,
doch scheint die offenbar jüngere Form des Faltenbechers eher für das Ende des ge-
nannten Zeitraumes zu sprechen. Es spricht jedenfalls nichts gegen die Annahme, daß
der Brunnen bis zum Ende der Römerherrschaft rechts des Rheines, dem Jahr 260
n. Chr., in Benutzung war.
5
Ein römischer Brunnen von Pforzheim
der nahen Enz wegen angenommen werden mußte, das Grundwasser des Flusses, son-
dern füllte sich aus dem im Gehängeschutt gespeicherten Wasser. Der anstehende Bunt-
sandstein bildet dabei den Stauhorizont. Auf der Grenze von Gehängeschutt und
anstehendem Buntsandstein hörte die gemauerte Brunnenwand auf. Die Sickerfuge,
durch die das Wasser in das Sandsteinbecken einfloß, war mit Ziegeln als Schlamm-
fänger verstellt.
Auch während der Untersuchung floß aus dieser Sickerfuge reichlich Wasser, das sich
während der kurzen Arbeitspausen rasch absetzte und klar wurde. Die Bergung der
Funde im Brunnengrund war deshalb nicht einfach und führte auch in einzelnen Fällen
zu Beschädigungen an den Fundstücken.
Die noch heute intakte Wasserführung und ein dichtes Felsenbecken als Sammel-
raum für das Wasser sind ohne Zweifel Ausnahmeerscheinungen an ur- und früh-
geschichtlichen Brunnen. Sie erklären allein die ausnehmend gute Erhaltung der Holz-
funde in dem Pforzheimer Brunnen. Die alten Brunnen der Rheinebene z. B. haben
in fast allen Fällen den Anschluß an den Grundwasserspiegel verloren, der in der
neueren Zeit, teils klimatisch bedingt, teils durch die Rheinregulierung und starke
W asserentnahme, um Meterbeträge gefallen ist. Damit aber haben sie die Möglichkeit,
Holz zu erhalten, bereits verloren. Aber auch wo die Berührung mit dem Grundwasser
noch besteht, wie bei den römischen Brunnen von Stettfeld, bedingt das Fehlen eines
dichten Grundbeckens bei der Zuschüttung des Brunnens ein wesentlich stärkeres
Durchsacken der Füllung, die das Wasser durch die Wand des Brunnens hinausdrückt.
Die Füllung erfolgt in diesen Brunnen viel dichter, und das Gewicht der Füllung lastet
so schwer auf den Einschlüssen des Brunnengrundes, daß auch bei Erhaltung von Holz
im feuchten Boden dessen Form doch verloren gehen muß.
In dem römischen Brunnen von Pforzheim hat zunächst der kräftige, schräg liegende
Holzbalken einen Teil der Erdlast der Brunnenfüllung aufgenommen, das dichte Felsen-
becken aber, durch dessen Wand das Wasser nicht hinausgedrückt werden konnte, hat
mit seinem stehenden Wasserspiegel auch die dichte Auffüllung des Brunnengrundes
verhindert. Die Erdfüllung ist hier ■— bildlich gesprochen — auf dem Wasserspiegel
geschwommen. Die Fundeinschlüsse aus Holz am Grund des Brunnens sind so, von der
Last des Erdgewichts verschont, im schützenden Wasser des Felsenbeckens in ihrer
ganzen Form erhalten geblieben.
Aus dem Grundbecken des Brunnens wurde eine größere Anzahl von Fundstücken
geborgen, die teils während der letzten Zeit der Benützung, teils im Augenblick der
Zerstörung des Oberbaues in den Brunnen gelangten. Sie gehören alle dem 2./3. Jahr-
hundert n. Chr. an. Eine weitere Differenzierung dieser Datierung ist nicht möglich,
doch scheint die offenbar jüngere Form des Faltenbechers eher für das Ende des ge-
nannten Zeitraumes zu sprechen. Es spricht jedenfalls nichts gegen die Annahme, daß
der Brunnen bis zum Ende der Römerherrschaft rechts des Rheines, dem Jahr 260
n. Chr., in Benutzung war.
5