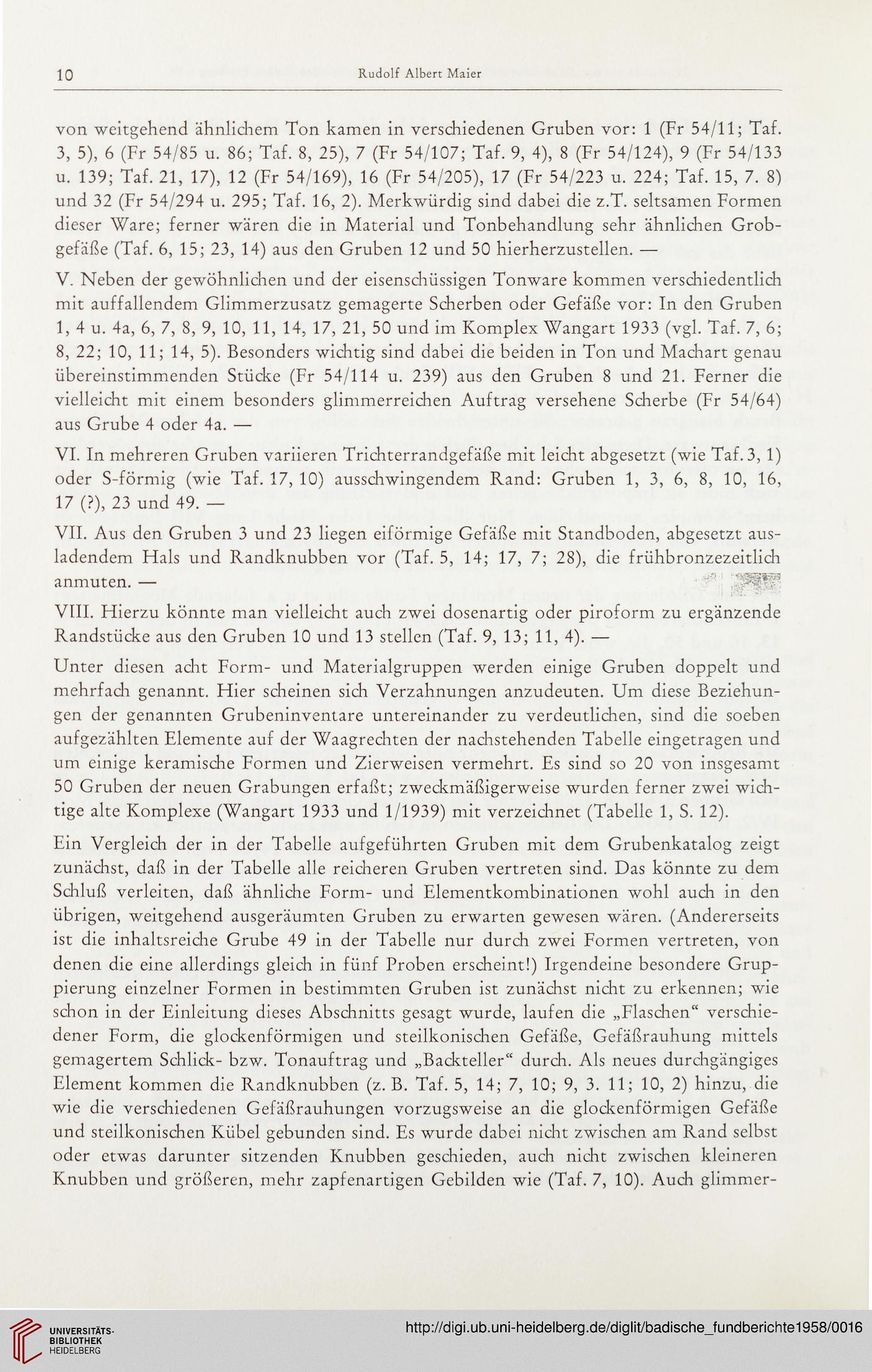10
Rudolf Albert Maier
von weitgehend ähnlichem Ton kamen in verschiedenen Gruben vor: 1 (Fr 54/11; Taf.
з, 5), 6 (Fr 54/85 u. 86; Taf. 8, 25), 7 (Fr 54/107; Taf. 9, 4), 8 (Fr 54/124), 9 (Fr 54/133
и. 139; Taf. 21, 17), 12 (Fr 54/169), 16 (Fr 54/205), 17 (Fr 54/223 u. 224; Taf. 15, 7. 8)
und 32 (Fr 54/294 u. 295; Taf. 16, 2). Merkwürdig sind dabei die z.T. seltsamen Formen
dieser Ware; ferner wären die in Material und Tonbehandlung sehr ähnlichen Grob-
gefäße (Taf. 6, 15; 23, 14) aus den Gruben 12 und 50 hierherzustellen. —
V. Neben der gewöhnlichen und der eisenschüssigen Tonware kommen verschiedentlich
mit auffallendem Glimmerzusatz gemagerte Scherben oder Gefäße vor: In den Gruben
1, 4 u. 4a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 21, 50 und im Komplex Wangart 1933 (vgl. Taf. 7, 6;
8, 22; 10, 11; 14, 5). Besonders wichtig sind dabei die beiden in Ton und Machart genau
übereinstimmenden Stücke (Fr 54/114 u. 239) aus den Gruben 8 und 21. Ferner die
vielleicht mit einem besonders glimmerreichen Auftrag versehene Scherbe (Fr 54/64)
aus Grube 4 oder 4a. —
VI. In mehreren Gruben variieren Trichterrandgefäße mit leicht abgesetzt (wie Taf. 3, 1)
oder S-förmig (wie Taf. 17, 10) ausschwingendem Rand: Gruben 1, 3, 6, 8, 10, 16,
17 (?), 23 und 49. —
VII. Aus den Gruben 3 und 23 liegen eiförmige Gefäße mit Standboden, abgesetzt aus-
ladendem Hals und Randknubben vor (Taf. 5, 14; 17, 7; 28), die frühbronzezeitlich
anmuten. —
VIII. Hierzu könnte man vielleicht auch zwei dosenartig oder piroform zu ergänzende
Randstücke aus den Gruben 10 und 13 stellen (Taf. 9, 13; 11, 4). —
Unter diesen acht Form- und Materialgruppen werden einige Gruben doppelt und
mehrfach genannt. Hier scheinen sich Verzahnungen anzudeuten. Um diese Beziehun-
gen der genannten Grubeninventare untereinander zu verdeutlichen, sind die soeben
aufgezählten Elemente auf der Waagrechten der nachstehenden Tabelle eingetragen und
um einige keramische Formen und Zierweisen vermehrt. Es sind so 20 von insgesamt
50 Gruben der neuen Grabungen erfaßt; zweckmäßigerweise wurden ferner zwei wich-
tige alte Komplexe (Wangart 1933 und 1/1939) mit verzeichnet (Tabelle 1, S. 12).
Ein Vergleich der in der Tabelle aufgeführten Gruben mit dem Grubenkatalog zeigt
zunächst, daß in der Tabelle alle reicheren Gruben vertreten sind. Das könnte zu dem
Schluß verleiten, daß ähnliche Form- und Elementkombinationen wohl auch in den
übrigen, weitgehend ausgeräumten Gruben zu erwarten gewesen wären. (Andererseits
ist die inhaltsreiche Grube 49 in der Tabelle nur durch zwei Formen vertreten, von
denen die eine allerdings gleich in fünf Proben erscheint!) Irgendeine besondere Grup-
pierung einzelner Formen in bestimmten Gruben ist zunächst nicht zu erkennen; wie
schon in der Einleitung dieses Abschnitts gesagt wurde, laufen die „Flaschen“ verschie-
dener Form, die glockenförmigen und steilkonischen Gefäße, Gefäßrauhung mittels
gemagertem Schlick- bzw. Tonauftrag und „Backteller“ durch. Als neues durchgängiges
Element kommen die Randknubben (z. B. Taf. 5, 14; 7, 10; 9, 3. 11; 10, 2) hinzu, die
wie die verschiedenen Gefäßrauhungen vorzugsweise an die glockenförmigen Gefäße
und steilkonischen Kübel gebunden sind. Es wurde dabei nicht zwischen am Rand selbst
oder etwas darunter sitzenden Knubben geschieden, auch nicht zwischen kleineren
Knubben und größeren, mehr zapfenartigen Gebilden wie (Taf. 7, 10). Auch glimmer-
Rudolf Albert Maier
von weitgehend ähnlichem Ton kamen in verschiedenen Gruben vor: 1 (Fr 54/11; Taf.
з, 5), 6 (Fr 54/85 u. 86; Taf. 8, 25), 7 (Fr 54/107; Taf. 9, 4), 8 (Fr 54/124), 9 (Fr 54/133
и. 139; Taf. 21, 17), 12 (Fr 54/169), 16 (Fr 54/205), 17 (Fr 54/223 u. 224; Taf. 15, 7. 8)
und 32 (Fr 54/294 u. 295; Taf. 16, 2). Merkwürdig sind dabei die z.T. seltsamen Formen
dieser Ware; ferner wären die in Material und Tonbehandlung sehr ähnlichen Grob-
gefäße (Taf. 6, 15; 23, 14) aus den Gruben 12 und 50 hierherzustellen. —
V. Neben der gewöhnlichen und der eisenschüssigen Tonware kommen verschiedentlich
mit auffallendem Glimmerzusatz gemagerte Scherben oder Gefäße vor: In den Gruben
1, 4 u. 4a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 21, 50 und im Komplex Wangart 1933 (vgl. Taf. 7, 6;
8, 22; 10, 11; 14, 5). Besonders wichtig sind dabei die beiden in Ton und Machart genau
übereinstimmenden Stücke (Fr 54/114 u. 239) aus den Gruben 8 und 21. Ferner die
vielleicht mit einem besonders glimmerreichen Auftrag versehene Scherbe (Fr 54/64)
aus Grube 4 oder 4a. —
VI. In mehreren Gruben variieren Trichterrandgefäße mit leicht abgesetzt (wie Taf. 3, 1)
oder S-förmig (wie Taf. 17, 10) ausschwingendem Rand: Gruben 1, 3, 6, 8, 10, 16,
17 (?), 23 und 49. —
VII. Aus den Gruben 3 und 23 liegen eiförmige Gefäße mit Standboden, abgesetzt aus-
ladendem Hals und Randknubben vor (Taf. 5, 14; 17, 7; 28), die frühbronzezeitlich
anmuten. —
VIII. Hierzu könnte man vielleicht auch zwei dosenartig oder piroform zu ergänzende
Randstücke aus den Gruben 10 und 13 stellen (Taf. 9, 13; 11, 4). —
Unter diesen acht Form- und Materialgruppen werden einige Gruben doppelt und
mehrfach genannt. Hier scheinen sich Verzahnungen anzudeuten. Um diese Beziehun-
gen der genannten Grubeninventare untereinander zu verdeutlichen, sind die soeben
aufgezählten Elemente auf der Waagrechten der nachstehenden Tabelle eingetragen und
um einige keramische Formen und Zierweisen vermehrt. Es sind so 20 von insgesamt
50 Gruben der neuen Grabungen erfaßt; zweckmäßigerweise wurden ferner zwei wich-
tige alte Komplexe (Wangart 1933 und 1/1939) mit verzeichnet (Tabelle 1, S. 12).
Ein Vergleich der in der Tabelle aufgeführten Gruben mit dem Grubenkatalog zeigt
zunächst, daß in der Tabelle alle reicheren Gruben vertreten sind. Das könnte zu dem
Schluß verleiten, daß ähnliche Form- und Elementkombinationen wohl auch in den
übrigen, weitgehend ausgeräumten Gruben zu erwarten gewesen wären. (Andererseits
ist die inhaltsreiche Grube 49 in der Tabelle nur durch zwei Formen vertreten, von
denen die eine allerdings gleich in fünf Proben erscheint!) Irgendeine besondere Grup-
pierung einzelner Formen in bestimmten Gruben ist zunächst nicht zu erkennen; wie
schon in der Einleitung dieses Abschnitts gesagt wurde, laufen die „Flaschen“ verschie-
dener Form, die glockenförmigen und steilkonischen Gefäße, Gefäßrauhung mittels
gemagertem Schlick- bzw. Tonauftrag und „Backteller“ durch. Als neues durchgängiges
Element kommen die Randknubben (z. B. Taf. 5, 14; 7, 10; 9, 3. 11; 10, 2) hinzu, die
wie die verschiedenen Gefäßrauhungen vorzugsweise an die glockenförmigen Gefäße
und steilkonischen Kübel gebunden sind. Es wurde dabei nicht zwischen am Rand selbst
oder etwas darunter sitzenden Knubben geschieden, auch nicht zwischen kleineren
Knubben und größeren, mehr zapfenartigen Gebilden wie (Taf. 7, 10). Auch glimmer-