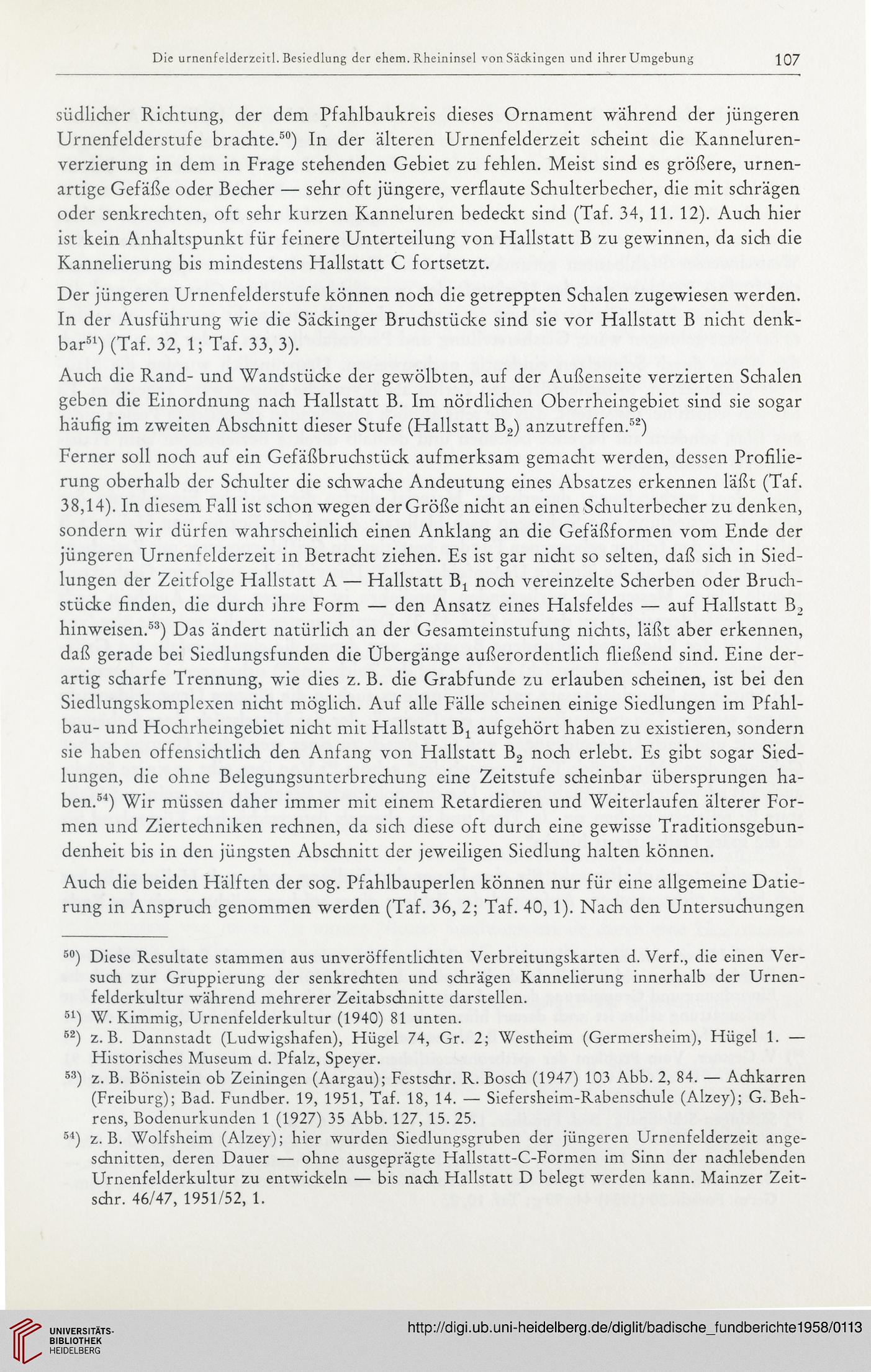Die urnenfelderzeitl. Besiedlung der ehern. Rheininsel vonSäckingen und ihrer Umgebung
107
südlicher Richtung, der dem Pfahlbaukreis dieses Ornament während der jüngeren
Urnenfelderstufe brachte.50) In der älteren Urnenfelderzeit scheint die Kanneluren-
verzierung in dem in Frage stehenden Gebiet zu fehlen. Meist sind es größere, urnen-
artige Gefäße oder Becher — sehr oft jüngere, verflaute Schulterbecher, die mit schrägen
oder senkrechten, oft sehr kurzen Kanneluren bedeckt sind (Taf. 34, 11. 12). Auch hier
ist kein Anhaltspunkt für feinere Unterteilung von Hallstatt B zu gewinnen, da sich die
Kannelierung bis mindestens Hallstatt C fortsetzt.
Der jüngeren Urnenfelderstufe können noch die getreppten Schalen zugewiesen werden.
In der Ausführung wie die Säckinger Bruchstücke sind sie vor Hallstatt B nicht denk-
bar51) (Taf. 32, 1; Taf. 33, 3).
Auch die Rand- und Wandstücke der gewölbten, auf der Außenseite verzierten Schalen
geben die Einordnung nach Hallstatt B. Im nördlichen Oberrheingebiet sind sie sogar
häufig im zweiten Abschnitt dieser Stufe (Hallstatt B2) anzutreffen.52)
Ferner soll noch auf ein Gefäßbruchstück aufmerksam gemacht werden, dessen Profilie-
rung oberhalb der Schulter die schwache Andeutung eines Absatzes erkennen läßt (Taf.
38,14). In diesem Fall ist schon wegen der Größe nicht an einen Schulterbecher zu denken,
sondern wir dürfen wahrscheinlich einen Anklang an die Gefäßformen vom Ende der
jüngeren Urnenfelderzeit in Betracht ziehen. Es ist gar nicht so selten, daß sich in Sied-
lungen der Zeitfolge Hallstatt A — Hallstatt Bj noch vereinzelte Scherben oder Bruch-
stücke finden, die durch ihre Form — den Ansatz eines Halsfeldes — auf Hallstatt B,
hinweisen.53) Das ändert natürlich an der Gesamteinstufung nichts, läßt aber erkennen,
daß gerade bei Siedlungsfunden die Übergänge außerordentlich fließend sind. Eine der-
artig scharfe Trennung, wie dies z. B. die Grabfunde zu erlauben scheinen, ist bei den
Siedlungskomplexen nicht möglich. Auf alle Fälle scheinen einige Siedlungen im Pfahl-
bau- und Hochrheingebiet nicht mit Hallstatt Bt aufgehört haben zu existieren, sondern
sie haben offensichtlich den Anfang von Hallstatt B2 noch erlebt. Es gibt sogar Sied-
lungen, die ohne Belegungsunterbrechung eine Zeitstufe scheinbar übersprungen ha-
ben.54) Wir müssen daher immer mit einem Retardieren und Weiterlaufen älterer For-
men und Ziertechniken rechnen, da sich diese oft durch eine gewisse Traditionsgebun-
denheit bis in den jüngsten Abschnitt der jeweiligen Siedlung halten können.
Auch die beiden Hälften der sog. Pfahlbauperlen können nur für eine allgemeine Datie-
rung in Anspruch genommen werden (Taf. 36, 2; Taf. 40, 1). Nach den Untersuchungen
50) Diese Resultate stammen aus unveröffentlichten Verbreitungskarten d. Verf., die einen Ver-
such zur Gruppierung der senkrechten und schrägen Kannelierung innerhalb der Urnen-
felderkultur während mehrerer Zeitabschnitte darstellen.
51) W. Kimmig, Urnenfelderkultur (1940) 81 unten.
52) z. B. Dannstadt (Ludwigshafen), Hügel 74, Gr. 2; Westheim (Germersheim), Hügel 1. —
Historisches Museum d. Pfalz, Speyer.
53) z. B. Bönistein ob Zeiningen (Aargau); Festschr. R. Bosch (1947) 103 Abb. 2, 84. — Achkarren
(Freiburg); Bad. Fundber. 19, 1951, Taf. 18, 14. — Siefersheim-Rabenschule (Alzey); G. Beh-
rens, Bodenurkunden 1 (1927) 35 Abb. 127, 15. 25.
54) z. B. Wolfsheim (Alzey); hier wurden Siedlungsgruben der jüngeren Urnenfelderzeit ange-
schnitten, deren Dauer — ohne ausgeprägte Hallstatt-C-Formen im Sinn der nachlebenden
Urnenfelderkultur zu entwickeln — bis nach Hallstatt D belegt werden kann. Mainzer Zeit-
schr. 46/47, 1951/52, 1.
107
südlicher Richtung, der dem Pfahlbaukreis dieses Ornament während der jüngeren
Urnenfelderstufe brachte.50) In der älteren Urnenfelderzeit scheint die Kanneluren-
verzierung in dem in Frage stehenden Gebiet zu fehlen. Meist sind es größere, urnen-
artige Gefäße oder Becher — sehr oft jüngere, verflaute Schulterbecher, die mit schrägen
oder senkrechten, oft sehr kurzen Kanneluren bedeckt sind (Taf. 34, 11. 12). Auch hier
ist kein Anhaltspunkt für feinere Unterteilung von Hallstatt B zu gewinnen, da sich die
Kannelierung bis mindestens Hallstatt C fortsetzt.
Der jüngeren Urnenfelderstufe können noch die getreppten Schalen zugewiesen werden.
In der Ausführung wie die Säckinger Bruchstücke sind sie vor Hallstatt B nicht denk-
bar51) (Taf. 32, 1; Taf. 33, 3).
Auch die Rand- und Wandstücke der gewölbten, auf der Außenseite verzierten Schalen
geben die Einordnung nach Hallstatt B. Im nördlichen Oberrheingebiet sind sie sogar
häufig im zweiten Abschnitt dieser Stufe (Hallstatt B2) anzutreffen.52)
Ferner soll noch auf ein Gefäßbruchstück aufmerksam gemacht werden, dessen Profilie-
rung oberhalb der Schulter die schwache Andeutung eines Absatzes erkennen läßt (Taf.
38,14). In diesem Fall ist schon wegen der Größe nicht an einen Schulterbecher zu denken,
sondern wir dürfen wahrscheinlich einen Anklang an die Gefäßformen vom Ende der
jüngeren Urnenfelderzeit in Betracht ziehen. Es ist gar nicht so selten, daß sich in Sied-
lungen der Zeitfolge Hallstatt A — Hallstatt Bj noch vereinzelte Scherben oder Bruch-
stücke finden, die durch ihre Form — den Ansatz eines Halsfeldes — auf Hallstatt B,
hinweisen.53) Das ändert natürlich an der Gesamteinstufung nichts, läßt aber erkennen,
daß gerade bei Siedlungsfunden die Übergänge außerordentlich fließend sind. Eine der-
artig scharfe Trennung, wie dies z. B. die Grabfunde zu erlauben scheinen, ist bei den
Siedlungskomplexen nicht möglich. Auf alle Fälle scheinen einige Siedlungen im Pfahl-
bau- und Hochrheingebiet nicht mit Hallstatt Bt aufgehört haben zu existieren, sondern
sie haben offensichtlich den Anfang von Hallstatt B2 noch erlebt. Es gibt sogar Sied-
lungen, die ohne Belegungsunterbrechung eine Zeitstufe scheinbar übersprungen ha-
ben.54) Wir müssen daher immer mit einem Retardieren und Weiterlaufen älterer For-
men und Ziertechniken rechnen, da sich diese oft durch eine gewisse Traditionsgebun-
denheit bis in den jüngsten Abschnitt der jeweiligen Siedlung halten können.
Auch die beiden Hälften der sog. Pfahlbauperlen können nur für eine allgemeine Datie-
rung in Anspruch genommen werden (Taf. 36, 2; Taf. 40, 1). Nach den Untersuchungen
50) Diese Resultate stammen aus unveröffentlichten Verbreitungskarten d. Verf., die einen Ver-
such zur Gruppierung der senkrechten und schrägen Kannelierung innerhalb der Urnen-
felderkultur während mehrerer Zeitabschnitte darstellen.
51) W. Kimmig, Urnenfelderkultur (1940) 81 unten.
52) z. B. Dannstadt (Ludwigshafen), Hügel 74, Gr. 2; Westheim (Germersheim), Hügel 1. —
Historisches Museum d. Pfalz, Speyer.
53) z. B. Bönistein ob Zeiningen (Aargau); Festschr. R. Bosch (1947) 103 Abb. 2, 84. — Achkarren
(Freiburg); Bad. Fundber. 19, 1951, Taf. 18, 14. — Siefersheim-Rabenschule (Alzey); G. Beh-
rens, Bodenurkunden 1 (1927) 35 Abb. 127, 15. 25.
54) z. B. Wolfsheim (Alzey); hier wurden Siedlungsgruben der jüngeren Urnenfelderzeit ange-
schnitten, deren Dauer — ohne ausgeprägte Hallstatt-C-Formen im Sinn der nachlebenden
Urnenfelderkultur zu entwickeln — bis nach Hallstatt D belegt werden kann. Mainzer Zeit-
schr. 46/47, 1951/52, 1.