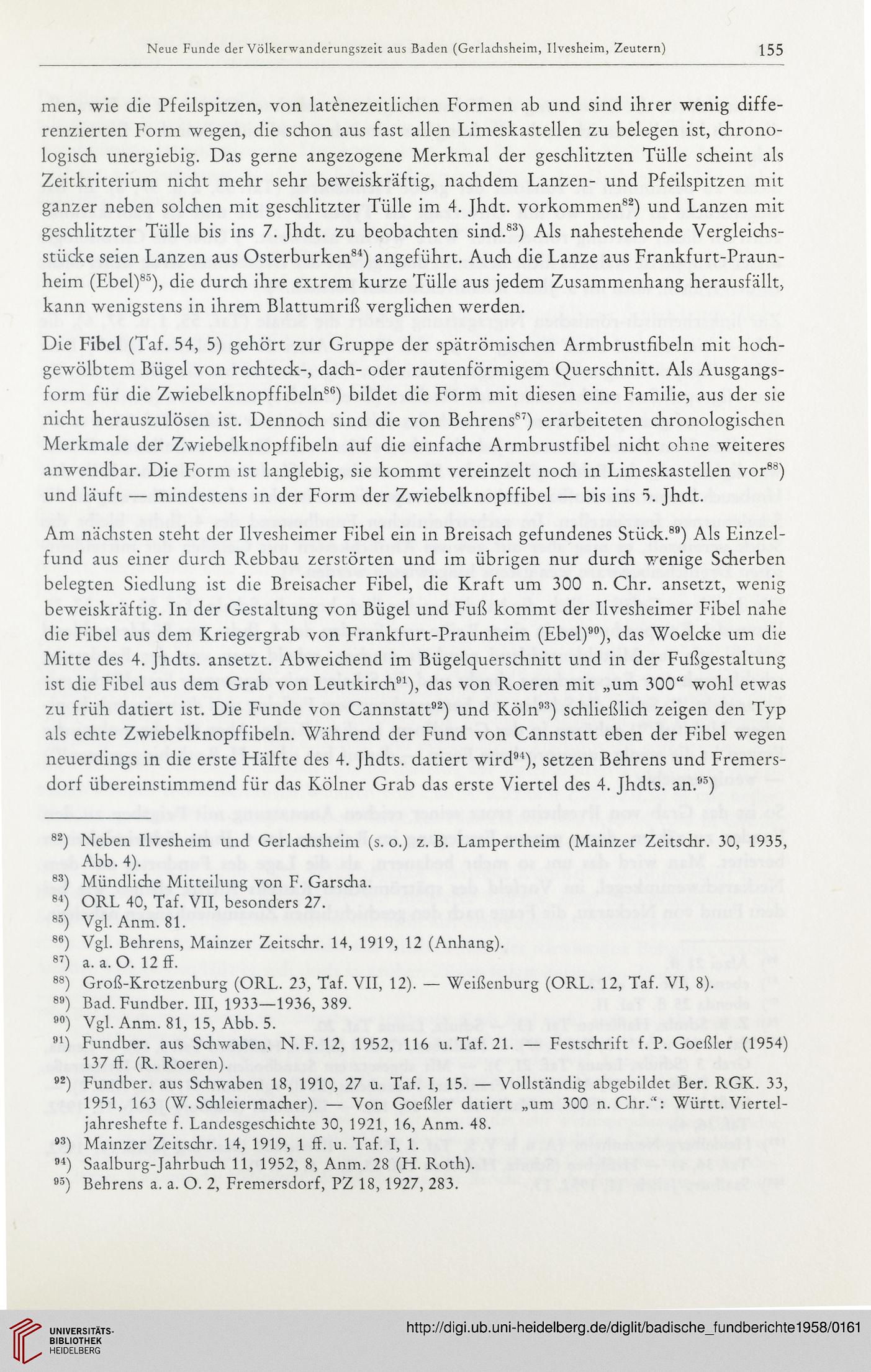Neue Funde der Völkerwanderungszeit aus Baden (Gerlachsheim, Ilvesheim, Zeutern)
155
men, wie die Pfeilspitzen, von latenezeitlichen Formen ab und sind ihrer wenig diffe-
renzierten Form wegen, die schon aus fast allen Limeskastellen zu belegen ist, chrono-
logisch unergiebig. Das gerne angezogene Merkmal der geschlitzten Tülle scheint als
Zeitkriterium nicht mehr sehr beweiskräftig, nachdem Lanzen- und Pfeilspitzen mit
ganzer neben solchen mit geschlitzter Tülle im 4. Jhdt. vorkommen82) und Lanzen mit
geschlitzter Tülle bis ins 7. Jhdt. zu beobachten sind.83) Als nahestehende Vergleichs-
stücke seien Lanzen aus Osterburken84) angeführt. Auch die Lanze aus Frankfurt-Praun-
heim (Ebel)85), die durch ihre extrem kurze Tülle aus jedem Zusammenhang herausfällt,
kann wenigstens in ihrem Blattumriß verglichen werden.
Die Fibel (Taf. 54, 5) gehört zur Gruppe der spätrömischen Armbrustfibeln mit hoch-
gewölbtem Bügel von rechteck-, dach- oder rautenförmigem Querschnitt. Als Ausgangs-
form für die Zwiebelknopffibeln86) bildet die Form mit diesen eine Familie, aus der sie
nicht herauszulösen ist. Dennoch sind die von Behrens87) erarbeiteten chronologischen
Merkmale der Zwiebelknopffibeln auf die einfache Armbrustfibel nicht ohne weiteres
anwendbar. Die Form ist langlebig, sie kommt vereinzelt noch in Limeskastellen vor88)
und läuft — mindestens in der Form der Zwiebelknopffibel — bis ins 5. Jhdt.
Am nächsten steht der Ilvesheimer Fibel ein in Breisach gefundenes Stück.89) Als Einzel-
fund aus einer durch Rebbau zerstörten und im übrigen nur durch wenige Scherben
belegten Siedlung ist die Breisacher Fibel, die Kraft um 300 n. Chr. ansetzt, wenig
beweiskräftig. In der Gestaltung von Bügel und Fuß kommt der Ilvesheimer Fibel nahe
die Fibel aus dem Kriegergrab von Frankfurt-Praunheim (Ebel)90), das Woelcke um die
Mitte des 4. Jhdts. ansetzt. Abweichend im Bügelquerschnitt und in der Fußgestaltung
ist die Fibel aus dem Grab von Leutkirch91), das von Roeren mit „um 300“ wohl etwas
zu früh datiert ist. Die Funde von Cannstatt92) und Köln93) schließlich zeigen den Typ
als echte Zwiebelknopffibeln. Während der Fund von Cannstatt eben der Fibel wegen
neuerdings in die erste Hälfte des 4. Jhdts. datiert wird94), setzen Behrens und Fremers-
dorf übereinstimmend für das Kölner Grab das erste Viertel des 4. Jhdts. an.95)
82) Neben Ilvesheim und Gerlachsheim (s. o.) z. B. Lampertheim (Mainzer Zeitschr. 30, 1935,
Abb. 4).
83) Mündliche Mitteilung von F. Garscha.
84) ORL 40, Taf. VII, besonders 27.
85) Vgl. Anm. 81.
86) Vgl. Behrens, Mainzer Zeitschr. 14, 1919, 12 (Anhang).
87) a. a. O. 12 ff.
88) Groß-Krotzenburg (ORL. 23, Taf. VII, 12). — Weißenburg (ORL. 12, Taf. VI, 8).
80) Bad. Fundber. III, 1933—1936, 389.
90) Vgl. Anm. 81, 15, Abb. 5.
91) Fundber. aus Schwaben. N. F. 12, 1952, 116 u. Taf. 21. — Festschrift f. P. Goeßler (1954)
137 ff. (R. Roeren).
92) Fundber. aus Schwaben 18, 1910, 27 u. Taf. I, 15. — Vollständig abgebildet Ber. RGK. 33,
1951, 163 (W. Schleiermacher). — Von Goeßler datiert „um 300 n. Chr.“: Württ. Viertel-
jahreshefte f. Landesgeschichte 30, 1921, 16, Anm. 48.
93) Mainzer Zeitschr. 14, 1919, 1 ff. u. Taf. I, 1.
94) Saalburg-Jahrbuch 11, 1952, 8, Anm. 28 (H. Roth).
95) Behrens a. a. O. 2, Fremersdorf, PZ 18, 1927, 283.
155
men, wie die Pfeilspitzen, von latenezeitlichen Formen ab und sind ihrer wenig diffe-
renzierten Form wegen, die schon aus fast allen Limeskastellen zu belegen ist, chrono-
logisch unergiebig. Das gerne angezogene Merkmal der geschlitzten Tülle scheint als
Zeitkriterium nicht mehr sehr beweiskräftig, nachdem Lanzen- und Pfeilspitzen mit
ganzer neben solchen mit geschlitzter Tülle im 4. Jhdt. vorkommen82) und Lanzen mit
geschlitzter Tülle bis ins 7. Jhdt. zu beobachten sind.83) Als nahestehende Vergleichs-
stücke seien Lanzen aus Osterburken84) angeführt. Auch die Lanze aus Frankfurt-Praun-
heim (Ebel)85), die durch ihre extrem kurze Tülle aus jedem Zusammenhang herausfällt,
kann wenigstens in ihrem Blattumriß verglichen werden.
Die Fibel (Taf. 54, 5) gehört zur Gruppe der spätrömischen Armbrustfibeln mit hoch-
gewölbtem Bügel von rechteck-, dach- oder rautenförmigem Querschnitt. Als Ausgangs-
form für die Zwiebelknopffibeln86) bildet die Form mit diesen eine Familie, aus der sie
nicht herauszulösen ist. Dennoch sind die von Behrens87) erarbeiteten chronologischen
Merkmale der Zwiebelknopffibeln auf die einfache Armbrustfibel nicht ohne weiteres
anwendbar. Die Form ist langlebig, sie kommt vereinzelt noch in Limeskastellen vor88)
und läuft — mindestens in der Form der Zwiebelknopffibel — bis ins 5. Jhdt.
Am nächsten steht der Ilvesheimer Fibel ein in Breisach gefundenes Stück.89) Als Einzel-
fund aus einer durch Rebbau zerstörten und im übrigen nur durch wenige Scherben
belegten Siedlung ist die Breisacher Fibel, die Kraft um 300 n. Chr. ansetzt, wenig
beweiskräftig. In der Gestaltung von Bügel und Fuß kommt der Ilvesheimer Fibel nahe
die Fibel aus dem Kriegergrab von Frankfurt-Praunheim (Ebel)90), das Woelcke um die
Mitte des 4. Jhdts. ansetzt. Abweichend im Bügelquerschnitt und in der Fußgestaltung
ist die Fibel aus dem Grab von Leutkirch91), das von Roeren mit „um 300“ wohl etwas
zu früh datiert ist. Die Funde von Cannstatt92) und Köln93) schließlich zeigen den Typ
als echte Zwiebelknopffibeln. Während der Fund von Cannstatt eben der Fibel wegen
neuerdings in die erste Hälfte des 4. Jhdts. datiert wird94), setzen Behrens und Fremers-
dorf übereinstimmend für das Kölner Grab das erste Viertel des 4. Jhdts. an.95)
82) Neben Ilvesheim und Gerlachsheim (s. o.) z. B. Lampertheim (Mainzer Zeitschr. 30, 1935,
Abb. 4).
83) Mündliche Mitteilung von F. Garscha.
84) ORL 40, Taf. VII, besonders 27.
85) Vgl. Anm. 81.
86) Vgl. Behrens, Mainzer Zeitschr. 14, 1919, 12 (Anhang).
87) a. a. O. 12 ff.
88) Groß-Krotzenburg (ORL. 23, Taf. VII, 12). — Weißenburg (ORL. 12, Taf. VI, 8).
80) Bad. Fundber. III, 1933—1936, 389.
90) Vgl. Anm. 81, 15, Abb. 5.
91) Fundber. aus Schwaben. N. F. 12, 1952, 116 u. Taf. 21. — Festschrift f. P. Goeßler (1954)
137 ff. (R. Roeren).
92) Fundber. aus Schwaben 18, 1910, 27 u. Taf. I, 15. — Vollständig abgebildet Ber. RGK. 33,
1951, 163 (W. Schleiermacher). — Von Goeßler datiert „um 300 n. Chr.“: Württ. Viertel-
jahreshefte f. Landesgeschichte 30, 1921, 16, Anm. 48.
93) Mainzer Zeitschr. 14, 1919, 1 ff. u. Taf. I, 1.
94) Saalburg-Jahrbuch 11, 1952, 8, Anm. 28 (H. Roth).
95) Behrens a. a. O. 2, Fremersdorf, PZ 18, 1927, 283.