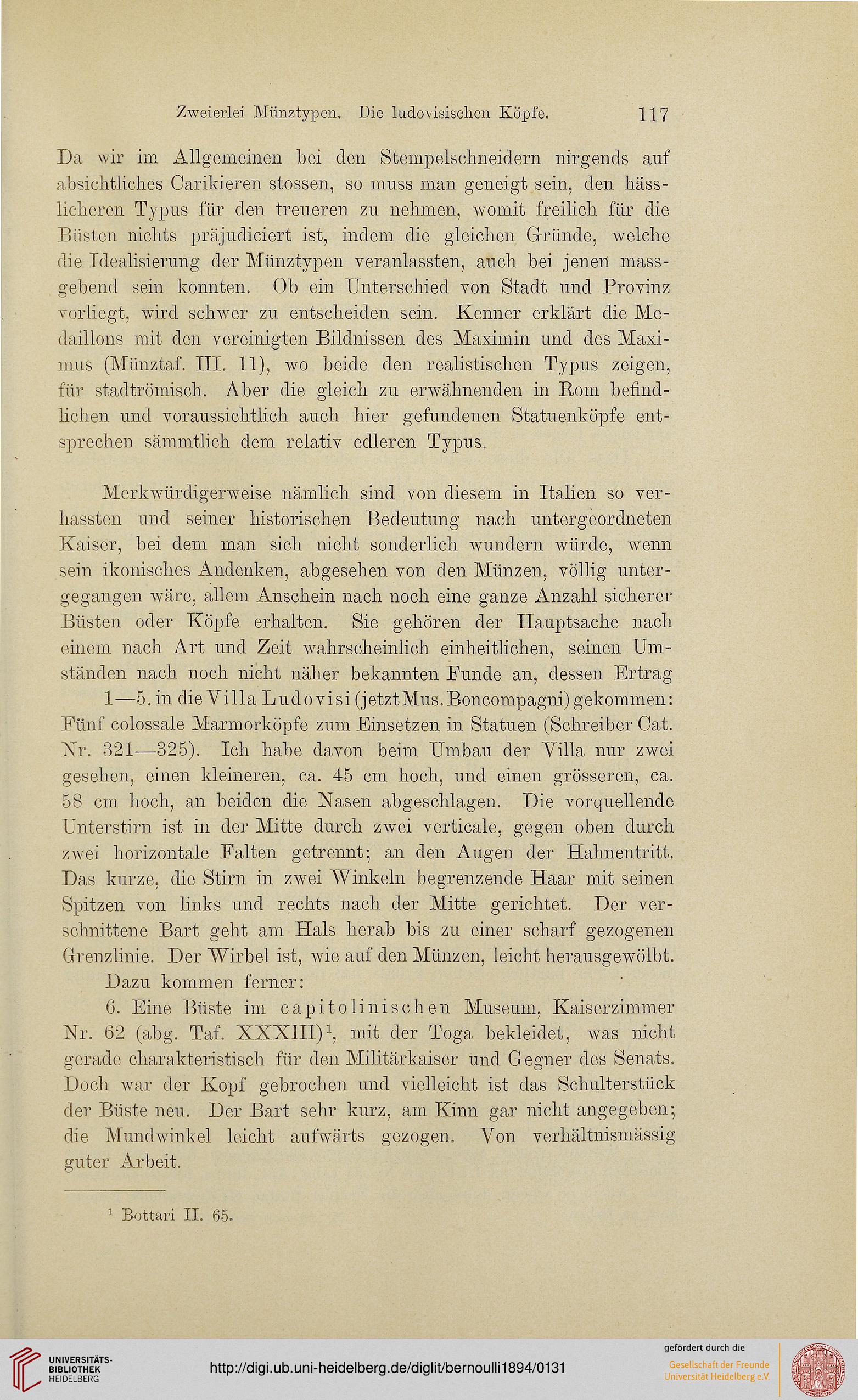Zweierlei Münztypen. Die ludovisischen Köpfe.
117
Da wir im Allgemeinen bei den Stempelschneidern nirgends auf
absichtliches Carikieren stossen, so muss man geneigt sein, den häss-
licheren Typus für den treueren zu nehmen, womit freilich für die
Büsten nichts präjudieiert ist, indem die gleichen Gründe, welche
die Idealisierung der Münztypen veranlassten, auch bei jenen mass-
gebend sein konnten. Ob ein Unterschied von Stadt und Provinz
vorhegt, wird schwer zu entscheiden sein. Kenner erklärt die Me-
daillons mit den vereinigten Bildnissen des Maximin und des Maxi-
mus (Münztaf. III. 11), wo beide den realistischen Typus zeigen,
für stadtrömisch. Aber die gleich zu erwähnenden in Born befind-
lichen und voraussichtlich auch hier gefundenen Statuenköpfe ent-
sprechen sämmtlich dem relativ edleren Typus.
Merkwürdigerweise nämlich sind von diesem in Italien so ver-
hassten und seiner historischen Bedeutung nach untergeordneten
Kaiser, bei dem man sich nicht sonderlich wundern würde, wenn
sein ikonisches Andenken, abgesehen von den Münzen, völlig unter-
gegangen wäre, allem Anschein nach noch eine ganze Anzahl sicherer
Büsten oder Köpfe erhalten. Sie gehören der Hauptsache nach
einem nach Art und Zeit wahrscheinlich einheitlichen, seinen Um-
ständen nach noch nicht näher bekannten Funde an, dessen Ertrag
1—5. in die Vi 11 a Lud o visi (jetztMus. Boncompagni) gekommen:
Fünf colossale Marmorköpfe zum Einsetzen in Statuen (Schreiber Cat.
Nr. 321-—325). Ich habe davon beim Umbau der Villa nur zwei
gesehen, einen kleineren, ca. 45 cm hoch, und einen grösseren, ca.
58 cm hoch, an beiden die Nasen abgeschlagen. Die vorquellende
Unterstirn ist in der Mitte durch zwei verticale, gegen oben durch
zwei horizontale Falten getrennt-, an den Augen der Hahnentritt.
Das kurze, die Stirn in zwei Winkeln begrenzende Haar mit seinen
Spitzen von links und rechts nach der Mitte gerichtet. Der ver-
schnittene Bart geht am Hals herab bis zu einer scharf gezogenen
Grenzlinie. Der Wirbel ist, wie auf den Münzen, leicht herausgewölbt.
Dazu kommen ferner:
6. Eine Büste im capitolinischen Museum, Kaiserzimmer
Nr. (52 (abg. Taf. XXN1II)1, mit der Toga bekleidet, was nicht
gerade charakteristisch für den Militärkaiser und Gegner des Senats.
Doch war der Kopf gebrochen und vielleicht ist das Schulterstück
der Büste neu. Der Bart sehr kurz, am Kinn gar nicht angegeben;
die Mundwinkel leicht aufwärts gezogen. Von verhältnismässig
guter Arbeit.
1 Bottari II. 65.
117
Da wir im Allgemeinen bei den Stempelschneidern nirgends auf
absichtliches Carikieren stossen, so muss man geneigt sein, den häss-
licheren Typus für den treueren zu nehmen, womit freilich für die
Büsten nichts präjudieiert ist, indem die gleichen Gründe, welche
die Idealisierung der Münztypen veranlassten, auch bei jenen mass-
gebend sein konnten. Ob ein Unterschied von Stadt und Provinz
vorhegt, wird schwer zu entscheiden sein. Kenner erklärt die Me-
daillons mit den vereinigten Bildnissen des Maximin und des Maxi-
mus (Münztaf. III. 11), wo beide den realistischen Typus zeigen,
für stadtrömisch. Aber die gleich zu erwähnenden in Born befind-
lichen und voraussichtlich auch hier gefundenen Statuenköpfe ent-
sprechen sämmtlich dem relativ edleren Typus.
Merkwürdigerweise nämlich sind von diesem in Italien so ver-
hassten und seiner historischen Bedeutung nach untergeordneten
Kaiser, bei dem man sich nicht sonderlich wundern würde, wenn
sein ikonisches Andenken, abgesehen von den Münzen, völlig unter-
gegangen wäre, allem Anschein nach noch eine ganze Anzahl sicherer
Büsten oder Köpfe erhalten. Sie gehören der Hauptsache nach
einem nach Art und Zeit wahrscheinlich einheitlichen, seinen Um-
ständen nach noch nicht näher bekannten Funde an, dessen Ertrag
1—5. in die Vi 11 a Lud o visi (jetztMus. Boncompagni) gekommen:
Fünf colossale Marmorköpfe zum Einsetzen in Statuen (Schreiber Cat.
Nr. 321-—325). Ich habe davon beim Umbau der Villa nur zwei
gesehen, einen kleineren, ca. 45 cm hoch, und einen grösseren, ca.
58 cm hoch, an beiden die Nasen abgeschlagen. Die vorquellende
Unterstirn ist in der Mitte durch zwei verticale, gegen oben durch
zwei horizontale Falten getrennt-, an den Augen der Hahnentritt.
Das kurze, die Stirn in zwei Winkeln begrenzende Haar mit seinen
Spitzen von links und rechts nach der Mitte gerichtet. Der ver-
schnittene Bart geht am Hals herab bis zu einer scharf gezogenen
Grenzlinie. Der Wirbel ist, wie auf den Münzen, leicht herausgewölbt.
Dazu kommen ferner:
6. Eine Büste im capitolinischen Museum, Kaiserzimmer
Nr. (52 (abg. Taf. XXN1II)1, mit der Toga bekleidet, was nicht
gerade charakteristisch für den Militärkaiser und Gegner des Senats.
Doch war der Kopf gebrochen und vielleicht ist das Schulterstück
der Büste neu. Der Bart sehr kurz, am Kinn gar nicht angegeben;
die Mundwinkel leicht aufwärts gezogen. Von verhältnismässig
guter Arbeit.
1 Bottari II. 65.