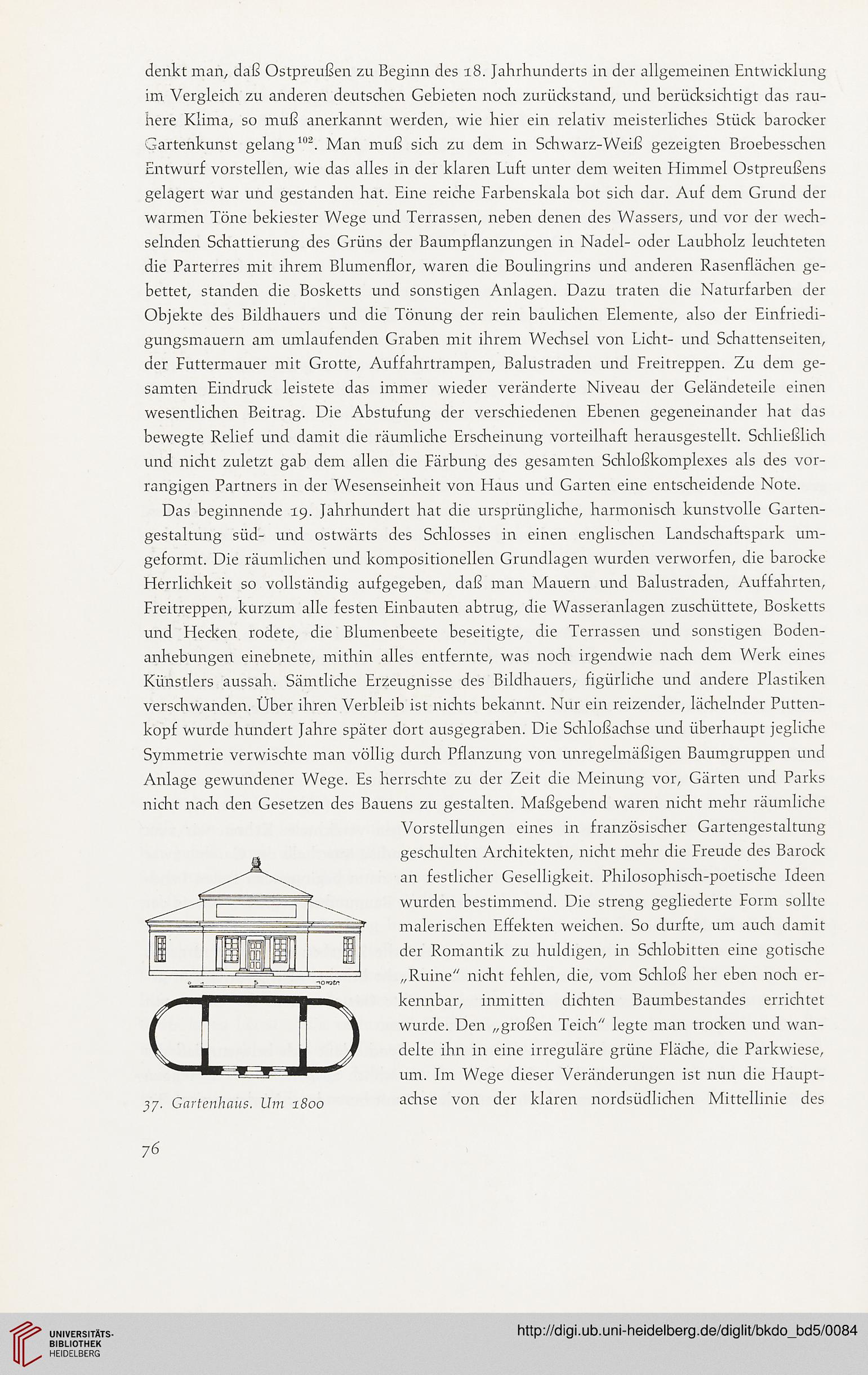denkt man, daß Ostpreußen zu Beginn des 18. Jahrhunderts in der allgemeinen Entwicklung
im Vergleich zu anderen deutschen Gebieten noch zurückstand, und berücksichtigt das rau-
here Klima, so muß anerkannt werden, wie hier ein relativ meisterliches Stück barocker
Gartenkunst gelang102. Man muß sich zu dem in Schwarz-Weiß gezeigten Broebesschen
Entwurf vorstellen, wie das alles in der klaren Luft unter dem weiten Himmel Ostpreußens
gelagert war und gestanden hat. Eine reiche Farbenskala bot sich dar. Auf dem Grund der
warmen Töne bekiester Wege und Terrassen, neben denen des Wassers, und vor der wech-
selnden Schattierung des Grüns der Baumpflanzungen in Nadel- oder Laubholz leuchteten
die Parterres mit ihrem Blumenflor, waren die Boulingrins und anderen Rasenflächen ge-
bettet, standen die Bosketts und sonstigen Anlagen. Dazu traten die Naturfarben der
Objekte des Bildhauers und die Tönung der rein baulichen Elemente, also der Einfriedi-
gungsmauern am umlaufenden Graben mit ihrem Wechsel von Licht- und Schattenseiten,
der Futtermauer mit Grotte, Auffahrtrampen, Balustraden und Freitreppen. Zu dem ge-
samten Eindruck leistete das immer wieder veränderte Niveau der Geländeteile einen
wesentlichen Beitrag. Die Abstufung der verschiedenen Ebenen gegeneinander hat das
bewegte Relief und damit die räumliche Erscheinung vorteilhaft herausgestellt. Schließlich
und nicht zuletzt gab dem allen die Färbung des gesamten Schloßkomplexes als des vor-
rangigen Partners in der Wesenseinheit von Haus und Garten eine entscheidende Note.
Das beginnende 19. Jahrhundert hat die ursprüngliche, harmonisch kunstvolle Garten-
gestaltung süd- und ostwärts des Schlosses in einen englischen Landschaftspark um-
geformt. Die räumlichen und kompositionellen Grundlagen wurden verworfen, die barocke
Herrlichkeit so vollständig aufgegeben, daß man Mauern und Balustraden, Auffahrten,
Freitreppen, kurzum alle festen Einbauten abtrug, die Wasseranlagen zuschüttete, Bosketts
und Hecken rodete, die Blumenbeete beseitigte, die Terrassen und sonstigen Boden-
anhebungen einebnete, mithin alles entfernte, was noch irgendwie nach dem Werk eines
Künstlers aussah. Sämtliche Erzeugnisse des Bildhauers, figürliche und andere Plastiken
verschwanden. Über ihren Verbleib ist nichts bekannt. Nur ein reizender, lächelnder Putten-
kopf wurde hundert Jahre später dort ausgegraben. Die Schloßachse und überhaupt jegliche
Symmetrie verwischte man völlig durch Pflanzung von unregelmäßigen Baumgruppen und
Anlage gewundener Wege. Es herrschte zu der Zeit die Meinung vor, Gärten und Parks
nicht nach den Gesetzen des Bauens zu gestalten. Maßgebend waren nicht mehr räumliche
Vorstellungen eines in französischer Gartengestaltung
geschulten Architekten, nicht mehr die Freude des Barock
an festlicher Geselligkeit. Philosophisch-poetische Ideen
wurden bestimmend. Die streng gegliederte Form sollte
malerischen Effekten weichen. So durfte, um auch damit
der Romantik zu huldigen, in Schlobitten eine gotische
„Ruine" nicht fehlen, die, vom Schloß her eben noch er-
kennbar, inmitten dichten Baumbestandes errichtet
wurde. Den „großen Teich" legte man trocken und wan-
delte ihn in eine irreguläre grüne Fläche, die Parkwiese,
um. Im Wege dieser Veränderungen ist nun die Haupt-
achse von der klaren nordsüdlichen Mittellinie des
76
im Vergleich zu anderen deutschen Gebieten noch zurückstand, und berücksichtigt das rau-
here Klima, so muß anerkannt werden, wie hier ein relativ meisterliches Stück barocker
Gartenkunst gelang102. Man muß sich zu dem in Schwarz-Weiß gezeigten Broebesschen
Entwurf vorstellen, wie das alles in der klaren Luft unter dem weiten Himmel Ostpreußens
gelagert war und gestanden hat. Eine reiche Farbenskala bot sich dar. Auf dem Grund der
warmen Töne bekiester Wege und Terrassen, neben denen des Wassers, und vor der wech-
selnden Schattierung des Grüns der Baumpflanzungen in Nadel- oder Laubholz leuchteten
die Parterres mit ihrem Blumenflor, waren die Boulingrins und anderen Rasenflächen ge-
bettet, standen die Bosketts und sonstigen Anlagen. Dazu traten die Naturfarben der
Objekte des Bildhauers und die Tönung der rein baulichen Elemente, also der Einfriedi-
gungsmauern am umlaufenden Graben mit ihrem Wechsel von Licht- und Schattenseiten,
der Futtermauer mit Grotte, Auffahrtrampen, Balustraden und Freitreppen. Zu dem ge-
samten Eindruck leistete das immer wieder veränderte Niveau der Geländeteile einen
wesentlichen Beitrag. Die Abstufung der verschiedenen Ebenen gegeneinander hat das
bewegte Relief und damit die räumliche Erscheinung vorteilhaft herausgestellt. Schließlich
und nicht zuletzt gab dem allen die Färbung des gesamten Schloßkomplexes als des vor-
rangigen Partners in der Wesenseinheit von Haus und Garten eine entscheidende Note.
Das beginnende 19. Jahrhundert hat die ursprüngliche, harmonisch kunstvolle Garten-
gestaltung süd- und ostwärts des Schlosses in einen englischen Landschaftspark um-
geformt. Die räumlichen und kompositionellen Grundlagen wurden verworfen, die barocke
Herrlichkeit so vollständig aufgegeben, daß man Mauern und Balustraden, Auffahrten,
Freitreppen, kurzum alle festen Einbauten abtrug, die Wasseranlagen zuschüttete, Bosketts
und Hecken rodete, die Blumenbeete beseitigte, die Terrassen und sonstigen Boden-
anhebungen einebnete, mithin alles entfernte, was noch irgendwie nach dem Werk eines
Künstlers aussah. Sämtliche Erzeugnisse des Bildhauers, figürliche und andere Plastiken
verschwanden. Über ihren Verbleib ist nichts bekannt. Nur ein reizender, lächelnder Putten-
kopf wurde hundert Jahre später dort ausgegraben. Die Schloßachse und überhaupt jegliche
Symmetrie verwischte man völlig durch Pflanzung von unregelmäßigen Baumgruppen und
Anlage gewundener Wege. Es herrschte zu der Zeit die Meinung vor, Gärten und Parks
nicht nach den Gesetzen des Bauens zu gestalten. Maßgebend waren nicht mehr räumliche
Vorstellungen eines in französischer Gartengestaltung
geschulten Architekten, nicht mehr die Freude des Barock
an festlicher Geselligkeit. Philosophisch-poetische Ideen
wurden bestimmend. Die streng gegliederte Form sollte
malerischen Effekten weichen. So durfte, um auch damit
der Romantik zu huldigen, in Schlobitten eine gotische
„Ruine" nicht fehlen, die, vom Schloß her eben noch er-
kennbar, inmitten dichten Baumbestandes errichtet
wurde. Den „großen Teich" legte man trocken und wan-
delte ihn in eine irreguläre grüne Fläche, die Parkwiese,
um. Im Wege dieser Veränderungen ist nun die Haupt-
achse von der klaren nordsüdlichen Mittellinie des
76