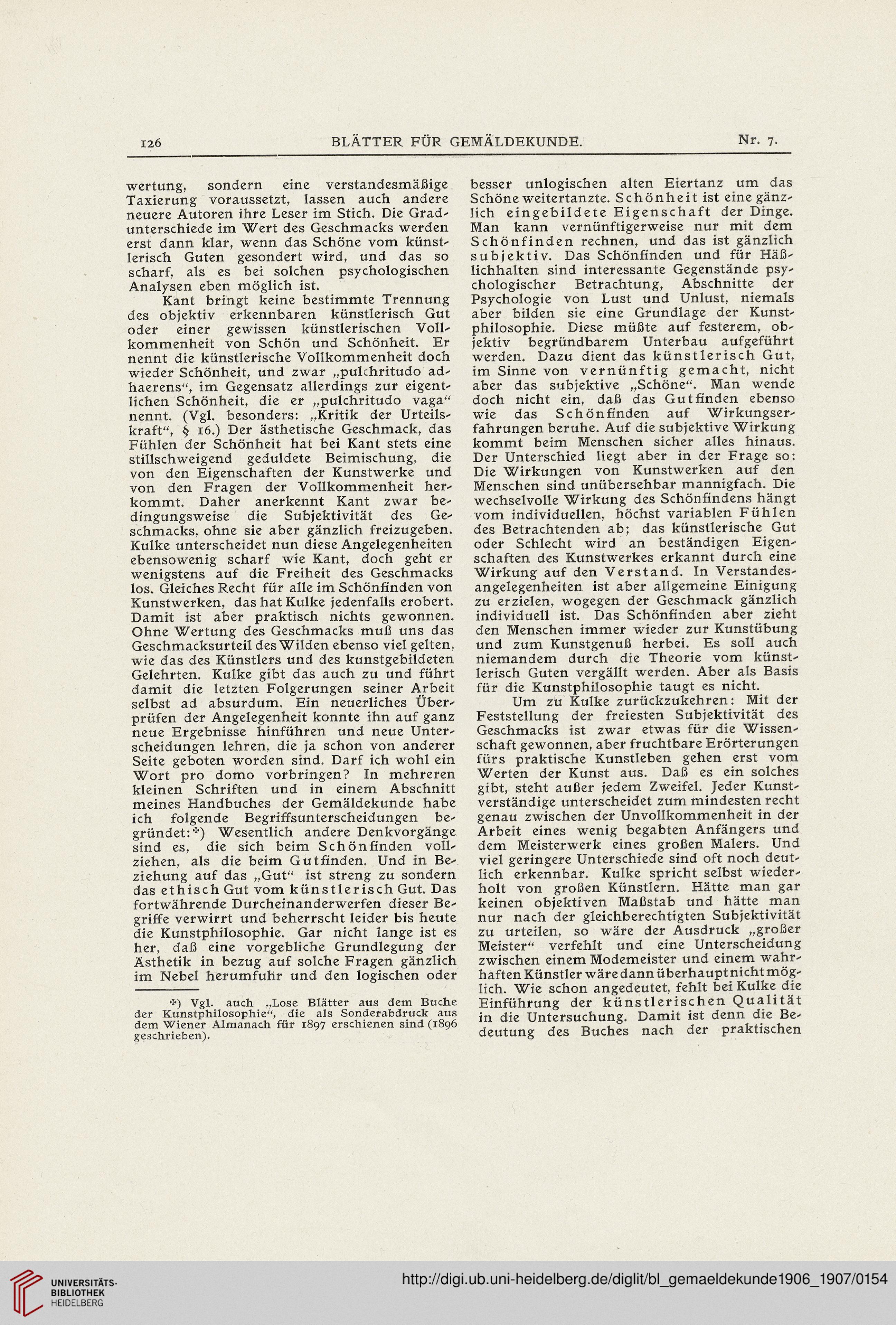126
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
Nr. 7.
Wertung, sondern eine verstandesmäßige
Taxierung voraussetzt, lassen auch andere
neuere Autoren ihre Leser im Stich. Die Grad-
unterschiede im Wert des Geschmacks werden
erst dann klar, wenn das Schöne vom künst-
lerisch Guten gesondert wird, und das so
scharf, als es bei solchen psychologischen
Analysen eben möglich ist.
Kant bringt keine bestimmte Trennung
des objektiv erkennbaren künstlerisch Gut
oder einer gewissen künstlerischen Voll-
kommenheit von Schön und Schönheit. Er
nennt die künstlerische Vollkommenheit doch
wieder Schönheit, und zwar „pulchritudo ad-
haerens“, im Gegensatz allerdings zur eigent-
lichen Schönheit, die er „pulchritudo vaga“
nennt. (Vgl. besonders: „Kritik der Urteils-
kraft“, $ 16.) Der ästhetische Geschmack, das
Fühlen der Schönheit hat bei Kant stets eine
stillschweigend geduldete Beimischung, die
von den Eigenschaften der Kunstwerke und
von den Fragen der Vollkommenheit her-
kommt. Daher anerkennt Kant zwar be-
dingungsweise die Subjektivität des Ge-
schmacks, ohne sie aber gänzlich freizugeben.
Kulke unterscheidet nun diese Angelegenheiten
ebensowenig scharf wie Kant, doch geht er
wenigstens auf die Freiheit des Geschmacks
los. Gleiches Recht für alle im Schönfinden von
Kunstwerken, das hat Kulke jedenfalls erobert.
Damit ist aber praktisch nichts gewonnen.
Ohne Wertung des Geschmacks muß uns das
Geschmacksurteil des Wilden ebenso viel gelten,
wie das des Künstlers und des kunstgebildeten
Gelehrten. Kulke gibt das auch zu und führt
damit die letzten Folgerungen seiner Arbeit
selbst ad absurdum. Ein neuerliches Über-
prüfen der Angelegenheit konnte ihn auf ganz
neue Ergebnisse hinführen und neue Unter-
scheidungen lehren, die ja schon von anderer
Seite geboten worden sind. Darf ich wohl ein
Wort pro domo Vorbringen? In mehreren
kleinen Schriften und in einem Abschnitt
meines Handbuches der Gemäldekunde habe
ich folgende Begriffsunterscheidungen be-
gründet:*) Wesentlich andere Denkvorgänge
sind es, die sich beim Schön finden voll-
ziehen, als die beim Gutfinden. Und in Be-
ziehung auf das „Gut“ ist streng zu sondern
das ethisch Gut vom künstlerisch Gut. Das
fortwährende Durcheinanderwerfen dieser Be-
griffe verwirrt und beherrscht leider bis heute
die Kunstphilosophie. Gar nicht lange ist es
her, daß eine vorgebliche Grundlegung der
Ästhetik in bezug auf solche Fragen gänzlich
im Nebel herumfuhr und den logischen oder
*) Vgl. auch „Lose Blätter aus dem Buche
der Kunstphilosophie“, die als Sonderabdruck aus
dem Wiener Almanach für 1897 erschienen sind (1896
geschrieben).
besser unlogischen alten Eiertanz um das
Schöne weitertanzte. Schönheit ist eine gänz-
lich eingebildete Eigenschaft der Dinge.
Man kann vernünftigerweise nur mit dem
Schönfinden rechnen, und das ist gänzlich
subjektiv. Das Schönfinden und für Häß-
lichhalten sind interessante Gegenstände psy-
chologischer Betrachtung, Abschnitte der
Psychologie von Lust und Unlust, niemals
aber bilden sie eine Grundlage der Kunst-
philosophie. Diese müßte auf festerem, ob-
jektiv begründbarem Unterbau aufgeführt
werden. Dazu dient das künstlerisch Gut,
im Sinne von vernünftig gemacht, nicht
aber das subjektive „Schöne“. Man wende
doch nicht ein, daß das Gut finden ebenso
wie das Schönfinden auf Wirkungser-
fahrungen beruhe. Auf die subjektive Wirkung
kommt beim Menschen sicher alles hinaus.
Der Unterschied liegt aber in der Frage so:
Die Wirkungen von Kunstwerken auf den
Menschen sind unübersehbar mannigfach. Die
wechselvolle Wirkung des Schönfindens hängt
vom individuellen, höchst variablen Fühlen
des Betrachtenden ab; das künstlerische Gut
oder Schlecht wird an beständigen Eigen-
schaften des Kunstwerkes erkannt durch eine
Wirkung auf den Verstand. In Verstandes-
Angelegenheiten ist aber allgemeine Einigung
zu erzielen, wogegen der Geschmack gänzlich
individuell ist. Das Schönfinden aber zieht
den Menschen immer wieder zur Kunstübung
und zum Kunstgenuß herbei. Es soll auch
niemandem durch die Theorie vom künst-
lerisch Guten vergällt werden. Aber als Basis
für die Kunstphilosophie taugt es nicht.
Um zu Kulke zurückzukehren: Mit der
Feststellung der freiesten Subjektivität des
Geschmacks ist zwar etwas für die Wissen-
schaft gewonnen, aber fruchtbare Erörterungen
fürs praktische Kunstleben gehen erst vom
Werten der Kunst aus. Daß es ein solches
gibt, steht außer jedem Zweifel. Jeder Kunst-
verständige unterscheidet zum mindesten recht
genau zwischen der Unvollkommenheit in der
Arbeit eines wenig begabten Anfängers und
dem Meisterwerk eines großen Malers. Und
viel geringere Unterschiede sind oft noch deut-
lich erkennbar. Kulke spricht selbst wieder-
holt von großen Künstlern. Hätte man gar
keinen objektiven Maßstab und hätte man
nur nach der gleichberechtigten Subjektivität
zu urteilen, so wäre der Ausdruck „großer
Meister“ verfehlt und eine Unterscheidung
zwischen einem Modemeister und einem wahr-
haften Künstler wäre dann überhaupt nicht mög-
lich. Wie schon angedeutet, fehlt bei Kulke die
Einführung der künstlerischen Qualität
in die Untersuchung. Damit ist denn die Be-
deutung des Buches nach der praktischen
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
Nr. 7.
Wertung, sondern eine verstandesmäßige
Taxierung voraussetzt, lassen auch andere
neuere Autoren ihre Leser im Stich. Die Grad-
unterschiede im Wert des Geschmacks werden
erst dann klar, wenn das Schöne vom künst-
lerisch Guten gesondert wird, und das so
scharf, als es bei solchen psychologischen
Analysen eben möglich ist.
Kant bringt keine bestimmte Trennung
des objektiv erkennbaren künstlerisch Gut
oder einer gewissen künstlerischen Voll-
kommenheit von Schön und Schönheit. Er
nennt die künstlerische Vollkommenheit doch
wieder Schönheit, und zwar „pulchritudo ad-
haerens“, im Gegensatz allerdings zur eigent-
lichen Schönheit, die er „pulchritudo vaga“
nennt. (Vgl. besonders: „Kritik der Urteils-
kraft“, $ 16.) Der ästhetische Geschmack, das
Fühlen der Schönheit hat bei Kant stets eine
stillschweigend geduldete Beimischung, die
von den Eigenschaften der Kunstwerke und
von den Fragen der Vollkommenheit her-
kommt. Daher anerkennt Kant zwar be-
dingungsweise die Subjektivität des Ge-
schmacks, ohne sie aber gänzlich freizugeben.
Kulke unterscheidet nun diese Angelegenheiten
ebensowenig scharf wie Kant, doch geht er
wenigstens auf die Freiheit des Geschmacks
los. Gleiches Recht für alle im Schönfinden von
Kunstwerken, das hat Kulke jedenfalls erobert.
Damit ist aber praktisch nichts gewonnen.
Ohne Wertung des Geschmacks muß uns das
Geschmacksurteil des Wilden ebenso viel gelten,
wie das des Künstlers und des kunstgebildeten
Gelehrten. Kulke gibt das auch zu und führt
damit die letzten Folgerungen seiner Arbeit
selbst ad absurdum. Ein neuerliches Über-
prüfen der Angelegenheit konnte ihn auf ganz
neue Ergebnisse hinführen und neue Unter-
scheidungen lehren, die ja schon von anderer
Seite geboten worden sind. Darf ich wohl ein
Wort pro domo Vorbringen? In mehreren
kleinen Schriften und in einem Abschnitt
meines Handbuches der Gemäldekunde habe
ich folgende Begriffsunterscheidungen be-
gründet:*) Wesentlich andere Denkvorgänge
sind es, die sich beim Schön finden voll-
ziehen, als die beim Gutfinden. Und in Be-
ziehung auf das „Gut“ ist streng zu sondern
das ethisch Gut vom künstlerisch Gut. Das
fortwährende Durcheinanderwerfen dieser Be-
griffe verwirrt und beherrscht leider bis heute
die Kunstphilosophie. Gar nicht lange ist es
her, daß eine vorgebliche Grundlegung der
Ästhetik in bezug auf solche Fragen gänzlich
im Nebel herumfuhr und den logischen oder
*) Vgl. auch „Lose Blätter aus dem Buche
der Kunstphilosophie“, die als Sonderabdruck aus
dem Wiener Almanach für 1897 erschienen sind (1896
geschrieben).
besser unlogischen alten Eiertanz um das
Schöne weitertanzte. Schönheit ist eine gänz-
lich eingebildete Eigenschaft der Dinge.
Man kann vernünftigerweise nur mit dem
Schönfinden rechnen, und das ist gänzlich
subjektiv. Das Schönfinden und für Häß-
lichhalten sind interessante Gegenstände psy-
chologischer Betrachtung, Abschnitte der
Psychologie von Lust und Unlust, niemals
aber bilden sie eine Grundlage der Kunst-
philosophie. Diese müßte auf festerem, ob-
jektiv begründbarem Unterbau aufgeführt
werden. Dazu dient das künstlerisch Gut,
im Sinne von vernünftig gemacht, nicht
aber das subjektive „Schöne“. Man wende
doch nicht ein, daß das Gut finden ebenso
wie das Schönfinden auf Wirkungser-
fahrungen beruhe. Auf die subjektive Wirkung
kommt beim Menschen sicher alles hinaus.
Der Unterschied liegt aber in der Frage so:
Die Wirkungen von Kunstwerken auf den
Menschen sind unübersehbar mannigfach. Die
wechselvolle Wirkung des Schönfindens hängt
vom individuellen, höchst variablen Fühlen
des Betrachtenden ab; das künstlerische Gut
oder Schlecht wird an beständigen Eigen-
schaften des Kunstwerkes erkannt durch eine
Wirkung auf den Verstand. In Verstandes-
Angelegenheiten ist aber allgemeine Einigung
zu erzielen, wogegen der Geschmack gänzlich
individuell ist. Das Schönfinden aber zieht
den Menschen immer wieder zur Kunstübung
und zum Kunstgenuß herbei. Es soll auch
niemandem durch die Theorie vom künst-
lerisch Guten vergällt werden. Aber als Basis
für die Kunstphilosophie taugt es nicht.
Um zu Kulke zurückzukehren: Mit der
Feststellung der freiesten Subjektivität des
Geschmacks ist zwar etwas für die Wissen-
schaft gewonnen, aber fruchtbare Erörterungen
fürs praktische Kunstleben gehen erst vom
Werten der Kunst aus. Daß es ein solches
gibt, steht außer jedem Zweifel. Jeder Kunst-
verständige unterscheidet zum mindesten recht
genau zwischen der Unvollkommenheit in der
Arbeit eines wenig begabten Anfängers und
dem Meisterwerk eines großen Malers. Und
viel geringere Unterschiede sind oft noch deut-
lich erkennbar. Kulke spricht selbst wieder-
holt von großen Künstlern. Hätte man gar
keinen objektiven Maßstab und hätte man
nur nach der gleichberechtigten Subjektivität
zu urteilen, so wäre der Ausdruck „großer
Meister“ verfehlt und eine Unterscheidung
zwischen einem Modemeister und einem wahr-
haften Künstler wäre dann überhaupt nicht mög-
lich. Wie schon angedeutet, fehlt bei Kulke die
Einführung der künstlerischen Qualität
in die Untersuchung. Damit ist denn die Be-
deutung des Buches nach der praktischen