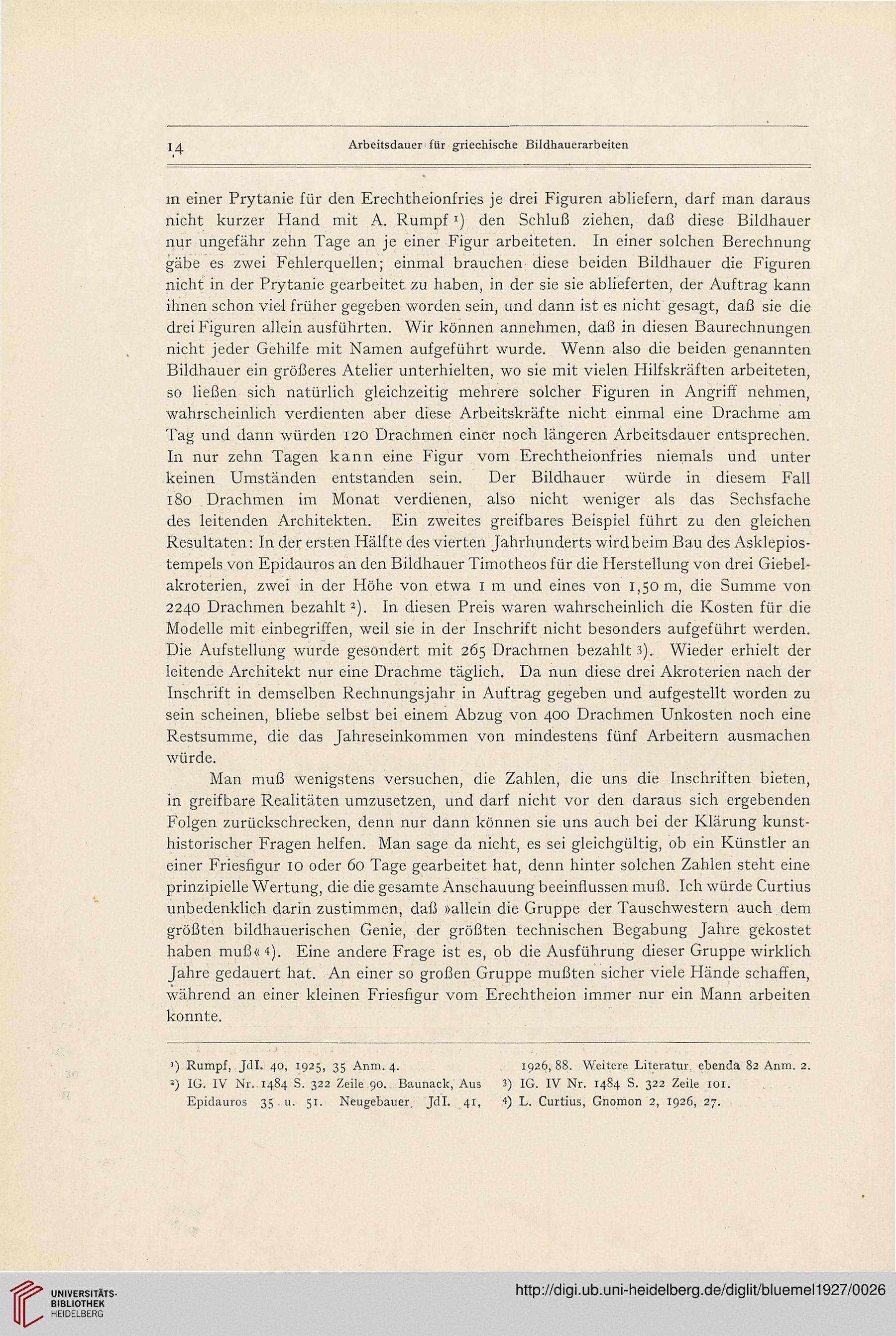14. Arbeitsdauer für griechische Bildhauerarbeiten
m einer Prytanie für den Erechtheionfries je drei Figuren abliefern, darf man daraus
nicht kurzer Hand mit A. RumpfT) den Schluß ziehen, daß diese Bildhauer
nur ungefähr zehn Tage an je einer Figur arbeiteten. In einer solchen Berechnung
gäbe es zwei Fehlerquellen; einmal brauchen diese beiden Bildhauer die Figuren
nicht in der Prytanie gearbeitet zu haben, in der sie sie ablieferten, der Auftrag kann
ihnen schon viel früher gegeben worden sein, und dann ist es nicht gesagt, daß sie die
drei Figuren allein ausführten. Wir können annehmen, daß in diesen Baurechnungen
nicht jeder Gehilfe mit Namen aufgeführt wurde. Wenn also die beiden genannten
Bildhauer ein größeres Atelier unterhielten, wo sie mit vielen Hilfskräften arbeiteten,
so ließen sich natürlich gleichzeitig mehrere solcher Figuren in Angriff nehmen,
wahrscheinlich verdienten aber diese Arbeitskräfte nicht einmal eine Drachme am
Tag und dann würden 120 Drachmen einer noch längeren Arbeitsdauer entsprechen.
In nur zehn Tagen kann eine Figur vom Erechtheionfries niemals und unter
keinen Umständen entstanden sein. Der Bildhauer würde in diesem Fall
180 Drachmen im Monat verdienen, also nicht weniger als das Sechsfache
des leitenden Architekten. Ein zweites greifbares Beispiel führt zu den gleichen
Resultaten: In der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts wird beim Bau des Asklepios-
tempels von Epidauros an den Bildhauer Timotheos für die Herstellung von drei Giebel-
akroterien, zwei in der Höhe von etwa i m und eines von 1,50 m, die Summe von
2240 Drachmen bezahlt2). In diesen Preis waren wahrscheinlich die Kosten für die
Modelle mit einbegriffen, weil sie in der Inschrift nicht besonders aufgeführt werden.
Die Aufstellung wurde gesondert mit 265 Drachmen bezahlt 3).. Wieder erhielt der
leitende Architekt nur eine Drachme täglich. Da nun diese drei Akroterien nach der
Inschrift in demselben Rechnungsjahr in Auftrag gegeben und aufgestellt worden zu
sein scheinen, bliebe selbst bei einem Abzug von 400 Drachmen Unkosten noch eine
Restsumme, die das Jahreseinkommen von mindestens fünf Arbeitern ausmachen
würde.
Man muß wenigstens versuchen, die Zahlen, die uns die Inschriften bieten,
in greifbare Realitäten umzusetzen, und darf nicht vor den daraus sich ergebenden
Folgen zurückschrecken, denn nur dann können sie uns auch bei der Klärung kunst-
historischer Fragen helfen. Man sage da nicht, es sei gleichgültig, ob ein Künstler an
einer Friesfigur 10 oder 60 Tage gearbeitet hat, denn hinter solchen Zahlen steht eine
prinzipielle Wertung, die die gesamte Anschauung beeinflussen muß. Ich würde Curtius
unbedenklich darin zustimmen, daß »allein die Gruppe der Tauschwestern auch dem
größten bildhauerischen Genie, der größten technischen Begabung Jahre gekostet
haben muß« 4). Eine andere Frage ist es, ob die Ausführung dieser Gruppe wirklich
Jahre gedauert hat. An einer so großen Gruppe mußten sicher viele Hände schaffen,
während an einer kleinen Friesfigur vom Erechtheion immer nur ein Mann arbeiten
konnte.
’) Rumpf, Jdl. 40, 1925, 35 Anm. 4. 1926, 88. Weitere Literatur, ebenda 82 Anm. 2.
») IG. IV Nr.. 1484 S. 322 Zeile 90. Baunack, Aus 3) IG. IV Nr. 1484 S. 322 Zeile 101.
Epidauros 35 . u. 51. Neugebauer. Jdl. 41, 4) L. Curtius, Gnomon 2, 1926, 27.
m einer Prytanie für den Erechtheionfries je drei Figuren abliefern, darf man daraus
nicht kurzer Hand mit A. RumpfT) den Schluß ziehen, daß diese Bildhauer
nur ungefähr zehn Tage an je einer Figur arbeiteten. In einer solchen Berechnung
gäbe es zwei Fehlerquellen; einmal brauchen diese beiden Bildhauer die Figuren
nicht in der Prytanie gearbeitet zu haben, in der sie sie ablieferten, der Auftrag kann
ihnen schon viel früher gegeben worden sein, und dann ist es nicht gesagt, daß sie die
drei Figuren allein ausführten. Wir können annehmen, daß in diesen Baurechnungen
nicht jeder Gehilfe mit Namen aufgeführt wurde. Wenn also die beiden genannten
Bildhauer ein größeres Atelier unterhielten, wo sie mit vielen Hilfskräften arbeiteten,
so ließen sich natürlich gleichzeitig mehrere solcher Figuren in Angriff nehmen,
wahrscheinlich verdienten aber diese Arbeitskräfte nicht einmal eine Drachme am
Tag und dann würden 120 Drachmen einer noch längeren Arbeitsdauer entsprechen.
In nur zehn Tagen kann eine Figur vom Erechtheionfries niemals und unter
keinen Umständen entstanden sein. Der Bildhauer würde in diesem Fall
180 Drachmen im Monat verdienen, also nicht weniger als das Sechsfache
des leitenden Architekten. Ein zweites greifbares Beispiel führt zu den gleichen
Resultaten: In der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts wird beim Bau des Asklepios-
tempels von Epidauros an den Bildhauer Timotheos für die Herstellung von drei Giebel-
akroterien, zwei in der Höhe von etwa i m und eines von 1,50 m, die Summe von
2240 Drachmen bezahlt2). In diesen Preis waren wahrscheinlich die Kosten für die
Modelle mit einbegriffen, weil sie in der Inschrift nicht besonders aufgeführt werden.
Die Aufstellung wurde gesondert mit 265 Drachmen bezahlt 3).. Wieder erhielt der
leitende Architekt nur eine Drachme täglich. Da nun diese drei Akroterien nach der
Inschrift in demselben Rechnungsjahr in Auftrag gegeben und aufgestellt worden zu
sein scheinen, bliebe selbst bei einem Abzug von 400 Drachmen Unkosten noch eine
Restsumme, die das Jahreseinkommen von mindestens fünf Arbeitern ausmachen
würde.
Man muß wenigstens versuchen, die Zahlen, die uns die Inschriften bieten,
in greifbare Realitäten umzusetzen, und darf nicht vor den daraus sich ergebenden
Folgen zurückschrecken, denn nur dann können sie uns auch bei der Klärung kunst-
historischer Fragen helfen. Man sage da nicht, es sei gleichgültig, ob ein Künstler an
einer Friesfigur 10 oder 60 Tage gearbeitet hat, denn hinter solchen Zahlen steht eine
prinzipielle Wertung, die die gesamte Anschauung beeinflussen muß. Ich würde Curtius
unbedenklich darin zustimmen, daß »allein die Gruppe der Tauschwestern auch dem
größten bildhauerischen Genie, der größten technischen Begabung Jahre gekostet
haben muß« 4). Eine andere Frage ist es, ob die Ausführung dieser Gruppe wirklich
Jahre gedauert hat. An einer so großen Gruppe mußten sicher viele Hände schaffen,
während an einer kleinen Friesfigur vom Erechtheion immer nur ein Mann arbeiten
konnte.
’) Rumpf, Jdl. 40, 1925, 35 Anm. 4. 1926, 88. Weitere Literatur, ebenda 82 Anm. 2.
») IG. IV Nr.. 1484 S. 322 Zeile 90. Baunack, Aus 3) IG. IV Nr. 1484 S. 322 Zeile 101.
Epidauros 35 . u. 51. Neugebauer. Jdl. 41, 4) L. Curtius, Gnomon 2, 1926, 27.