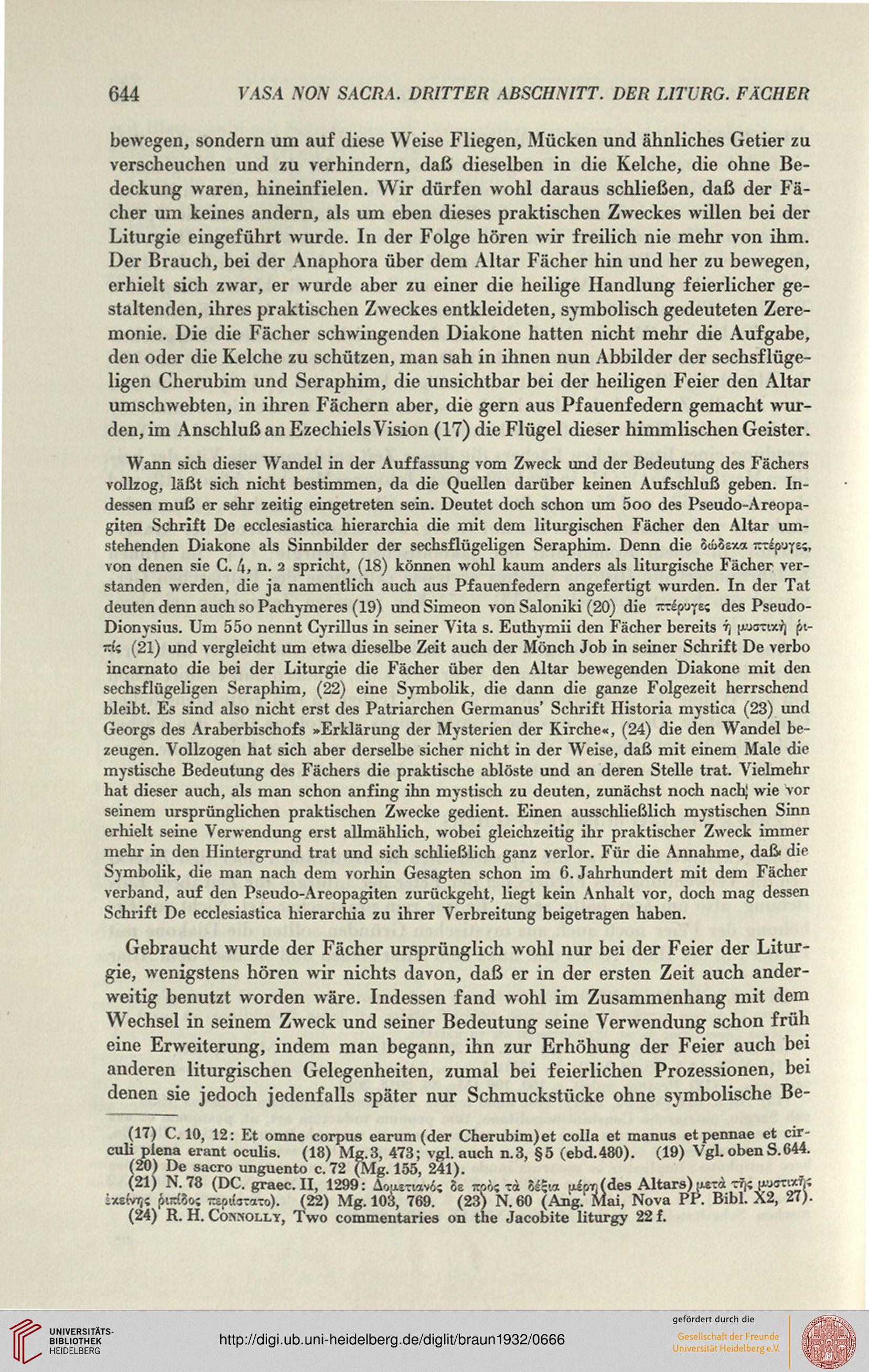644 VASA NON SACRA. DRITTER ABSCHNITT. DER UTVRG. FÄCHER
bewegen, sondern um auf diese Weise Fliegen, Mücken und ähnliches Getier zu
verscheuchen und zu verhindern, daß dieselben in die Kelche, die ohne Be-
deckung waren, hineinfielen. Wir dürfen wohl daraus schließen, daß der Fä-
cher um keines andern, als um eben dieses praktischen Zweckes willen bei der
Liturgie eingeführt wurde. In der Folge hören wir freilich nie mehr von ihm.
Der Brauch, bei der Anaphora über dem Altar Fächer hin und her zu bewegen,
erhielt sich zwar, er wurde aber zu einer die heilige Handlung feierlicher ge-
staltenden, ihres praktischen Zweckes entkleideten, symbolisch gedeuteten Zere-
monie. Die die Fächer schwingenden Diakone hatten nicht mehr die Aufgabe,
den oder die Kelche zu schützen, man sah in ihnen nun Abbilder der sechsflüge-
ligen Cherubim und Seraphim, die unsichtbar bei der heiligen Feier den Altar
umschwebten, in ihren Fächern aber, die gern aus Pfauenfedern gemacht wur-
den, im Anschluß an Ezechiels Vision (17) die Flügel dieser himmlischen Geister.
Wann sich dieser Wandel in der Auffassung vom Zweck und der Bedeutung des Fächers
vollzog, läßt sich nicht bestimmen, da die Quellen darüber keinen Aufschluß geben. In-
dessen muß er sehr zeitig eingetreten sein. Deutet doch schon um 5oo des Pseudo-Areopa-
giten Schrift De ecclesiastica hierarchia die mit dem liturgischen Fächer den Altar um-
stehenden Diakone als Sinnbilder der sechsflügeligen Seraphim. Denn die oti>5sxa rctipvve«,
von denen sie C. I\, n. 2 spricht, (18) können wohl kaum anders als liturgische Fächer ver-
standen werden, die ja namentlich auch aus Pfauenfedern angefertigt wurden. In der Tat
deuten denn auch so Pachymeres (19) und Simeon von Saloniki (20) die -xzlp-jyK des Pseudo-
Dionysius. Um 55o nennt Gyrillus in seiner Vita s. Euthymii den Fächer bereits r, |«3tix*| $1-
r& (21) und vergleicht um etwa dieselbe Zeit auch der Mönch Job in seiner Schrift De verbo
incarnato die bei der Liturgie die Fächer über den Altar bewegenden Diakone mit den
sechsflügeligen Seraphim, (22) eine Symbolik, die dann die ganze Folgezeit herrschend
bleibt. Es sind also nicht erst des Patriarchen Germanus' Schrift Historia mystica (23) und
Georgs des Araberbischofs -Erklärung der Mysterien der Kirche«, (24) die den Wandel be-
zeugen. Vollzogen hat sich aber derselbe sicher nicht in der Weise, daß mit einem Male die
mystische Bedeutung des Fächers die praktische ablöste und an deren Stelle trat. Vielmehr
hat dieser auch, als man schon anfing ihn mystisch zu deuten, zunächst noch nach; wie vor
seinem ursprünglichen praktischen Zwecke gedient. Einen ausschließlich mystischen Sinn
erhielt seine Verwendung erst allmählich, wobei gleichzeitig ihr praktischer Zweck immer
mehr in den Hintergrund trat und sich schließlich ganz verlor. Für die Annahme, daß die
Symbolik, die man nach dem vorhin Gesagten schon im 6. Jahrhundert mit dem Fächer
verband, auf den Pseudo-Areopagiten zurückgeht, liegt kein Anhalt vor, doch mag dessen
Schrift De ecclesiastica hierarchia zu ihrer Verbreitung beigetragen haben.
Gebraucht wurde der Fächer ursprünglich wohl nur bei der Feier der Litur-
gie, wenigstens hören wir nichts davon, daß er in der ersten Zeit auch ander-
weitig benutzt worden wäre. Indessen fand wohl im Zusammenhang mit dem
Wechsel in seinem Zweck und seiner Bedeutung seine Verwendung schon früh
eine Erweiterung, indem man begann, ihn zur Erhöhung der Feier auch bei
anderen liturgischen Gelegenheiten, zumal bei feierlichen Prozessionen, bei
denen sie jedoch jedenfalls später nur Schmuckstücke ohne symbolische Be-
(17) C.10, 12; Et omne corpus earum(der Cherubim) et colla et manus etpennae et cir-
culi ptena erant oculis. <18) Mg.3, 473; vgl. auch n.3, §5 (ebd.480). (19) Vgl. obenS.644.
(m De sacro unguento c. 72 (Mg. 155, 241).
(21) N.78 (DC. graec. II, 1299: Süiwmv«« Ss nptctä WEw pim (des Altars) u*tä iftj (»««*
i«wj; jiiriS« mptbroco). (22) Mg. 103, 769. (23) N. 60 (Aug. Mai, Nova PP. Bibl. X2, 27).
(24) R. H. Cohkollt, Two commentaries on the Jaeobite iiturgy 22 f.
bewegen, sondern um auf diese Weise Fliegen, Mücken und ähnliches Getier zu
verscheuchen und zu verhindern, daß dieselben in die Kelche, die ohne Be-
deckung waren, hineinfielen. Wir dürfen wohl daraus schließen, daß der Fä-
cher um keines andern, als um eben dieses praktischen Zweckes willen bei der
Liturgie eingeführt wurde. In der Folge hören wir freilich nie mehr von ihm.
Der Brauch, bei der Anaphora über dem Altar Fächer hin und her zu bewegen,
erhielt sich zwar, er wurde aber zu einer die heilige Handlung feierlicher ge-
staltenden, ihres praktischen Zweckes entkleideten, symbolisch gedeuteten Zere-
monie. Die die Fächer schwingenden Diakone hatten nicht mehr die Aufgabe,
den oder die Kelche zu schützen, man sah in ihnen nun Abbilder der sechsflüge-
ligen Cherubim und Seraphim, die unsichtbar bei der heiligen Feier den Altar
umschwebten, in ihren Fächern aber, die gern aus Pfauenfedern gemacht wur-
den, im Anschluß an Ezechiels Vision (17) die Flügel dieser himmlischen Geister.
Wann sich dieser Wandel in der Auffassung vom Zweck und der Bedeutung des Fächers
vollzog, läßt sich nicht bestimmen, da die Quellen darüber keinen Aufschluß geben. In-
dessen muß er sehr zeitig eingetreten sein. Deutet doch schon um 5oo des Pseudo-Areopa-
giten Schrift De ecclesiastica hierarchia die mit dem liturgischen Fächer den Altar um-
stehenden Diakone als Sinnbilder der sechsflügeligen Seraphim. Denn die oti>5sxa rctipvve«,
von denen sie C. I\, n. 2 spricht, (18) können wohl kaum anders als liturgische Fächer ver-
standen werden, die ja namentlich auch aus Pfauenfedern angefertigt wurden. In der Tat
deuten denn auch so Pachymeres (19) und Simeon von Saloniki (20) die -xzlp-jyK des Pseudo-
Dionysius. Um 55o nennt Gyrillus in seiner Vita s. Euthymii den Fächer bereits r, |«3tix*| $1-
r& (21) und vergleicht um etwa dieselbe Zeit auch der Mönch Job in seiner Schrift De verbo
incarnato die bei der Liturgie die Fächer über den Altar bewegenden Diakone mit den
sechsflügeligen Seraphim, (22) eine Symbolik, die dann die ganze Folgezeit herrschend
bleibt. Es sind also nicht erst des Patriarchen Germanus' Schrift Historia mystica (23) und
Georgs des Araberbischofs -Erklärung der Mysterien der Kirche«, (24) die den Wandel be-
zeugen. Vollzogen hat sich aber derselbe sicher nicht in der Weise, daß mit einem Male die
mystische Bedeutung des Fächers die praktische ablöste und an deren Stelle trat. Vielmehr
hat dieser auch, als man schon anfing ihn mystisch zu deuten, zunächst noch nach; wie vor
seinem ursprünglichen praktischen Zwecke gedient. Einen ausschließlich mystischen Sinn
erhielt seine Verwendung erst allmählich, wobei gleichzeitig ihr praktischer Zweck immer
mehr in den Hintergrund trat und sich schließlich ganz verlor. Für die Annahme, daß die
Symbolik, die man nach dem vorhin Gesagten schon im 6. Jahrhundert mit dem Fächer
verband, auf den Pseudo-Areopagiten zurückgeht, liegt kein Anhalt vor, doch mag dessen
Schrift De ecclesiastica hierarchia zu ihrer Verbreitung beigetragen haben.
Gebraucht wurde der Fächer ursprünglich wohl nur bei der Feier der Litur-
gie, wenigstens hören wir nichts davon, daß er in der ersten Zeit auch ander-
weitig benutzt worden wäre. Indessen fand wohl im Zusammenhang mit dem
Wechsel in seinem Zweck und seiner Bedeutung seine Verwendung schon früh
eine Erweiterung, indem man begann, ihn zur Erhöhung der Feier auch bei
anderen liturgischen Gelegenheiten, zumal bei feierlichen Prozessionen, bei
denen sie jedoch jedenfalls später nur Schmuckstücke ohne symbolische Be-
(17) C.10, 12; Et omne corpus earum(der Cherubim) et colla et manus etpennae et cir-
culi ptena erant oculis. <18) Mg.3, 473; vgl. auch n.3, §5 (ebd.480). (19) Vgl. obenS.644.
(m De sacro unguento c. 72 (Mg. 155, 241).
(21) N.78 (DC. graec. II, 1299: Süiwmv«« Ss nptctä WEw pim (des Altars) u*tä iftj (»««*
i«wj; jiiriS« mptbroco). (22) Mg. 103, 769. (23) N. 60 (Aug. Mai, Nova PP. Bibl. X2, 27).
(24) R. H. Cohkollt, Two commentaries on the Jaeobite iiturgy 22 f.