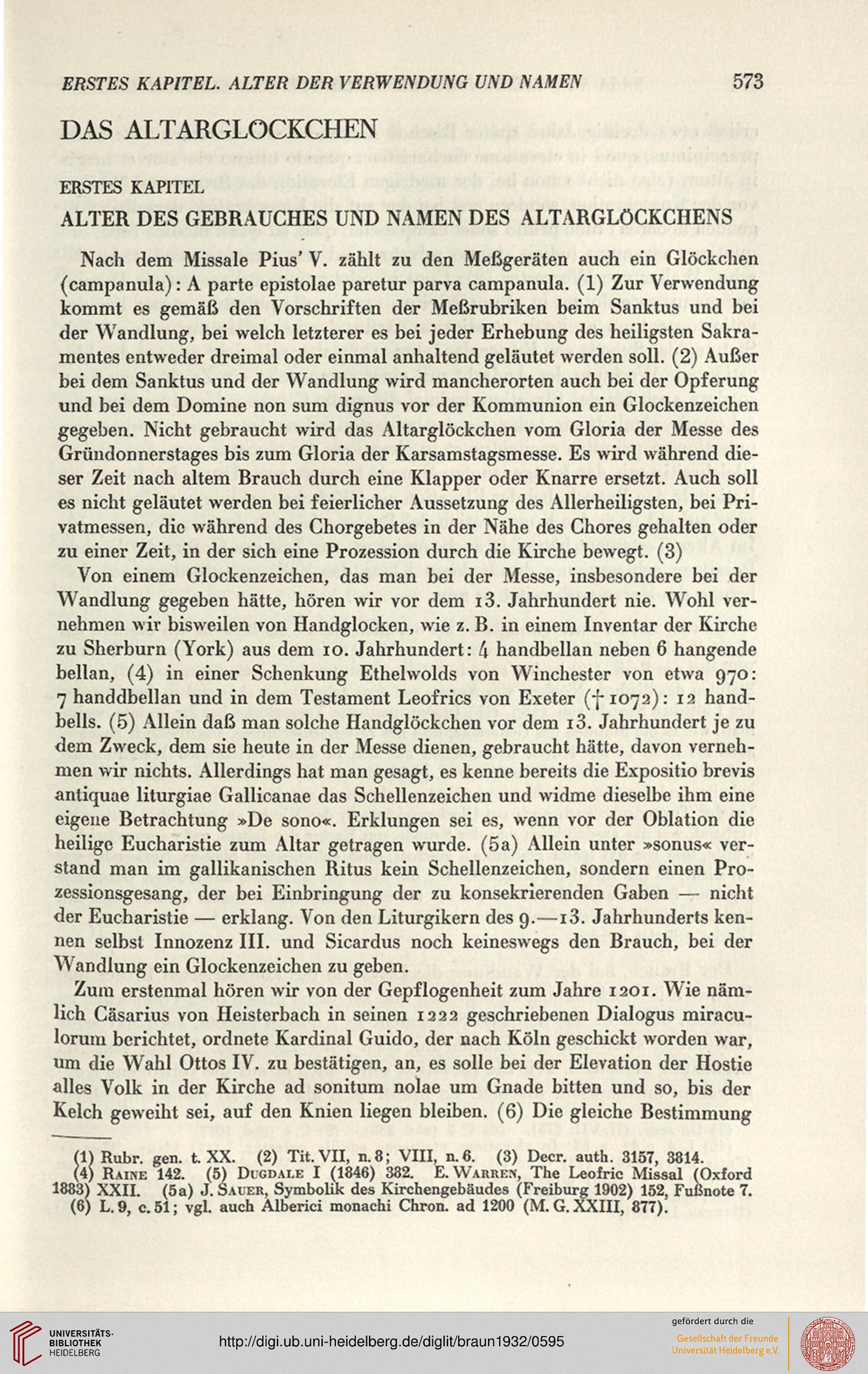ERSTES KAPITEL. ALTER DER VERWENDUNG UND NAMEN 573
DAS ALTÄRGLOCKCHEN
ERSTES KAPITEL
ALTER DES GEBRAUCHES UND NAMEN DES ALTARGLÖCKCHENS
Nach dem Missale Pius' V. zählt zu den Meßgeräten auch ein Glöckchen
(campanula): A parte epistolae paretur parva campanula. (1) Zur Verwendung
kommt es gemäß den Vorschriften der Meßrubriken beim Sanktus und bei
der Wandlung, bei welch letzterer es bei jeder Erhebung des heiligsten Sakra-
mentes entweder dreimal oder einmal anhaltend geläutet werden soll. (2) Außer
bei dem Sanktus und der Wandlung wird mancherorten auch bei der Opferung
und bei dem Domine non sum dignus vor der Kommunion ein Glockenzeichen
gegeben. Nicht gebraucht wird das Altarglöckchen vom Gloria der Messe des
Gründonnerstages bis zum Gloria der Karsamstagsmesse. Es wird während die-
ser Zeit nach altem Brauch durch eine Klapper oder Knarre ersetzt. Auch soll
es nicht geläutet werden bei feierlicher Aussetzung des Aller heiligsten, bei Pri-
vatmessen, die während des Chorgebetes in der Nähe des Chores gehalten oder
zu einer Zeit, in der sich eine Prozession durch die Kirche bewegt. (3)
Von einem Glockenzeichen, das man bei der Messe, insbesondere bei der
Wandlung gegeben hätte, hören wir vor dem i3. Jahrhundert nie. Wohl ver-
nehmen wir bisweilen von Handglocken, wie z. B. in einem Inventar der Kirche
zu Sherburn (York) aus dem io. Jahrhundert: 4 handbellan neben 6 hangende
bellan, (4) in einer Schenkung Ethelwolds von Winchester von etwa 970:
7 handdbellan und in dem Testament Leofrics von Exeter (71072): 13 hand-
belis. (5) Allein daß man solche Handglöckchen vor dem i3. Jahrhundert je zu
dem Zweck, dem sie heute in der Messe dienen, gebraucht hätte, davon verneh-
men wir nichts. Allerdings hat man gesagt, es kenne bereits die Expositio brevis
anliquae liturgiae Gallicanae das Schellenzeichen und widme dieselbe ihm eine
eigene Betrachtung »De sono*. Erklungen sei es, wenn vor der Oblation die
heilige Eucharistie zum Altar getragen wurde. (5a) Allein unter »sonus« ver-
stand man im gallikanischen Ritus kein Schellenzeichen, sondern einen Pro-
zessionsgesang, der bei Einbringung der zu konsekrierenden Gaben — nicht
der Eucharistie — erklang. Von den Liturgikern des 9.—13. Jahrhunderts ken-
nen selbst Innozenz III. und Sicardus noch keineswegs den Brauch, bei der
Wandlung ein Glockenzeichen zu geben.
Zum erstenmal hören wir von der Gepflogenheit zum Jahre 1201. Wie näm-
lich Cäsarius von Heisterbach in seinen 1222 geschriebenen Dialogus miracu-
lorum berichtet, ordnete Kardinal Guido, der nach Köln geschickt worden war,
um die Wahl Ottos IV. zu bestätigen, an, es solle bei der Elevatum der Hostie
alles Volk in der Kirche ad sonitum nolae um Gnade bitten und so, bis der
Kelch geweiht sei, auf den Knien liegen bleiben. (6) Die gleiche Bestimmung
(1) Rubr. gen. t XX. (2) Tit. VII, n.8; VIII, n.6. (3) Deer. auth. 3157, 3814.
(4) Raine 142. (5) Digdale I (1846) 332. E. Warmes, The Leofric Missal (Oxford
1883) XXII. (5a) J. Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes (Freiburg 1902) 152, Fußnote 7.
(6) L. 9, c. 51; vgl. auch Alberici monachi Chron. ad 1200 (M. G. XXIII, 877).
DAS ALTÄRGLOCKCHEN
ERSTES KAPITEL
ALTER DES GEBRAUCHES UND NAMEN DES ALTARGLÖCKCHENS
Nach dem Missale Pius' V. zählt zu den Meßgeräten auch ein Glöckchen
(campanula): A parte epistolae paretur parva campanula. (1) Zur Verwendung
kommt es gemäß den Vorschriften der Meßrubriken beim Sanktus und bei
der Wandlung, bei welch letzterer es bei jeder Erhebung des heiligsten Sakra-
mentes entweder dreimal oder einmal anhaltend geläutet werden soll. (2) Außer
bei dem Sanktus und der Wandlung wird mancherorten auch bei der Opferung
und bei dem Domine non sum dignus vor der Kommunion ein Glockenzeichen
gegeben. Nicht gebraucht wird das Altarglöckchen vom Gloria der Messe des
Gründonnerstages bis zum Gloria der Karsamstagsmesse. Es wird während die-
ser Zeit nach altem Brauch durch eine Klapper oder Knarre ersetzt. Auch soll
es nicht geläutet werden bei feierlicher Aussetzung des Aller heiligsten, bei Pri-
vatmessen, die während des Chorgebetes in der Nähe des Chores gehalten oder
zu einer Zeit, in der sich eine Prozession durch die Kirche bewegt. (3)
Von einem Glockenzeichen, das man bei der Messe, insbesondere bei der
Wandlung gegeben hätte, hören wir vor dem i3. Jahrhundert nie. Wohl ver-
nehmen wir bisweilen von Handglocken, wie z. B. in einem Inventar der Kirche
zu Sherburn (York) aus dem io. Jahrhundert: 4 handbellan neben 6 hangende
bellan, (4) in einer Schenkung Ethelwolds von Winchester von etwa 970:
7 handdbellan und in dem Testament Leofrics von Exeter (71072): 13 hand-
belis. (5) Allein daß man solche Handglöckchen vor dem i3. Jahrhundert je zu
dem Zweck, dem sie heute in der Messe dienen, gebraucht hätte, davon verneh-
men wir nichts. Allerdings hat man gesagt, es kenne bereits die Expositio brevis
anliquae liturgiae Gallicanae das Schellenzeichen und widme dieselbe ihm eine
eigene Betrachtung »De sono*. Erklungen sei es, wenn vor der Oblation die
heilige Eucharistie zum Altar getragen wurde. (5a) Allein unter »sonus« ver-
stand man im gallikanischen Ritus kein Schellenzeichen, sondern einen Pro-
zessionsgesang, der bei Einbringung der zu konsekrierenden Gaben — nicht
der Eucharistie — erklang. Von den Liturgikern des 9.—13. Jahrhunderts ken-
nen selbst Innozenz III. und Sicardus noch keineswegs den Brauch, bei der
Wandlung ein Glockenzeichen zu geben.
Zum erstenmal hören wir von der Gepflogenheit zum Jahre 1201. Wie näm-
lich Cäsarius von Heisterbach in seinen 1222 geschriebenen Dialogus miracu-
lorum berichtet, ordnete Kardinal Guido, der nach Köln geschickt worden war,
um die Wahl Ottos IV. zu bestätigen, an, es solle bei der Elevatum der Hostie
alles Volk in der Kirche ad sonitum nolae um Gnade bitten und so, bis der
Kelch geweiht sei, auf den Knien liegen bleiben. (6) Die gleiche Bestimmung
(1) Rubr. gen. t XX. (2) Tit. VII, n.8; VIII, n.6. (3) Deer. auth. 3157, 3814.
(4) Raine 142. (5) Digdale I (1846) 332. E. Warmes, The Leofric Missal (Oxford
1883) XXII. (5a) J. Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes (Freiburg 1902) 152, Fußnote 7.
(6) L. 9, c. 51; vgl. auch Alberici monachi Chron. ad 1200 (M. G. XXIII, 877).