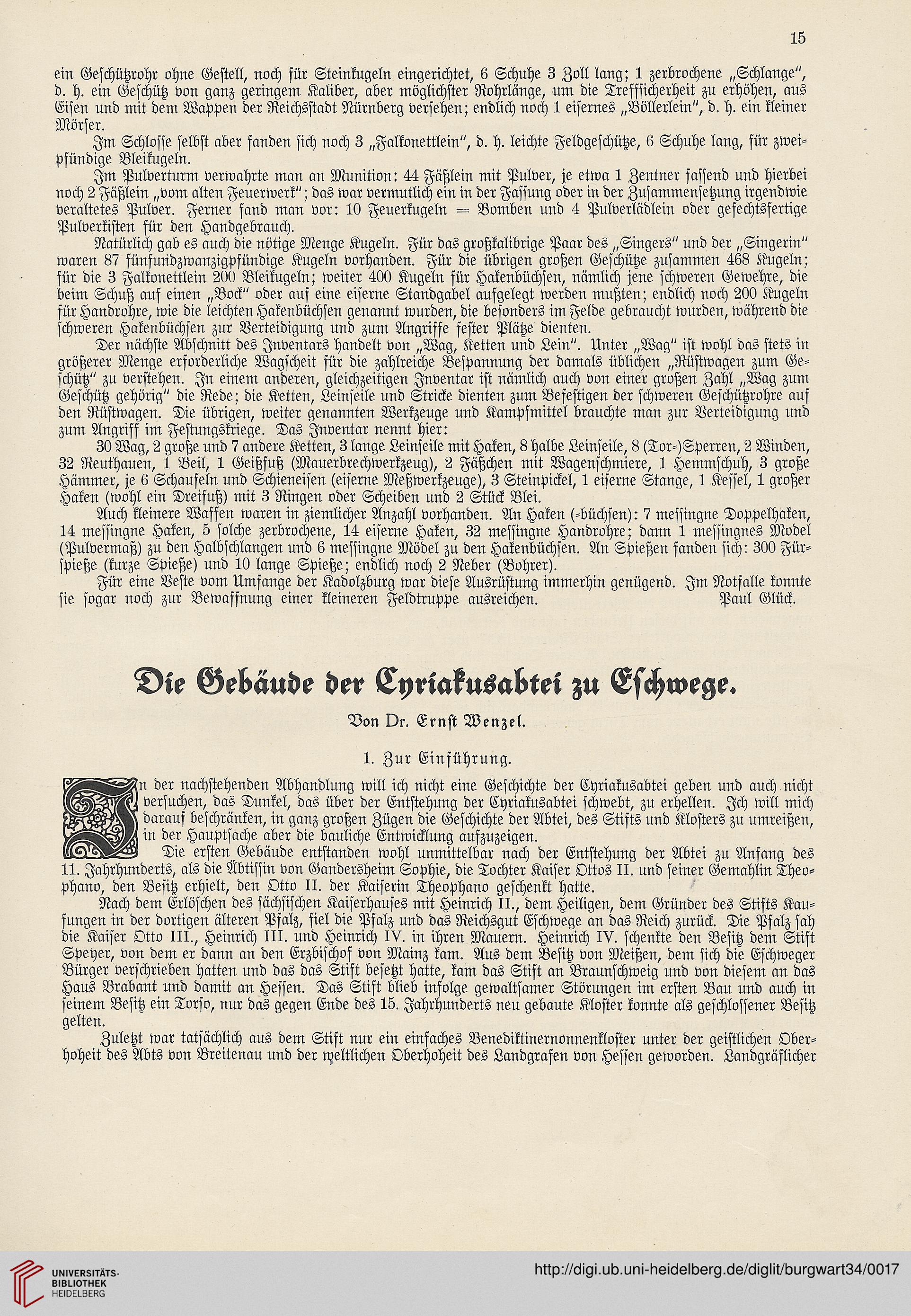15
ein Geschützrohr ohne Gestell, noch für Steinkugeln eingerichtet, 6 Schuhe 3 Zoll lang; 1 zerbrochene „Schlange",
d. h. ein Geschütz von ganz geringem Kaliber, aber möglichster Rohrlänge, um die Treffsicherheit zu erhöhen, aus
Eisen und mit dem Wappen der Reichsstadt Nürnberg versehen; endlich noch 1 eisernes „Böllerlein", d. h. ein kleiner
Mörser.
Im Schlosse selbst aber fanden sich noch 3 „Falkonettlein", d. h. leichte Feldgeschütze, 6 Schuhe lang, für zwei-
pfündige Bleikugeln.
Im Pulverturm verwahrte man an Munition: 44 Fäßlein mit Pulver, je etwa 1 Zentner fassend und hierbei
noch 2 Fäßlein „vom alten Feuerwerk"; das war vermutlich ein in der Fassung oder in der Zusammensetzung irgendwie
veraltetes Pulver. Ferner fand man vor: 10 Feuerkugeln — Bomben und 4 Pulverlädlein oder gefechtsfertige
Pulverkisten für den Handgebrauch.
Natürlich gab es auch die nötige Menge Kugeln. Für das großkalibrige Paar des „Singers" und der „Singerin"
waren 87 fünfundzwanzigpfündige Kugeln vorhanden. Für die übrigen großen Geschütze zusammen 468 Kugeln;
für die 3 Falkonettlein 200 Bleikugeln; weiter 400 Kugeln für Hakenbüchsen, nämlich jene schweren Gewehre, die
beim Schuß auf einen „Bock" oder aus eine eiserne Standgabel aufgelegt werden mußten; endlich noch 200 Kugeln
für Handrohre, wie die leichten Hakenbüchsen genannt wurden, die besonders im Felde gebraucht wurden, während die
schweren Hakenbüchsen zur Verteidigung und zum Angriffe fester Plätze dienten.
Der nächste Abschnitt des Inventars handelt von „Wag, Ketten und Lein". Unter „Wag" ist wohl das stets in
größerer Menge erforderliche Wagscheit für die zahlreiche Bespannung der damals üblichen „Rüstwagen zum Ge-
schütz" zu verstehen. In einem anderen, gleichzeitigen Inventar ist nämlich auch von einer großen Zahl „Wag zum
Geschütz gehörig" die Rede; die Ketten, Leinseile und Stricke dienten zum Befestigen der schweren Geschützrohre auf
den Rüstwagen. Die übrigen, weiter genannten Werkzeuge und Kampfmittel brauchte man zur Verteidigung und
zum Angriff im Festungskriege. Das Inventar nennt hier:
30 Wag, 2 große und 7 andere Ketten, 3 lange Leinseile mit Haken, 8 halbe Leinseile, 8 (Tor-)Sperren, 2 Winden,
32 Reuthauen, 1 Beil, 1 Geißfuß (Mauerbrechwerkzeug), 2 Füßchen mit Wagenschmiere, 1 Hemmschuh, 3 große
Hümmer, je 6 Schaufeln und Schieneisen (eiserne Meßwerkzeuge), 3 Steinpickel, 1 eiserne Stange, 1 Kessel, 1 großer
Haken (wohl ein Dreifuß) mit 3 Ringen oder Scheiben und 2 Stück Blei.
Auch kleinere Waffen waren in ziemlicher Anzahl vorhanden. An Haken (-büchsen): 7 messingne Doppelhaken,
14 messingne Haken, 5 solche zerbrochene, 14 eiserne Haken, 32 messingne Handrohre; dann 1 messingnes Model
(Pulvermaß) zu den Halbschlangen und 6 messingne Mödel zu den Hakenbüchsen. An Spießen fanden sich: 300 Für-
spieße (kurze Spieße) und 10 lange Spieße; endlich noch 2 Neber (Bohrer).
Für eine Beste vom Umfange der Kadolzburg war diese Ausrüstung immerhin genügend. Im Notfälle konnte
sie sogar noch zur Bewaffnung einer kleineren Feldtruppe ausreichen. Paul Glück.
Die Gebäude der Cyriakusabtei zu Eschwege.
Von Or. Ernst Wenzel.
1. Zur Einführung.
n der nachstehenden Abhandlung will ich nicht eine Geschichte der Cyriakusabtei geben und auch nicht
versuchen, das Dunkel, das über der Entstehung der Cyriakusabtei schwebt, zu erhellen. Ich will mich
darauf beschränken, in ganz großen Zügen die Geschichte der Abtei, des Stifts und Klosters zu umreißeu,
in der Hauptsache aber die bauliche Entwicklung aufzuzeigen.
Die ersten Gebäude entstanden wohl unmittelbar nach der Entstehung der Abtei zu Anfang des
11. Jahrhunderts, als die Äbtissin von Gandersheim Sophie, die Tochter Kaiser Ottos II. und seiner Gemahlin Theo-
phano, den Besitz erhielt, den Otto II. der Kaiserin Theophano geschenkt hatte.
Nach dem Erlöschen des sächsischen Kaiserhauses mit Heinrich II., dem Heiligen, dem Gründer des Stifts Kau-
fungen in der dortigen älteren Pfalz, fiel die Pfalz und das Reichsgut Eschwege an das Reich zurück. Die Pfalz sah
die Kaiser Otto III., Heinrich III. und Heinrich IV. in ihren Mauern. Heinrich IV. schenkte den Besitz dem Stift
Speyer, von dem er dann an den Erzbischof von Mainz kam. Ans dem Besitz von Meißen, dem sich die Eschweger
Bürger verschrieben hatten und das das Stift besetzt hatte, kam das Stift an Braunschweig und von diesem an das
Haus Brabant und damit an Hessen. Das Stift blieb infolge gewaltsamer Störungen im ersten Bau und auch in
seinem Besitz ein Torso, nur das gegen Ende des 15. Jahrhunderts neu gebaute Kloster konnte als geschlossener Besitz
gelten.
Zuletzt war tatsächlich aus dem Stift nur ein einfaches Benediktinernonnenkloster unter der geistlichen Ober-
hoheit des Abts von Breitenau und der Weltlichen Oberhoheit des Landgrafen von Hessen geworden. Landgräflicher
ein Geschützrohr ohne Gestell, noch für Steinkugeln eingerichtet, 6 Schuhe 3 Zoll lang; 1 zerbrochene „Schlange",
d. h. ein Geschütz von ganz geringem Kaliber, aber möglichster Rohrlänge, um die Treffsicherheit zu erhöhen, aus
Eisen und mit dem Wappen der Reichsstadt Nürnberg versehen; endlich noch 1 eisernes „Böllerlein", d. h. ein kleiner
Mörser.
Im Schlosse selbst aber fanden sich noch 3 „Falkonettlein", d. h. leichte Feldgeschütze, 6 Schuhe lang, für zwei-
pfündige Bleikugeln.
Im Pulverturm verwahrte man an Munition: 44 Fäßlein mit Pulver, je etwa 1 Zentner fassend und hierbei
noch 2 Fäßlein „vom alten Feuerwerk"; das war vermutlich ein in der Fassung oder in der Zusammensetzung irgendwie
veraltetes Pulver. Ferner fand man vor: 10 Feuerkugeln — Bomben und 4 Pulverlädlein oder gefechtsfertige
Pulverkisten für den Handgebrauch.
Natürlich gab es auch die nötige Menge Kugeln. Für das großkalibrige Paar des „Singers" und der „Singerin"
waren 87 fünfundzwanzigpfündige Kugeln vorhanden. Für die übrigen großen Geschütze zusammen 468 Kugeln;
für die 3 Falkonettlein 200 Bleikugeln; weiter 400 Kugeln für Hakenbüchsen, nämlich jene schweren Gewehre, die
beim Schuß auf einen „Bock" oder aus eine eiserne Standgabel aufgelegt werden mußten; endlich noch 200 Kugeln
für Handrohre, wie die leichten Hakenbüchsen genannt wurden, die besonders im Felde gebraucht wurden, während die
schweren Hakenbüchsen zur Verteidigung und zum Angriffe fester Plätze dienten.
Der nächste Abschnitt des Inventars handelt von „Wag, Ketten und Lein". Unter „Wag" ist wohl das stets in
größerer Menge erforderliche Wagscheit für die zahlreiche Bespannung der damals üblichen „Rüstwagen zum Ge-
schütz" zu verstehen. In einem anderen, gleichzeitigen Inventar ist nämlich auch von einer großen Zahl „Wag zum
Geschütz gehörig" die Rede; die Ketten, Leinseile und Stricke dienten zum Befestigen der schweren Geschützrohre auf
den Rüstwagen. Die übrigen, weiter genannten Werkzeuge und Kampfmittel brauchte man zur Verteidigung und
zum Angriff im Festungskriege. Das Inventar nennt hier:
30 Wag, 2 große und 7 andere Ketten, 3 lange Leinseile mit Haken, 8 halbe Leinseile, 8 (Tor-)Sperren, 2 Winden,
32 Reuthauen, 1 Beil, 1 Geißfuß (Mauerbrechwerkzeug), 2 Füßchen mit Wagenschmiere, 1 Hemmschuh, 3 große
Hümmer, je 6 Schaufeln und Schieneisen (eiserne Meßwerkzeuge), 3 Steinpickel, 1 eiserne Stange, 1 Kessel, 1 großer
Haken (wohl ein Dreifuß) mit 3 Ringen oder Scheiben und 2 Stück Blei.
Auch kleinere Waffen waren in ziemlicher Anzahl vorhanden. An Haken (-büchsen): 7 messingne Doppelhaken,
14 messingne Haken, 5 solche zerbrochene, 14 eiserne Haken, 32 messingne Handrohre; dann 1 messingnes Model
(Pulvermaß) zu den Halbschlangen und 6 messingne Mödel zu den Hakenbüchsen. An Spießen fanden sich: 300 Für-
spieße (kurze Spieße) und 10 lange Spieße; endlich noch 2 Neber (Bohrer).
Für eine Beste vom Umfange der Kadolzburg war diese Ausrüstung immerhin genügend. Im Notfälle konnte
sie sogar noch zur Bewaffnung einer kleineren Feldtruppe ausreichen. Paul Glück.
Die Gebäude der Cyriakusabtei zu Eschwege.
Von Or. Ernst Wenzel.
1. Zur Einführung.
n der nachstehenden Abhandlung will ich nicht eine Geschichte der Cyriakusabtei geben und auch nicht
versuchen, das Dunkel, das über der Entstehung der Cyriakusabtei schwebt, zu erhellen. Ich will mich
darauf beschränken, in ganz großen Zügen die Geschichte der Abtei, des Stifts und Klosters zu umreißeu,
in der Hauptsache aber die bauliche Entwicklung aufzuzeigen.
Die ersten Gebäude entstanden wohl unmittelbar nach der Entstehung der Abtei zu Anfang des
11. Jahrhunderts, als die Äbtissin von Gandersheim Sophie, die Tochter Kaiser Ottos II. und seiner Gemahlin Theo-
phano, den Besitz erhielt, den Otto II. der Kaiserin Theophano geschenkt hatte.
Nach dem Erlöschen des sächsischen Kaiserhauses mit Heinrich II., dem Heiligen, dem Gründer des Stifts Kau-
fungen in der dortigen älteren Pfalz, fiel die Pfalz und das Reichsgut Eschwege an das Reich zurück. Die Pfalz sah
die Kaiser Otto III., Heinrich III. und Heinrich IV. in ihren Mauern. Heinrich IV. schenkte den Besitz dem Stift
Speyer, von dem er dann an den Erzbischof von Mainz kam. Ans dem Besitz von Meißen, dem sich die Eschweger
Bürger verschrieben hatten und das das Stift besetzt hatte, kam das Stift an Braunschweig und von diesem an das
Haus Brabant und damit an Hessen. Das Stift blieb infolge gewaltsamer Störungen im ersten Bau und auch in
seinem Besitz ein Torso, nur das gegen Ende des 15. Jahrhunderts neu gebaute Kloster konnte als geschlossener Besitz
gelten.
Zuletzt war tatsächlich aus dem Stift nur ein einfaches Benediktinernonnenkloster unter der geistlichen Ober-
hoheit des Abts von Breitenau und der Weltlichen Oberhoheit des Landgrafen von Hessen geworden. Landgräflicher