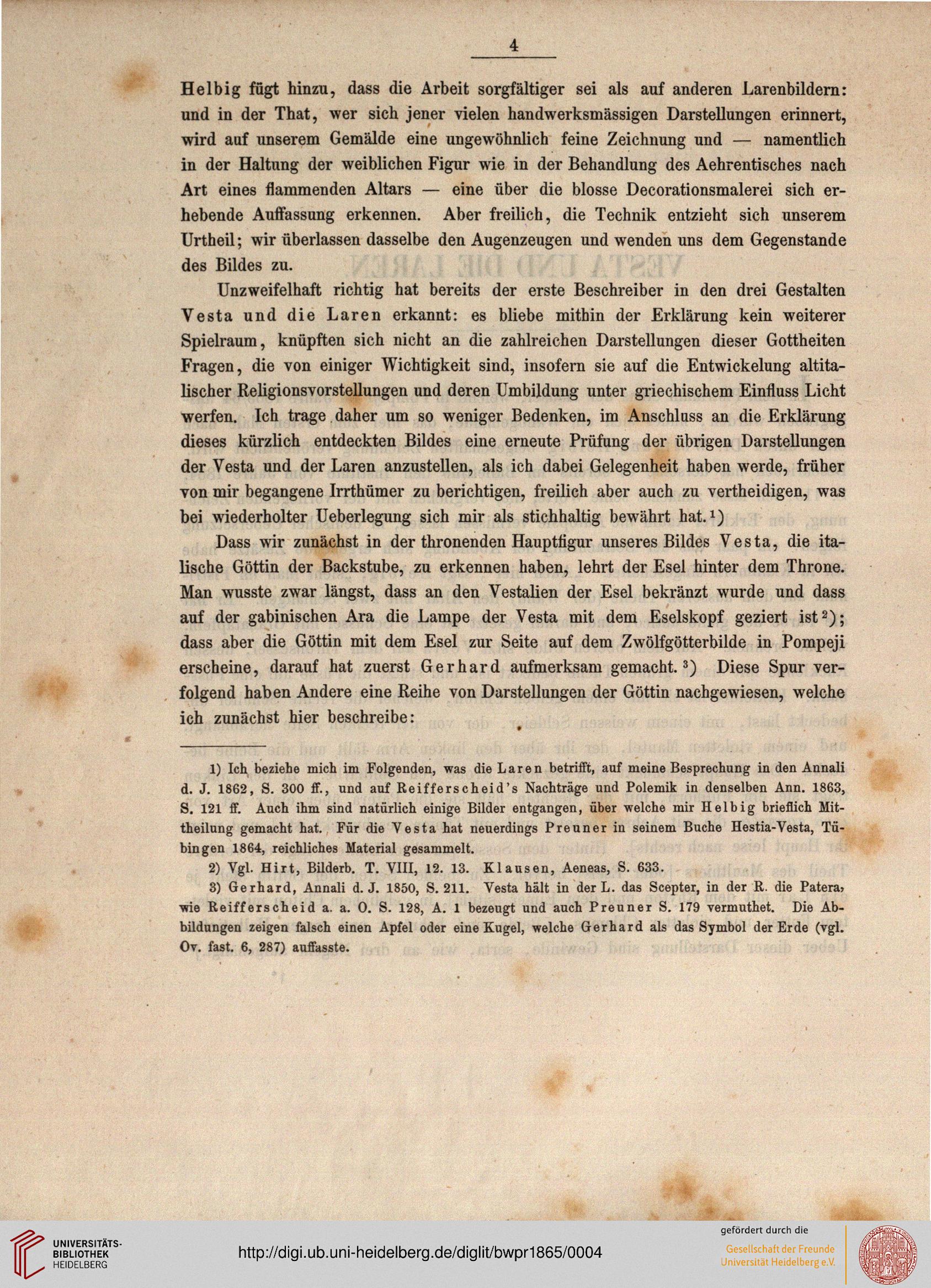Heibig fügt hinzu, dass die Arbeit sorgfältiger sei als auf anderen Larenbildern:
und in der That, wer sich jener vielen handwerksmässigen Darstellungen erinnert,
wird auf unserem Gemälde eine ungewöhnlich feine Zeichnung und — namentlich
in der Haltung der weiblichen Figur wie in der Behandlung des Aehrentisches nach
Art eines flammenden Altars — eine über die blosse Decorationsmalerei sich er-
hebende Auffassung erkennen. Aber freilich, die Technik entzieht sich unserem
Urtheil; wir überlassen dasselbe den Augenzeugen und wenden uns dem Gegenstande
des Bildes zu.
Unzweifelhaft richtig hat bereits der erste Beschreiber in den drei Gestalten
Vesta und die Laren erkannt: es bliebe mithin der Erklärung kein weiterer
Spielraum, knüpften sich nicht an die zahlreichen Darstellungen dieser Gottheiten
Fragen, die von einiger Wichtigkeit sind, insofern sie auf die Entwickelung altita-
lischer Religionsvorstellungen und deren Umbildung unter griechischem Einfluss Licht
werfen. Ich trage daher um so weniger Bedenken, im Anschluss an die Erklärung
dieses kürzlich entdeckten Bildes eine erneute Prüfung der übrigen Darstellungen
der Vesta und der Laren anzustellen, als ich dabei Gelegenheit haben werde, früher
von mir begangene Irrthümer zu berichtigen, freilich aber auch zu vertheidigen, was
bei wiederholter Ueberlegung sich mir als stichhaltig bewährt hat.1)
Dass wir zunächst in der thronenden Hauptfigur unseres Bildes Vesta, die ita-
lische Göttin der Backstube, zu erkennen haben, lehrt der Esel hinter dem Throne.
Man wusste zwar längst, dass an den Vestalien der Esel bekränzt wurde und dass
auf der gabinischen Ära die Lampe der Vesta mit dem Eselskopf geziert ist2);
dass aber die Göttin mit dem Esel zur Seite auf dem Zwölfgötterbilde in Pompeji
erscheine, darauf hat zuerst Gerhard aufmerksam gemacht.3) Diese Spur ver-
folgend haben Andere eine Reihe von Darstellungen der Göttin nachgewiesen, welche
ich zunächst hier beschreibe:
1) Ich beziehe mich im Folgenden, was die Laren betrifft, auf meine Besprechung in den Annali
d. J. 1862, S. 300 ff., und auf Reifferscheid's Nachträge und Polemik in denselben Ann. 1863,
S. 121 ff. Auch ihm sind natürlich einige Bilder entgangen, über welche mir Heibig brieflich Mit-
theilung gemacht hat. Für die Vesta hat neuerdings Preuner in seinem Buche Hestia-Vesta, Tü-
bingen 1864, reichliches Material gesammelt.
2) Vgl. Hirt, BUderb. T. VIII, 12. 13. Klausen, Aeneas, S. 633.
3) Gerhard, Annali d. J. 1850, S. 211. Vesta hält in derL. das Scepter, in der R. die Patera,
wie Reifferscheid a. a. 0. S. 128, A. 1 bezeugt und auch Preuner S. 179 yermuthet. Die Ab-
bildungen zeigen falsch einen Apfel oder eine Kugel, welche Gerhard als das Symbol der Erde (vgl.
Ov. fast. 6, 287) auffasste.
und in der That, wer sich jener vielen handwerksmässigen Darstellungen erinnert,
wird auf unserem Gemälde eine ungewöhnlich feine Zeichnung und — namentlich
in der Haltung der weiblichen Figur wie in der Behandlung des Aehrentisches nach
Art eines flammenden Altars — eine über die blosse Decorationsmalerei sich er-
hebende Auffassung erkennen. Aber freilich, die Technik entzieht sich unserem
Urtheil; wir überlassen dasselbe den Augenzeugen und wenden uns dem Gegenstande
des Bildes zu.
Unzweifelhaft richtig hat bereits der erste Beschreiber in den drei Gestalten
Vesta und die Laren erkannt: es bliebe mithin der Erklärung kein weiterer
Spielraum, knüpften sich nicht an die zahlreichen Darstellungen dieser Gottheiten
Fragen, die von einiger Wichtigkeit sind, insofern sie auf die Entwickelung altita-
lischer Religionsvorstellungen und deren Umbildung unter griechischem Einfluss Licht
werfen. Ich trage daher um so weniger Bedenken, im Anschluss an die Erklärung
dieses kürzlich entdeckten Bildes eine erneute Prüfung der übrigen Darstellungen
der Vesta und der Laren anzustellen, als ich dabei Gelegenheit haben werde, früher
von mir begangene Irrthümer zu berichtigen, freilich aber auch zu vertheidigen, was
bei wiederholter Ueberlegung sich mir als stichhaltig bewährt hat.1)
Dass wir zunächst in der thronenden Hauptfigur unseres Bildes Vesta, die ita-
lische Göttin der Backstube, zu erkennen haben, lehrt der Esel hinter dem Throne.
Man wusste zwar längst, dass an den Vestalien der Esel bekränzt wurde und dass
auf der gabinischen Ära die Lampe der Vesta mit dem Eselskopf geziert ist2);
dass aber die Göttin mit dem Esel zur Seite auf dem Zwölfgötterbilde in Pompeji
erscheine, darauf hat zuerst Gerhard aufmerksam gemacht.3) Diese Spur ver-
folgend haben Andere eine Reihe von Darstellungen der Göttin nachgewiesen, welche
ich zunächst hier beschreibe:
1) Ich beziehe mich im Folgenden, was die Laren betrifft, auf meine Besprechung in den Annali
d. J. 1862, S. 300 ff., und auf Reifferscheid's Nachträge und Polemik in denselben Ann. 1863,
S. 121 ff. Auch ihm sind natürlich einige Bilder entgangen, über welche mir Heibig brieflich Mit-
theilung gemacht hat. Für die Vesta hat neuerdings Preuner in seinem Buche Hestia-Vesta, Tü-
bingen 1864, reichliches Material gesammelt.
2) Vgl. Hirt, BUderb. T. VIII, 12. 13. Klausen, Aeneas, S. 633.
3) Gerhard, Annali d. J. 1850, S. 211. Vesta hält in derL. das Scepter, in der R. die Patera,
wie Reifferscheid a. a. 0. S. 128, A. 1 bezeugt und auch Preuner S. 179 yermuthet. Die Ab-
bildungen zeigen falsch einen Apfel oder eine Kugel, welche Gerhard als das Symbol der Erde (vgl.
Ov. fast. 6, 287) auffasste.