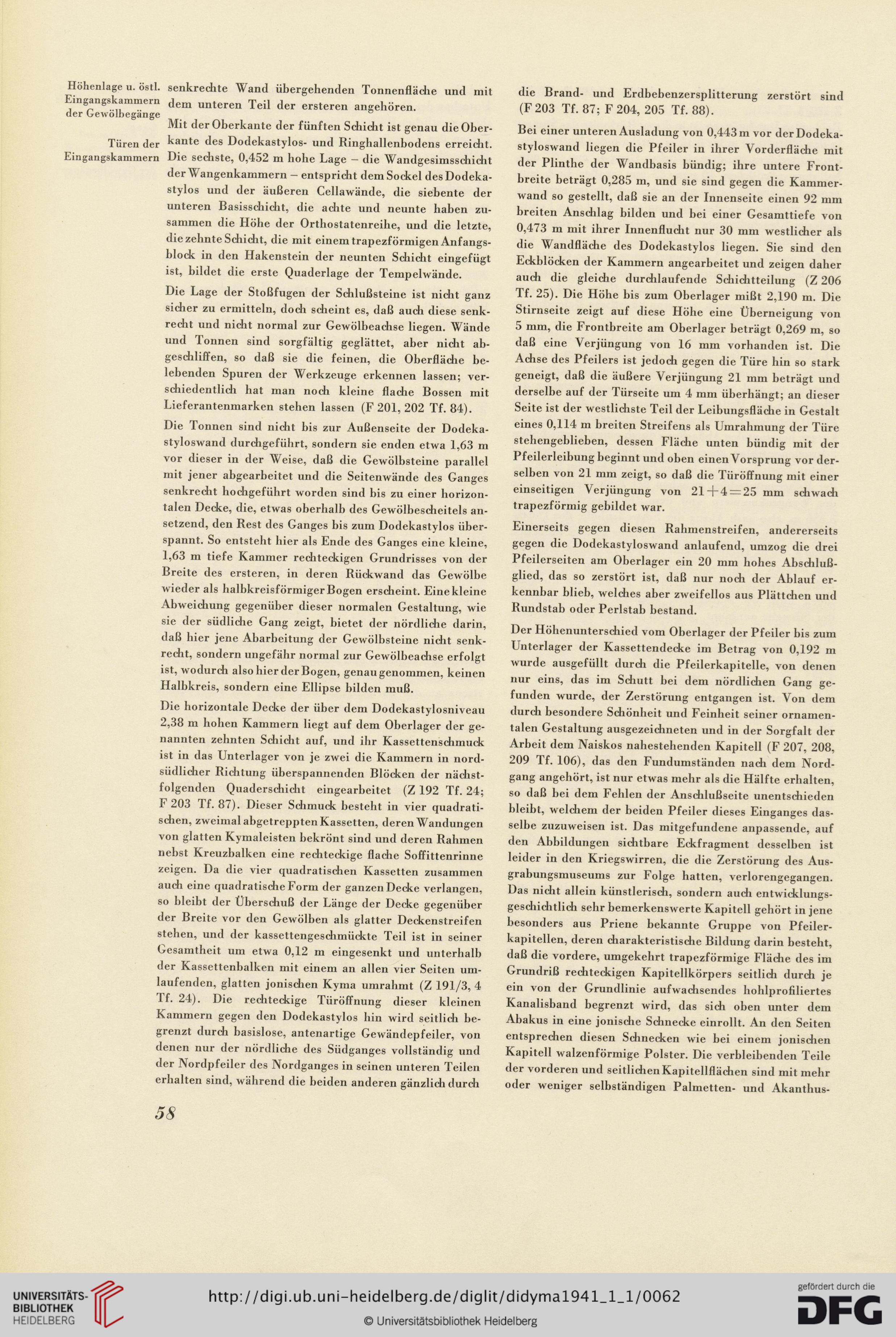Höhenlage u. östl. senkrechte Wand übergehenden Tonnenfläche und mit
I'.ingangskammern (Jem unteren Teil der ersteren angehören.
der Gewölbegänge
Mit der Oberkante der fiinften Schicht ist genau dieOber-
Türen der kante des Dodekastylos- und Ringhallenbodens erreicht.
Eingangskammern Die sechste, 0,452 m hohe Lage — die Wandgesimsschicht
der Wangenkammern — entspricht demSockel desDodeka-
stylos und der äußeren Cellawände, die siebente der
unteren Basisschicbt, die achte und neunte haben zu-
sammen die Höhe der Orthostatenreihe, und die letzte,
diezehnteSchicht, die mit einemtrapezförmigen Anfangs-
block in den Hakenstein der neunten Schicht eingefügt
ist, bildet die erste Quaderlage der Tempelwände.
Die Lage der Stoßfugen der Schlußsteine ist nicht ganz
sicher zu ermitteln, doch scheint es, daß auch diese senk-
recht und nicht normal zur Gewölbeachse liegen. Wände
und Tonnen sind sorgfältig geglättet, aber nicht ab-
geschliffen, so daß sie die feinen, die Oberfläche be-
lebenden Spuren der Werkzeuge erkennen lassen; ver-
schiedentlieh hat man noch kleine flache Bossen mit
Lieferantenmarken stehen lassen (F 201, 202 Tf. 84).
Die Tonnen sind nicht bis zur Außenseite der Dodeka-
styloswand durchgeführt, sondern sie enden etwa 1,63 m
vor dieser in der Weise, daß clie Gewölbsteine parallel
mit jener abgearbeitet und die Seitenwände des Ganges
senkrecht hochgefiihrt worden sind bis zu einer horizon-
talen Decke, die, etwas oberhalb des Gewölbescheitels an-
setzend, den Rest des Ganges bis zum Dodekastylos iiber-
spannt. So entsteht bier als Ende des Ganges eine kleine,
1,63 m tiefe Kammer rechteekigen Grundrisses von der
Breite des ersteren, in deren Rückwand das Gewölbe
wieder als halbkreisförmiger Bogen erscheint. Einekleine
Abweichung gegeniiber dieser normalen Gestaltung, wie
sie der südliche Gang zeigt, bietet der nördliche darin,
daß hier jene Abarbeitung der Gewölbsteine nicht senk-
recht, sondern ungefähr normal zur Gewölbeachse erfolgt
ist, wodurch alsohierderBogen, genaugenommen, keinen
Halbkreis, sondern eine Ellipse bilden muß.
Die horizontale Decke der über dem Dodekastylosniveau
2,38 m hohen Kammern liegt auf dem Oberlager der ge-
nannten zehnten Schicht auf, und ihr Kassettenschmuck
ist in das Unterlager von je zwei die Kammern in nord-
südlicher Richtung überspannenden Blöcken der nächst-
folgenden Quaderschicht eingearbeitet (Z192 Tf. 24;
F 203 Tf. 87). Dieser Schmuck besteht in vier quadrati-
schen, zweimal abgetrepptenKassetten, deren Wandungen
von glatten Kymaleisten bekrönt sind und deren Rahmen
nebst Kreuzbalken eine rechteckige flache Soffittenrinne
zeigen. Da die vier quadratischen Kassetten zusammen
auch eine quadratischeForm der ganzenDecke verlangen,
so bleibt der Überschuß der Länge der Decke gegenüber
der Breite vor den Gewölben als glatter Deckenstreifen
stehen, und der kassettengeschmückte Teil ist in seiner
Gesamtheit um etwa 0,12 m eingesenkt und unterhalb
der Kassettenbalken mit einem an allen vier Seiten um-
laufenden, glatten jonischen Kyma umrahmt (Z 191/3, 4
Tf. 24). Die rechteckige Türöffnung dieser kleinen
Kammern gegen den Dodekastylos hin wird seitlich be-
grenzt durch basislose, antenartige Gewändepfeiler, von
denen nur der nördliche des Südganges vollständig und
der Nordpfeiler des Nordganges in seinen unteren Teilen
erhalten sind, während die beiden anderen gänzlich durch
die Brand- und Erdbebenzersplitterung zerstört sind
(F 203 Tf. 87; F 204, 205 Tf. 88).
Bei einer unteren Ausladung von 0,443 m vor derDodeka-
styloswand liegen die Pfeiler in ihrer Yorderfläche mit
der Plinthe der Wandbasis bündig; ihre untere Front-
breite beträgt 0,285 m, und sie sind gegen die Kammer-
wand so gestellt, daß sie an der Innenseite einen 92 mm
breiten Anschlag bilden und bei einer Gesamttiefe von
0,473 m mit ihrer Innenflucht nur 30 mm westlicher als
die Wandfläche des Dodekastylos liegen. Sie sind den
Eckblöcken der Kammern angearbeitet und zeigen daher
auch die gleiche durchlaufende Schichtteilung (Z 206
Tf. 25). Die Höhe bis zum Oberlager mißt 2,190 m. Die
Stirnseite zeigt auf diese Höhe eine Überneigung von
5 mm, die Frontbreite am Oberlager beträgt 0,269 m, so
daß eine Verjüngung von 16 mm vorhanden ist. Die
Achse des Pfeilers ist jedoch gegen die Türe hin so stark
geneigt, daß die äußere Verjüngung 21 mm beträgt und
derselbe auf der Türseite um 4 mm überhängt; an dieser
Seite ist der westlichste Teil der Leibungsfläche in Gestalt
eines 0,114 m breiten Streifens als Umrahmung der Türe
stehengeblieben, dessen Fläche unten bündig mit der
Pfeilerleibung beginnt und oben einen Vorsprung vor der-
selben von 21 mm zeigt, so daß die Türöffnung mit einer
einseitigen Verjüngung von 21 + 4 = 25 mm schwach
trapezförmig gebildet war.
Einerseits gegen diesen Rahmenstreifen, andererseits
gegen die Dodekastyloswand anlaufend, umzog die drei
Pfeilerseiten am Oberlager ein 20 mm hohes Abschluß-
glied, das so zerstört ist, daß nur noch der Ablauf er-
kennbar blieb, welches aber zweifellos aus Plättchen und
Rundstab oder Perlstab bestand.
Der Höhenunterschied vom Oberlager der Pfeiler bis zum
Unterlager der Kassettendecke im Betrag von 0,192 m
wurde ausgefüllt durch die Pfeilerkapitelle, von denen
nur eins, das im Schutt bei dem nördlichen Gang ge-
funden wurde, der Zerstörung entgangen ist. Von dem
durch besondere Schönheit und Feinheit seiner ornamen-
talen Gestaltung ausgezeichneten und in der Sorgfalt der
Arbeit dem Naiskos nahestehenden Kapitell (F 207, 208,
209 Tf. 106), das den Fundumständen nach dem Nord-
gang angehört, ist nur etwas mehr als die Hälfte erhalten,
so daß bei dem Fehlen der Anschlußseite unentschieden
bleibt, welchem der beiden Pfeiler dieses Einganges das-
selbe zuzuweisen ist. Das mitgefundene anpassende, auf
den Abbildungen sichtbare Eckfragment desselben ist
leider in den Kriegswirren, die die Zerstörung des Aus-
grabungsmuseums zur Folge hatten, verlorengegangen.
llas nicht allein künstlerisch, sondern auch entwicklungs-
geschichtlich sehr bemerkenswerte Kapitell gehört in jene
besonders aus Priene bekannte Gruppe von Pfeiler-
kapitellen, deren charakteristische Bildung darin besteht,
daß die vordere, umgekehrt trapezförmige Fläche des im
Grundriß rechteckigen Kapitellkörpers seitlich durch je
ein von der Grundlinie aufwachsendes hohlprofiliertes
Kanalisband begrenzt wird, das sich oben unter dem
Abakus in eine jonische Schnecke einrollt. An den Seiten
entsprechen diesen Schnecken wie bei einem jonischen
Kapitell walzenförmige Polster. Die verbleibenden Teile
der vorderen und seitlichen Kapitellflächen sind mit mehr
oder weniger selbständigen Palmetten- und Akanthus-
58
I'.ingangskammern (Jem unteren Teil der ersteren angehören.
der Gewölbegänge
Mit der Oberkante der fiinften Schicht ist genau dieOber-
Türen der kante des Dodekastylos- und Ringhallenbodens erreicht.
Eingangskammern Die sechste, 0,452 m hohe Lage — die Wandgesimsschicht
der Wangenkammern — entspricht demSockel desDodeka-
stylos und der äußeren Cellawände, die siebente der
unteren Basisschicbt, die achte und neunte haben zu-
sammen die Höhe der Orthostatenreihe, und die letzte,
diezehnteSchicht, die mit einemtrapezförmigen Anfangs-
block in den Hakenstein der neunten Schicht eingefügt
ist, bildet die erste Quaderlage der Tempelwände.
Die Lage der Stoßfugen der Schlußsteine ist nicht ganz
sicher zu ermitteln, doch scheint es, daß auch diese senk-
recht und nicht normal zur Gewölbeachse liegen. Wände
und Tonnen sind sorgfältig geglättet, aber nicht ab-
geschliffen, so daß sie die feinen, die Oberfläche be-
lebenden Spuren der Werkzeuge erkennen lassen; ver-
schiedentlieh hat man noch kleine flache Bossen mit
Lieferantenmarken stehen lassen (F 201, 202 Tf. 84).
Die Tonnen sind nicht bis zur Außenseite der Dodeka-
styloswand durchgeführt, sondern sie enden etwa 1,63 m
vor dieser in der Weise, daß clie Gewölbsteine parallel
mit jener abgearbeitet und die Seitenwände des Ganges
senkrecht hochgefiihrt worden sind bis zu einer horizon-
talen Decke, die, etwas oberhalb des Gewölbescheitels an-
setzend, den Rest des Ganges bis zum Dodekastylos iiber-
spannt. So entsteht bier als Ende des Ganges eine kleine,
1,63 m tiefe Kammer rechteekigen Grundrisses von der
Breite des ersteren, in deren Rückwand das Gewölbe
wieder als halbkreisförmiger Bogen erscheint. Einekleine
Abweichung gegeniiber dieser normalen Gestaltung, wie
sie der südliche Gang zeigt, bietet der nördliche darin,
daß hier jene Abarbeitung der Gewölbsteine nicht senk-
recht, sondern ungefähr normal zur Gewölbeachse erfolgt
ist, wodurch alsohierderBogen, genaugenommen, keinen
Halbkreis, sondern eine Ellipse bilden muß.
Die horizontale Decke der über dem Dodekastylosniveau
2,38 m hohen Kammern liegt auf dem Oberlager der ge-
nannten zehnten Schicht auf, und ihr Kassettenschmuck
ist in das Unterlager von je zwei die Kammern in nord-
südlicher Richtung überspannenden Blöcken der nächst-
folgenden Quaderschicht eingearbeitet (Z192 Tf. 24;
F 203 Tf. 87). Dieser Schmuck besteht in vier quadrati-
schen, zweimal abgetrepptenKassetten, deren Wandungen
von glatten Kymaleisten bekrönt sind und deren Rahmen
nebst Kreuzbalken eine rechteckige flache Soffittenrinne
zeigen. Da die vier quadratischen Kassetten zusammen
auch eine quadratischeForm der ganzenDecke verlangen,
so bleibt der Überschuß der Länge der Decke gegenüber
der Breite vor den Gewölben als glatter Deckenstreifen
stehen, und der kassettengeschmückte Teil ist in seiner
Gesamtheit um etwa 0,12 m eingesenkt und unterhalb
der Kassettenbalken mit einem an allen vier Seiten um-
laufenden, glatten jonischen Kyma umrahmt (Z 191/3, 4
Tf. 24). Die rechteckige Türöffnung dieser kleinen
Kammern gegen den Dodekastylos hin wird seitlich be-
grenzt durch basislose, antenartige Gewändepfeiler, von
denen nur der nördliche des Südganges vollständig und
der Nordpfeiler des Nordganges in seinen unteren Teilen
erhalten sind, während die beiden anderen gänzlich durch
die Brand- und Erdbebenzersplitterung zerstört sind
(F 203 Tf. 87; F 204, 205 Tf. 88).
Bei einer unteren Ausladung von 0,443 m vor derDodeka-
styloswand liegen die Pfeiler in ihrer Yorderfläche mit
der Plinthe der Wandbasis bündig; ihre untere Front-
breite beträgt 0,285 m, und sie sind gegen die Kammer-
wand so gestellt, daß sie an der Innenseite einen 92 mm
breiten Anschlag bilden und bei einer Gesamttiefe von
0,473 m mit ihrer Innenflucht nur 30 mm westlicher als
die Wandfläche des Dodekastylos liegen. Sie sind den
Eckblöcken der Kammern angearbeitet und zeigen daher
auch die gleiche durchlaufende Schichtteilung (Z 206
Tf. 25). Die Höhe bis zum Oberlager mißt 2,190 m. Die
Stirnseite zeigt auf diese Höhe eine Überneigung von
5 mm, die Frontbreite am Oberlager beträgt 0,269 m, so
daß eine Verjüngung von 16 mm vorhanden ist. Die
Achse des Pfeilers ist jedoch gegen die Türe hin so stark
geneigt, daß die äußere Verjüngung 21 mm beträgt und
derselbe auf der Türseite um 4 mm überhängt; an dieser
Seite ist der westlichste Teil der Leibungsfläche in Gestalt
eines 0,114 m breiten Streifens als Umrahmung der Türe
stehengeblieben, dessen Fläche unten bündig mit der
Pfeilerleibung beginnt und oben einen Vorsprung vor der-
selben von 21 mm zeigt, so daß die Türöffnung mit einer
einseitigen Verjüngung von 21 + 4 = 25 mm schwach
trapezförmig gebildet war.
Einerseits gegen diesen Rahmenstreifen, andererseits
gegen die Dodekastyloswand anlaufend, umzog die drei
Pfeilerseiten am Oberlager ein 20 mm hohes Abschluß-
glied, das so zerstört ist, daß nur noch der Ablauf er-
kennbar blieb, welches aber zweifellos aus Plättchen und
Rundstab oder Perlstab bestand.
Der Höhenunterschied vom Oberlager der Pfeiler bis zum
Unterlager der Kassettendecke im Betrag von 0,192 m
wurde ausgefüllt durch die Pfeilerkapitelle, von denen
nur eins, das im Schutt bei dem nördlichen Gang ge-
funden wurde, der Zerstörung entgangen ist. Von dem
durch besondere Schönheit und Feinheit seiner ornamen-
talen Gestaltung ausgezeichneten und in der Sorgfalt der
Arbeit dem Naiskos nahestehenden Kapitell (F 207, 208,
209 Tf. 106), das den Fundumständen nach dem Nord-
gang angehört, ist nur etwas mehr als die Hälfte erhalten,
so daß bei dem Fehlen der Anschlußseite unentschieden
bleibt, welchem der beiden Pfeiler dieses Einganges das-
selbe zuzuweisen ist. Das mitgefundene anpassende, auf
den Abbildungen sichtbare Eckfragment desselben ist
leider in den Kriegswirren, die die Zerstörung des Aus-
grabungsmuseums zur Folge hatten, verlorengegangen.
llas nicht allein künstlerisch, sondern auch entwicklungs-
geschichtlich sehr bemerkenswerte Kapitell gehört in jene
besonders aus Priene bekannte Gruppe von Pfeiler-
kapitellen, deren charakteristische Bildung darin besteht,
daß die vordere, umgekehrt trapezförmige Fläche des im
Grundriß rechteckigen Kapitellkörpers seitlich durch je
ein von der Grundlinie aufwachsendes hohlprofiliertes
Kanalisband begrenzt wird, das sich oben unter dem
Abakus in eine jonische Schnecke einrollt. An den Seiten
entsprechen diesen Schnecken wie bei einem jonischen
Kapitell walzenförmige Polster. Die verbleibenden Teile
der vorderen und seitlichen Kapitellflächen sind mit mehr
oder weniger selbständigen Palmetten- und Akanthus-
58