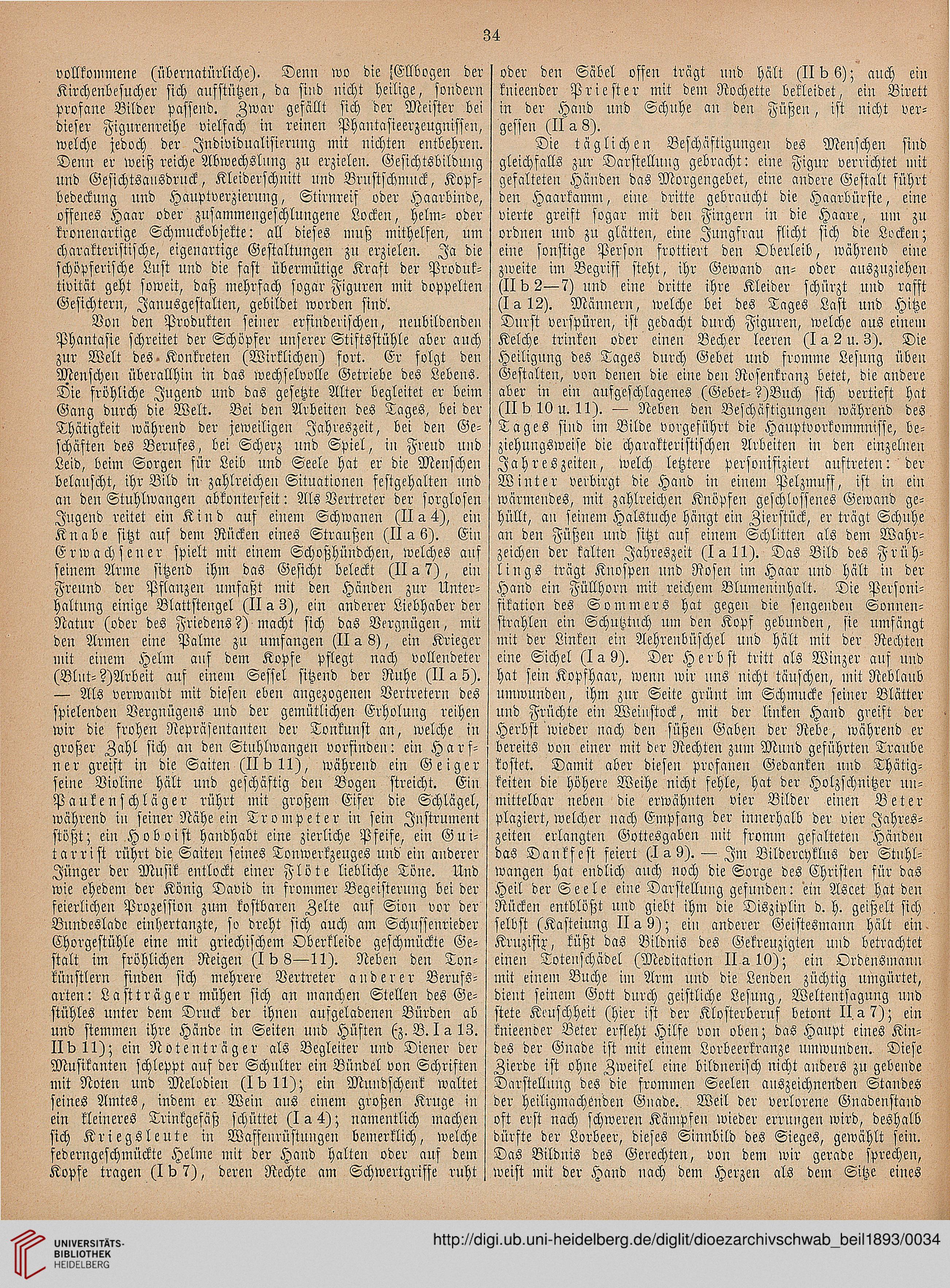34
vollkommene (übernatürliche). Denn wo die (Ellbogen der
Kirchenbesucher sich aufstützen, da sind nicht heilige, sondern
profane Bilder passend. Zwar gefallt sich der Meister bei
dieser Figurenreihe vielfach in reinen Phantasieerzeugnissen,
welche jedoch der Individualisierung mit Nichten entbehren.
Denn er weiß reiche Abwechslung zu erzielen. Gesichtsbildung
und Gesichtsausdruck, Kleiderschnitt und Brustschmuck, Kopf-
bedeckung und Hauptverzierung, Stirnreif oder Haarbinde,
offenes Haar oder zusammengeschlungene Locken, Helm- oder
kronenartige Schmuckobjekte: all dieses muß mithelfen, um
charakteristische, eigenartige Gestaltungen zu erzielen. Ja die
schöpferische Lust und die fast übermütige Kraft der Produk-
tivität geht soweit, daß mehrfach sogar Figuren mit doppelten
Gesichtern, Janusgestalten, gebildet worden sind.
Von den Produkten seiner erfinderischen, nenbildende»
Phantasie schreitet der Schöpfer unserer Stiftsstühle aber auch
zur Welt des > Konkreten (Wirklichen) fort. Er folgt den
Menschen überallhin in das wechselvolle Getriebe des Lebens.
Die fröhliche Jugend und das gesetzte Alter begleitet er beim
Gang durch die Welt. Bei den Arbeiten des Tages, bei der
Thätigkeit während der jeweiligen Jahreszeit, bei den Ge-
schäften des Berufes, bei Scherz und Spiel, in Freud und
Leid, beim Sorgen für Leib und Seele hat er die Menschen
belauscht, ihr Bild in- zahlreichen Situationen festgehalten und
an den Stuhlwangen abkonterfeit: Als Vertreter der sorglosen
Jugend reitet ein Kind auf einem Schwanen (II a 4), ein
Knabe sitzt auf dem Rücken eines Straußen (II a 6). Ein
Erwachsener spielt mit einem Schoßhündchen, welches ans
seinem Arme sitzend ihm das Gesicht beleckt (II a 7), ein
Freund der Pflanzen umfaßt mit den Händen zur Unter-
haltung einige Blattstengel (II a 3), ein anderer Liebhaber der
Natur (oder des Friedens?) macht sich das Vergnügen, mit
den Armen eine Palme zu umfangen (II a 8), ein Krieger
mit einem Helm auf dem Kopfe pflegt nach vollendeter
(Blut-I)Arbeit auf einem Sessel sitzend der Ruhe (II a 5).
— Als verwandt mit diesen eben angezogenen Vertretern des
spielenden Vergnügens und der gemütlichen Erholung reihen
wir die frohen Repräsentanten der Tonkunst an, welche in
großer Zahl sich an den Stuhlwangen vorfinden: ein Harf-
ner greift in die Saiten (II b 11), während ein Geiger
seine Violine hält und geschäftig den Bogen streicht. Ein
Paukenschläger rührt mit großem Eifer die Schlägel,
während in seiner Nähe ein Trompeter in sein Instrument
stößt; ein.Hoboist handhabt eine zierliche Pfeife, ein Gui-
tarrist rührt die Saiten seines Tonwerkzeuges und ein anderer
Jünger der Musik entlockt einer Flöte liebliche Töne. Und
wie ehedem der König David in frommer Begeisterung bei der
feierlichen Prozession zum kostbaren Zelte auf Sion vor der
Bnndesladc einhertanzte, so dreht sich auch am Schusfenrieder
Chorgestühle eine mit griechischem Oberkleide geschmückte Ge-
stalt im fröhlichen Reigen (I d 8—11). Neben den Ton-
künstlern finden sich mehrere Vertreter anderer Berufs-
arten: Lastträger mühen sich an manchen Stellen des Ge-
stühles unter dem Druck der ihnen aufgeladenen Bürden ab
und stemmen ihre Hände in Seiten und Hüften (z. B. Ial3.
IIb 11); ein Nötenträger als Begleiter und Diener der
Musikanten schleppt aus der Schulter ein Bündel von Schriften
mit Noten und Melodien (Id 11); ein Mundschenk waltet
seines Amtes, indem er Wein aus einem großen Kruge in
ein kleineres Trinkgefäß schüttet (I a 4); namentlich machen
sich Kriegsleute in Waffenrüstungen bemerklich, welche
federngeschmückte Helme mit der Hand halten oder auf dem
Kopfe tragen (I d 7), deren Rechte am Schwertgrisfe ruht
oder den Säbel offen trägt und hält (II b 6); auch ein
knieender Priester mit dem Rochette bekleidet, ein Birett
in der Hand und Schuhe an den Füßen, ist nicht ver-
gessen (II a 8).
Die täglichen Beschäftigungen des Menschen sind
gleichfalls zur Darstellung gebracht: eine Figur verrichtet mit
gefalteten Händen das Morgengebet, eine andere Gestalt führt
den Haarkamm, eine dritte gebraucht die Haarbürste, eine
vierte greift sogar mit den Fingern in die Haare, um zu
ordnen und zu glätten, eine Jungfrau flicht sich die Locken;
eine sonstige Person frottiert den Oberleib, während eine
zweite im Begriff steht, ihr Gewand an- oder auszuziehen
(II b 2—7) und eine dritte ihre Kleider schürzt und rafft
(Ial2). Männern, welche bei des Tages Last und Hitze
Durst verspüren, ist gedacht durch Figuren, welche aus einem
Kelche trinken oder einen Becher leeren (I a 2 u. 3). Die
Heiligung des Tages durch Gebet und fromme Lesung üben
Gestalten, von denen die eine den Rosenkranz betet, die andere
aber in ein aufgeschlagenes (Gebet- ?)Buch sich vertieft hat
(Ild lO u. 11). — Neben den Beschäftigungen während des.
Tages sind im Bilde vorgeführt die Hauptvorkommnisse, be-
ziehungsweise die charakteristischen Arbeiten in den einzelnen
Jahreszeiten, welch letztere personifiziert auftreten: der
Winter verbirgt die Hand in einem Pelzmusf, ist in ein
wärmendes, mit zahlreichen Knöpfen geschloffenes Gewand ge-
hüllt, au seinem Halstuche hängt ein Zierstück, er trägt Schuhe
an den Füßen und fitzt auf einem Schlitten als dem Wahr-
zeichen der kalten Jahreszeit (lall). Das Bild des Früh-
lings trägt Knospen und Rosen im Haar und hält in der
Hand ein Füllhorn mit reichem Blumeninhalt. Die Personi-
fikation des Sommers hat gegen die sengenden Sonnen-
strahlen ein Schutztuch um den Kopf gebunden, sie umfängt
mit der Linken ein Aehrenbüschel und hält mit der Rechten
eine Sichel (I a 9). Der Herbst tritt als Winzer auf und
hat sein Kopfhaar, wenn wir uns nicht täuschen, mit Reblaub
umwunden, ihm zur Seite grünt im Schmucke seiner Blätter
und Früchte ein Weinstock, mit der linken Hand greift der
Herbst wieder nach den süßen Gaben der Rebe, während er
bereits von einer mit der Rechten zum Mund geführten Traube
kostet. Damit aber diesen profanen Gedanken und Tätig-
keiten die höhere Weihe nicht fehle, hat der Holzschnitzer un-
mittelbar neben die erwähnten vier Bilder einen Beter
plaziert, welcher nach Empfang der innerhalb der vier Jahres-
zeiten erlangten Gotteögaben mit fromm gefalteten Händen
das Dankfest feiert (I a 9). — Im BildercykluS der Stuhl-
wangen hat endlich auch noch die Sorge des Christen für das
Heil der Seele eine Darstellung gefunden: ein Aseet hat den
Rücken entblößt und giebt ihm die Disziplin d. h. geißelt sich
selbst (Kasteiung II a 9); ein anderer Geistesmann hält ein
Kruzifix, küßt das Bildnis des Gekreuzigten und betrachtet
einen Totenschädel (Meditation IlalO); ein Ordensmann
mit einem Buche im Arm und die Lenden züchtig nmgürtet,
dient seinem Gott durch geistliche Lesung, Weltentsagung und
stete Keuschheit (hier ist der Klosterberuf betont II a 7) ; ein
knieender Beter erfleht Hilfe von oben; das Haupt eines Kin-
des der Gnade ist mit einem Lorbeerkranze umwunden. Diese
Zierde ist ohne Zweifel eine bildnerisch nicht anders zu gebende
Darstellung des die frommen Seelen auszeichnenden Standes
der heiligmachenden Gnade. Weil der verlorene Gnadenstand
oft erst nach schweren Kämpfen wieder errungen wird, deshalb
dürfte der Lorbeer, dieses Sinnbild des Sieges, gewählt sein.
Das Bildnis des Gerechten, von dem wir gerade sprechen,
weist mit der Hand nach dem Herzen als dem Sitze eines
vollkommene (übernatürliche). Denn wo die (Ellbogen der
Kirchenbesucher sich aufstützen, da sind nicht heilige, sondern
profane Bilder passend. Zwar gefallt sich der Meister bei
dieser Figurenreihe vielfach in reinen Phantasieerzeugnissen,
welche jedoch der Individualisierung mit Nichten entbehren.
Denn er weiß reiche Abwechslung zu erzielen. Gesichtsbildung
und Gesichtsausdruck, Kleiderschnitt und Brustschmuck, Kopf-
bedeckung und Hauptverzierung, Stirnreif oder Haarbinde,
offenes Haar oder zusammengeschlungene Locken, Helm- oder
kronenartige Schmuckobjekte: all dieses muß mithelfen, um
charakteristische, eigenartige Gestaltungen zu erzielen. Ja die
schöpferische Lust und die fast übermütige Kraft der Produk-
tivität geht soweit, daß mehrfach sogar Figuren mit doppelten
Gesichtern, Janusgestalten, gebildet worden sind.
Von den Produkten seiner erfinderischen, nenbildende»
Phantasie schreitet der Schöpfer unserer Stiftsstühle aber auch
zur Welt des > Konkreten (Wirklichen) fort. Er folgt den
Menschen überallhin in das wechselvolle Getriebe des Lebens.
Die fröhliche Jugend und das gesetzte Alter begleitet er beim
Gang durch die Welt. Bei den Arbeiten des Tages, bei der
Thätigkeit während der jeweiligen Jahreszeit, bei den Ge-
schäften des Berufes, bei Scherz und Spiel, in Freud und
Leid, beim Sorgen für Leib und Seele hat er die Menschen
belauscht, ihr Bild in- zahlreichen Situationen festgehalten und
an den Stuhlwangen abkonterfeit: Als Vertreter der sorglosen
Jugend reitet ein Kind auf einem Schwanen (II a 4), ein
Knabe sitzt auf dem Rücken eines Straußen (II a 6). Ein
Erwachsener spielt mit einem Schoßhündchen, welches ans
seinem Arme sitzend ihm das Gesicht beleckt (II a 7), ein
Freund der Pflanzen umfaßt mit den Händen zur Unter-
haltung einige Blattstengel (II a 3), ein anderer Liebhaber der
Natur (oder des Friedens?) macht sich das Vergnügen, mit
den Armen eine Palme zu umfangen (II a 8), ein Krieger
mit einem Helm auf dem Kopfe pflegt nach vollendeter
(Blut-I)Arbeit auf einem Sessel sitzend der Ruhe (II a 5).
— Als verwandt mit diesen eben angezogenen Vertretern des
spielenden Vergnügens und der gemütlichen Erholung reihen
wir die frohen Repräsentanten der Tonkunst an, welche in
großer Zahl sich an den Stuhlwangen vorfinden: ein Harf-
ner greift in die Saiten (II b 11), während ein Geiger
seine Violine hält und geschäftig den Bogen streicht. Ein
Paukenschläger rührt mit großem Eifer die Schlägel,
während in seiner Nähe ein Trompeter in sein Instrument
stößt; ein.Hoboist handhabt eine zierliche Pfeife, ein Gui-
tarrist rührt die Saiten seines Tonwerkzeuges und ein anderer
Jünger der Musik entlockt einer Flöte liebliche Töne. Und
wie ehedem der König David in frommer Begeisterung bei der
feierlichen Prozession zum kostbaren Zelte auf Sion vor der
Bnndesladc einhertanzte, so dreht sich auch am Schusfenrieder
Chorgestühle eine mit griechischem Oberkleide geschmückte Ge-
stalt im fröhlichen Reigen (I d 8—11). Neben den Ton-
künstlern finden sich mehrere Vertreter anderer Berufs-
arten: Lastträger mühen sich an manchen Stellen des Ge-
stühles unter dem Druck der ihnen aufgeladenen Bürden ab
und stemmen ihre Hände in Seiten und Hüften (z. B. Ial3.
IIb 11); ein Nötenträger als Begleiter und Diener der
Musikanten schleppt aus der Schulter ein Bündel von Schriften
mit Noten und Melodien (Id 11); ein Mundschenk waltet
seines Amtes, indem er Wein aus einem großen Kruge in
ein kleineres Trinkgefäß schüttet (I a 4); namentlich machen
sich Kriegsleute in Waffenrüstungen bemerklich, welche
federngeschmückte Helme mit der Hand halten oder auf dem
Kopfe tragen (I d 7), deren Rechte am Schwertgrisfe ruht
oder den Säbel offen trägt und hält (II b 6); auch ein
knieender Priester mit dem Rochette bekleidet, ein Birett
in der Hand und Schuhe an den Füßen, ist nicht ver-
gessen (II a 8).
Die täglichen Beschäftigungen des Menschen sind
gleichfalls zur Darstellung gebracht: eine Figur verrichtet mit
gefalteten Händen das Morgengebet, eine andere Gestalt führt
den Haarkamm, eine dritte gebraucht die Haarbürste, eine
vierte greift sogar mit den Fingern in die Haare, um zu
ordnen und zu glätten, eine Jungfrau flicht sich die Locken;
eine sonstige Person frottiert den Oberleib, während eine
zweite im Begriff steht, ihr Gewand an- oder auszuziehen
(II b 2—7) und eine dritte ihre Kleider schürzt und rafft
(Ial2). Männern, welche bei des Tages Last und Hitze
Durst verspüren, ist gedacht durch Figuren, welche aus einem
Kelche trinken oder einen Becher leeren (I a 2 u. 3). Die
Heiligung des Tages durch Gebet und fromme Lesung üben
Gestalten, von denen die eine den Rosenkranz betet, die andere
aber in ein aufgeschlagenes (Gebet- ?)Buch sich vertieft hat
(Ild lO u. 11). — Neben den Beschäftigungen während des.
Tages sind im Bilde vorgeführt die Hauptvorkommnisse, be-
ziehungsweise die charakteristischen Arbeiten in den einzelnen
Jahreszeiten, welch letztere personifiziert auftreten: der
Winter verbirgt die Hand in einem Pelzmusf, ist in ein
wärmendes, mit zahlreichen Knöpfen geschloffenes Gewand ge-
hüllt, au seinem Halstuche hängt ein Zierstück, er trägt Schuhe
an den Füßen und fitzt auf einem Schlitten als dem Wahr-
zeichen der kalten Jahreszeit (lall). Das Bild des Früh-
lings trägt Knospen und Rosen im Haar und hält in der
Hand ein Füllhorn mit reichem Blumeninhalt. Die Personi-
fikation des Sommers hat gegen die sengenden Sonnen-
strahlen ein Schutztuch um den Kopf gebunden, sie umfängt
mit der Linken ein Aehrenbüschel und hält mit der Rechten
eine Sichel (I a 9). Der Herbst tritt als Winzer auf und
hat sein Kopfhaar, wenn wir uns nicht täuschen, mit Reblaub
umwunden, ihm zur Seite grünt im Schmucke seiner Blätter
und Früchte ein Weinstock, mit der linken Hand greift der
Herbst wieder nach den süßen Gaben der Rebe, während er
bereits von einer mit der Rechten zum Mund geführten Traube
kostet. Damit aber diesen profanen Gedanken und Tätig-
keiten die höhere Weihe nicht fehle, hat der Holzschnitzer un-
mittelbar neben die erwähnten vier Bilder einen Beter
plaziert, welcher nach Empfang der innerhalb der vier Jahres-
zeiten erlangten Gotteögaben mit fromm gefalteten Händen
das Dankfest feiert (I a 9). — Im BildercykluS der Stuhl-
wangen hat endlich auch noch die Sorge des Christen für das
Heil der Seele eine Darstellung gefunden: ein Aseet hat den
Rücken entblößt und giebt ihm die Disziplin d. h. geißelt sich
selbst (Kasteiung II a 9); ein anderer Geistesmann hält ein
Kruzifix, küßt das Bildnis des Gekreuzigten und betrachtet
einen Totenschädel (Meditation IlalO); ein Ordensmann
mit einem Buche im Arm und die Lenden züchtig nmgürtet,
dient seinem Gott durch geistliche Lesung, Weltentsagung und
stete Keuschheit (hier ist der Klosterberuf betont II a 7) ; ein
knieender Beter erfleht Hilfe von oben; das Haupt eines Kin-
des der Gnade ist mit einem Lorbeerkranze umwunden. Diese
Zierde ist ohne Zweifel eine bildnerisch nicht anders zu gebende
Darstellung des die frommen Seelen auszeichnenden Standes
der heiligmachenden Gnade. Weil der verlorene Gnadenstand
oft erst nach schweren Kämpfen wieder errungen wird, deshalb
dürfte der Lorbeer, dieses Sinnbild des Sieges, gewählt sein.
Das Bildnis des Gerechten, von dem wir gerade sprechen,
weist mit der Hand nach dem Herzen als dem Sitze eines