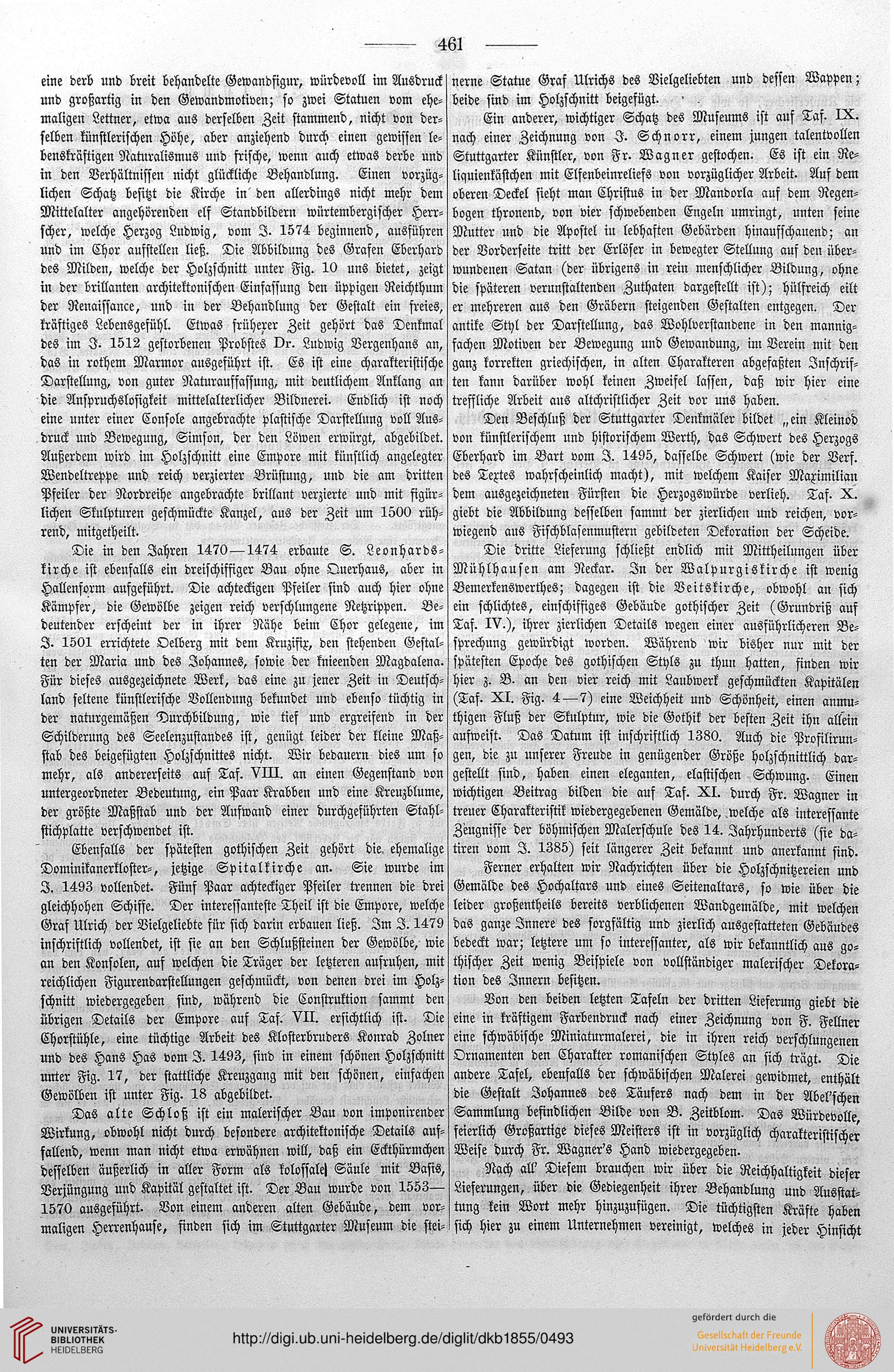461
eine derb und breit behandelte Gewandfigur, würdevoll im Ausdruck
und großartig in den Gewandmotiven; so zwei Statuen vom ehe-
maligen Lettner, etwa aus derselben Zeit stammend, nicht von der-
selben künstlerischen Höhe, aber anziehend durch einen gewissen le-
benskräftigen Naturalismus und frische, wenn auch etwas derbe und
in den Verhältnissen nicht glückliche Behandlung. Einen vorzüg-
lichen Schatz besitzt die Kirche in den allerdings nicht mehr dem
Mittelalter angehörenden elf Standbildern würtembergischer Herr-
scher, welche Herzog Ludwig, vom I. 1574 beginnend, ausführen
und im Chor aufstellen ließ. Die Abbildung des Grafen Eberhard
des Milden, welche der Holzschnitt unter Fig. 10 uns bietet, zeigt
in der brillanten architektonischen Einfassung den üppigen Reichthum
der Renaissance, und in der Behandlung der Gestalt ein freies,
kräftiges Lebensgefühl. Etwas früherer Zeit gehört das Denkmal
des im I. 1512 gestorbenen Probstes Dr. Ludwig Vergenhans an,
das in rothem Marmor ausgeführt ist. Es ist eine charakteristische
Darstellung, von guter Naturauffassung, mit deutlichem Anklang an
die Anspruchslosigkeit mittelalterlicher Bildnerei. Endlich ist noch
eine unter einer Console angebrachte plastische Darstellung voll Aus-
druck und Bewegung, Simson, der den Löwen erwürgt, abgebildet.
Außerdem wird im Holzschnitt eine Empore mit künstlich angelegter
Wendeltreppe und reich verzierter Brüstung, und die am dritten
Pfeiler der Nordreihe angebrachte brillant verzierte und mit figür-
lichen Skulpturen geschmückte Kanzel, aus der Zeit um 1500 rüh-
rend, mitgetheilt.
Die in den Jahren 1470—1474 erbaute S. Leonhards-
kirche ist ebenfalls ein dreischiffiger Bau ohne Querhaus, aber in
Hallenform aufgesührt. Die achteckigen Pfeiler find auch hier ohne
Kämpfer, die Gewölbe zeigen reich verschlungene Netzrippen. Be-
deutender erscheint der in ihrer Nähe beim Chor gelegene, im
I. 1501 errichtete Oelberg mit dem Kruzifix, den stehenden Gestal-
ten der Maria und des Johannes, sowie der knieenden Magdalena.
Für dieses ausgezeichnete Werk, das eine zu jener Zeit in Deutsch-
land seltene künstlerische Vollendung bekundet und ebenso tüchtig in
der naturgemäßen Durchbildung, wie tief und ergreifend in der
Schilderung des Seelenzustandes ist, genügt leider der kleine Maß-
stab des beigefügten Holzschnittes nicht. Wir bedauern dies um so
mehr, als andererseits aus Taf. VIII. an einen Gegenstand von
untergeordneter Bedeutung, ein Paar Krabben und eine Kreuzblume,
der größte Maßstab und der Aufwand einer durchgesührten Stahl-
stichplatte verschwendet ist.
Ebenfalls der spätesten gothischen Zeit gehört die. ehemalige
Dominikanerkloster-, jetzige Spitalkirche an. Sie wurde im
I. 1493 vollendet. Fünf Paar achteckiger Pfeiler trennen die drei
gleichhohen Schiffe. Der interessanteste Theil ist die Empore, welche
Graf Ulrich der Vielgeliebte für sich darin erbauen ließ. Im 1.1479
inschristlich vollendet, ist sie an den Schlußsteinen der Gewölbe, wie
an den Konsolen, auf welchen die Träger der letzteren ausruhen, mit
reichlichen Figurendarstellungen geschmückt, von denen drei im Holz-
schnitt wiedergegeben sind, während die Construktion sammt den
übrigen Details der Empore auf Taf. VII. ersichtlich ist. Die
Chorstühle, eine tüchtige Arbeit des Klosterbruders Konrad Zolner
und des Hans Has vom I. 1493, sind in einem schönen Holzschnitt
unter Fig. 17, der stattliche Kreuzgang mit den schönen, einfachen
Gewölben ist unter Fig. 18 abgebildet.
Das alte Schloß ist ein malerischer Bau von imponirender
Wirkung, obwohl nicht durch besondere architektonische Details aus-
fallend, wenn man nicht etwa erwähnen will, daß ein Eckthürmchen
desselben äußerlich in aller Form als kolossale! Säule mit Basis,
Verjüngung und Kapitäl gestaltet ist. Der Bau wurde von 1553—
1570 ausgeführt. Von einem anderen alten Gebäude, dem vor-
maligen Herrenhause, finden sich im Stuttgarter Museum die stei-
nerne Statue Graf Ulrichs des Vielgeliebten und dessen Wappen;
beide sind im Holzschnitt Beigefügt. * .
Ein anderer, wichtiger Schatz des Museums ist auf Taf. IX.
nach einer Zeichnung von I. Schnorr, einem jungen talentvollen
Stuttgarter Künstler, von Fr. Wagner gestochen. Es ist ein Re-
liquienkästchen mit Elfenbeinreliefs von vorzüglicher Arbeit. Auf dem
oberen Deckel sieht man Christus in der Mandorla auf dem Regen-
bogen thronend, von vier schwebenden Engeln umringt, unten seine
Mutter und die Apostel iu lebhaften Gebärden hinaufschauend; an
der Vorderseite tritt der Erlöser in bewegter Stellung auf den über-
wundenen Satan (der übrigens in rein menschlicher Bildung, ohne
die späteren verunstaltenden Zuthaten dargestellt ist); hülfreich eilt
er mehreren aus den Gräbern steigenden Gestalten entgegen. Der
antike Styl der Darstellung, das Wohlverstandene in den mannig-
fachen Motiven der Bewegung und Gewandung, im Verein mit den
ganz korrekten griechischen, in alten Charakteren abgefaßten Inschrif-
ten kann darüber wohl keinen Zweifel lassen, daß wir hier eine
tteffliche Arbeit ans altchristlicher Zeit vor uns haben.
Den Beschluß der Stuttgarter Denkmäler bildet „ein Kleinod
von künstlerischem und historischem Werth, das Schwert des Herzogs
Eberhard im Bart vom I. 1495, dasselbe Schwert (wie der Vers,
des Textes wahrscheinlich macht), mit welchem Kaiser Maximilian
dem ausgezeichneten Fürsten die Herzogswürde verlieh. Taf. X.
giebt die Abbildung desselben sammt der zierlichen und reichen, vor-
wiegend aus Fischblasenmustern gebildeten Dekoration der Scheide.
Die dritte Lieferung schließt endlich mit Mittheilungen über
Mühlhausen am Neckar. In der Walpurgiskirche ist wenig
Bemerkenswerthes; dagegen ist die Veitskirche, obwohl an sich
ein schlichtes, einschiffiges Gebäude gothischer Zeit (Grundriß auf
Tas. IV.), ihrer zierlichen Details wegen einer ausführlicheren Be-
sprechung gewürdigt worden. Während wir bisher nur mit der
spätesten Epoche des gothischen Styls zu thun hatten, finden wir
hier z. B. an den vier reich mit Laubwerk geschmückten Kapitälen
(Taf. XI. Fig. 4—7) eine Weichheit und Schönheit, einen anmu-
thigen Fluß der Skulptur, wie die Gothik der besten Zeit ihn allein
aufweist. Das Datum ist inschristlich 1380. Auch die Profilirun-
gen, die zu unserer Freude in genügender Größe holzschnittlich dar-
gestellt sind, haben einen eleganten, elastischen Schwung. Einen
wichtigen Beitrag bilden die auf Taf. XI. durch Fr. Wagner in
tteuer Charakterisük wiedergegebenen Gemälde, .welche als interessante
Zeugnisse der böhmischen Malerschule des 14. Jahrhunderts (sie da-
tiren vom I. 1385) seit längerer Zeit bekannt und anerkannt sind.
Ferner erhallen wir Nachrichten über die Holzschnitzereien und
Gemälde des Hochaltars und eines Seitenaltars, so wie über die
leider großentheils bereits verblichenen Wandgemälde, mit welchen
das ganze Innere des sorgfältig und zierlich ausgestatteten Gebäudes
bedeckt war; letztere um so interessanter, als wir bekanntlich aus go-
thischer Zeit wenig Beispiele von vollständiger malerischer Dekora-
tion des Innern besitzen.
Von den beiden letzten Tafeln der dritten Lieferung giebt die
eine in kräftigem Farbendruck nach einer Zeichnung von F. Fellner
eine schwäbische Miniaturmalerei, die in ihren reich verschlungenen
Ornamenten den Charakter romanischen Styles an sich ttägt. Die
andere Tafel, ebensalls der schwäbischen Malerei gewidmet, enthält
die Gestalt Johannes des Täusers nach dem in der Abel'schen
Sammlung befindlichen Bilde von B. Zeitblom. Das Würdevolle
feierlich Großartige dieses Meisters ist in vorzüglich charakteristischer
Weise durch Fr. Wagner's Hand wiedergegeben.
Nach all' Diesem brauchen wir über die Reichhaltigkeit dieser
Lieferungen, über die Gediegenheit ihrer Behandlung und Ausstat-
tung kein Wort mehr hinzuzusügen. Die tüchtigsten Kräfte haben
sich hier zu einem Unternehmen vereinigt, welches in jeder Hinsicht
eine derb und breit behandelte Gewandfigur, würdevoll im Ausdruck
und großartig in den Gewandmotiven; so zwei Statuen vom ehe-
maligen Lettner, etwa aus derselben Zeit stammend, nicht von der-
selben künstlerischen Höhe, aber anziehend durch einen gewissen le-
benskräftigen Naturalismus und frische, wenn auch etwas derbe und
in den Verhältnissen nicht glückliche Behandlung. Einen vorzüg-
lichen Schatz besitzt die Kirche in den allerdings nicht mehr dem
Mittelalter angehörenden elf Standbildern würtembergischer Herr-
scher, welche Herzog Ludwig, vom I. 1574 beginnend, ausführen
und im Chor aufstellen ließ. Die Abbildung des Grafen Eberhard
des Milden, welche der Holzschnitt unter Fig. 10 uns bietet, zeigt
in der brillanten architektonischen Einfassung den üppigen Reichthum
der Renaissance, und in der Behandlung der Gestalt ein freies,
kräftiges Lebensgefühl. Etwas früherer Zeit gehört das Denkmal
des im I. 1512 gestorbenen Probstes Dr. Ludwig Vergenhans an,
das in rothem Marmor ausgeführt ist. Es ist eine charakteristische
Darstellung, von guter Naturauffassung, mit deutlichem Anklang an
die Anspruchslosigkeit mittelalterlicher Bildnerei. Endlich ist noch
eine unter einer Console angebrachte plastische Darstellung voll Aus-
druck und Bewegung, Simson, der den Löwen erwürgt, abgebildet.
Außerdem wird im Holzschnitt eine Empore mit künstlich angelegter
Wendeltreppe und reich verzierter Brüstung, und die am dritten
Pfeiler der Nordreihe angebrachte brillant verzierte und mit figür-
lichen Skulpturen geschmückte Kanzel, aus der Zeit um 1500 rüh-
rend, mitgetheilt.
Die in den Jahren 1470—1474 erbaute S. Leonhards-
kirche ist ebenfalls ein dreischiffiger Bau ohne Querhaus, aber in
Hallenform aufgesührt. Die achteckigen Pfeiler find auch hier ohne
Kämpfer, die Gewölbe zeigen reich verschlungene Netzrippen. Be-
deutender erscheint der in ihrer Nähe beim Chor gelegene, im
I. 1501 errichtete Oelberg mit dem Kruzifix, den stehenden Gestal-
ten der Maria und des Johannes, sowie der knieenden Magdalena.
Für dieses ausgezeichnete Werk, das eine zu jener Zeit in Deutsch-
land seltene künstlerische Vollendung bekundet und ebenso tüchtig in
der naturgemäßen Durchbildung, wie tief und ergreifend in der
Schilderung des Seelenzustandes ist, genügt leider der kleine Maß-
stab des beigefügten Holzschnittes nicht. Wir bedauern dies um so
mehr, als andererseits aus Taf. VIII. an einen Gegenstand von
untergeordneter Bedeutung, ein Paar Krabben und eine Kreuzblume,
der größte Maßstab und der Aufwand einer durchgesührten Stahl-
stichplatte verschwendet ist.
Ebenfalls der spätesten gothischen Zeit gehört die. ehemalige
Dominikanerkloster-, jetzige Spitalkirche an. Sie wurde im
I. 1493 vollendet. Fünf Paar achteckiger Pfeiler trennen die drei
gleichhohen Schiffe. Der interessanteste Theil ist die Empore, welche
Graf Ulrich der Vielgeliebte für sich darin erbauen ließ. Im 1.1479
inschristlich vollendet, ist sie an den Schlußsteinen der Gewölbe, wie
an den Konsolen, auf welchen die Träger der letzteren ausruhen, mit
reichlichen Figurendarstellungen geschmückt, von denen drei im Holz-
schnitt wiedergegeben sind, während die Construktion sammt den
übrigen Details der Empore auf Taf. VII. ersichtlich ist. Die
Chorstühle, eine tüchtige Arbeit des Klosterbruders Konrad Zolner
und des Hans Has vom I. 1493, sind in einem schönen Holzschnitt
unter Fig. 17, der stattliche Kreuzgang mit den schönen, einfachen
Gewölben ist unter Fig. 18 abgebildet.
Das alte Schloß ist ein malerischer Bau von imponirender
Wirkung, obwohl nicht durch besondere architektonische Details aus-
fallend, wenn man nicht etwa erwähnen will, daß ein Eckthürmchen
desselben äußerlich in aller Form als kolossale! Säule mit Basis,
Verjüngung und Kapitäl gestaltet ist. Der Bau wurde von 1553—
1570 ausgeführt. Von einem anderen alten Gebäude, dem vor-
maligen Herrenhause, finden sich im Stuttgarter Museum die stei-
nerne Statue Graf Ulrichs des Vielgeliebten und dessen Wappen;
beide sind im Holzschnitt Beigefügt. * .
Ein anderer, wichtiger Schatz des Museums ist auf Taf. IX.
nach einer Zeichnung von I. Schnorr, einem jungen talentvollen
Stuttgarter Künstler, von Fr. Wagner gestochen. Es ist ein Re-
liquienkästchen mit Elfenbeinreliefs von vorzüglicher Arbeit. Auf dem
oberen Deckel sieht man Christus in der Mandorla auf dem Regen-
bogen thronend, von vier schwebenden Engeln umringt, unten seine
Mutter und die Apostel iu lebhaften Gebärden hinaufschauend; an
der Vorderseite tritt der Erlöser in bewegter Stellung auf den über-
wundenen Satan (der übrigens in rein menschlicher Bildung, ohne
die späteren verunstaltenden Zuthaten dargestellt ist); hülfreich eilt
er mehreren aus den Gräbern steigenden Gestalten entgegen. Der
antike Styl der Darstellung, das Wohlverstandene in den mannig-
fachen Motiven der Bewegung und Gewandung, im Verein mit den
ganz korrekten griechischen, in alten Charakteren abgefaßten Inschrif-
ten kann darüber wohl keinen Zweifel lassen, daß wir hier eine
tteffliche Arbeit ans altchristlicher Zeit vor uns haben.
Den Beschluß der Stuttgarter Denkmäler bildet „ein Kleinod
von künstlerischem und historischem Werth, das Schwert des Herzogs
Eberhard im Bart vom I. 1495, dasselbe Schwert (wie der Vers,
des Textes wahrscheinlich macht), mit welchem Kaiser Maximilian
dem ausgezeichneten Fürsten die Herzogswürde verlieh. Taf. X.
giebt die Abbildung desselben sammt der zierlichen und reichen, vor-
wiegend aus Fischblasenmustern gebildeten Dekoration der Scheide.
Die dritte Lieferung schließt endlich mit Mittheilungen über
Mühlhausen am Neckar. In der Walpurgiskirche ist wenig
Bemerkenswerthes; dagegen ist die Veitskirche, obwohl an sich
ein schlichtes, einschiffiges Gebäude gothischer Zeit (Grundriß auf
Tas. IV.), ihrer zierlichen Details wegen einer ausführlicheren Be-
sprechung gewürdigt worden. Während wir bisher nur mit der
spätesten Epoche des gothischen Styls zu thun hatten, finden wir
hier z. B. an den vier reich mit Laubwerk geschmückten Kapitälen
(Taf. XI. Fig. 4—7) eine Weichheit und Schönheit, einen anmu-
thigen Fluß der Skulptur, wie die Gothik der besten Zeit ihn allein
aufweist. Das Datum ist inschristlich 1380. Auch die Profilirun-
gen, die zu unserer Freude in genügender Größe holzschnittlich dar-
gestellt sind, haben einen eleganten, elastischen Schwung. Einen
wichtigen Beitrag bilden die auf Taf. XI. durch Fr. Wagner in
tteuer Charakterisük wiedergegebenen Gemälde, .welche als interessante
Zeugnisse der böhmischen Malerschule des 14. Jahrhunderts (sie da-
tiren vom I. 1385) seit längerer Zeit bekannt und anerkannt sind.
Ferner erhallen wir Nachrichten über die Holzschnitzereien und
Gemälde des Hochaltars und eines Seitenaltars, so wie über die
leider großentheils bereits verblichenen Wandgemälde, mit welchen
das ganze Innere des sorgfältig und zierlich ausgestatteten Gebäudes
bedeckt war; letztere um so interessanter, als wir bekanntlich aus go-
thischer Zeit wenig Beispiele von vollständiger malerischer Dekora-
tion des Innern besitzen.
Von den beiden letzten Tafeln der dritten Lieferung giebt die
eine in kräftigem Farbendruck nach einer Zeichnung von F. Fellner
eine schwäbische Miniaturmalerei, die in ihren reich verschlungenen
Ornamenten den Charakter romanischen Styles an sich ttägt. Die
andere Tafel, ebensalls der schwäbischen Malerei gewidmet, enthält
die Gestalt Johannes des Täusers nach dem in der Abel'schen
Sammlung befindlichen Bilde von B. Zeitblom. Das Würdevolle
feierlich Großartige dieses Meisters ist in vorzüglich charakteristischer
Weise durch Fr. Wagner's Hand wiedergegeben.
Nach all' Diesem brauchen wir über die Reichhaltigkeit dieser
Lieferungen, über die Gediegenheit ihrer Behandlung und Ausstat-
tung kein Wort mehr hinzuzusügen. Die tüchtigsten Kräfte haben
sich hier zu einem Unternehmen vereinigt, welches in jeder Hinsicht