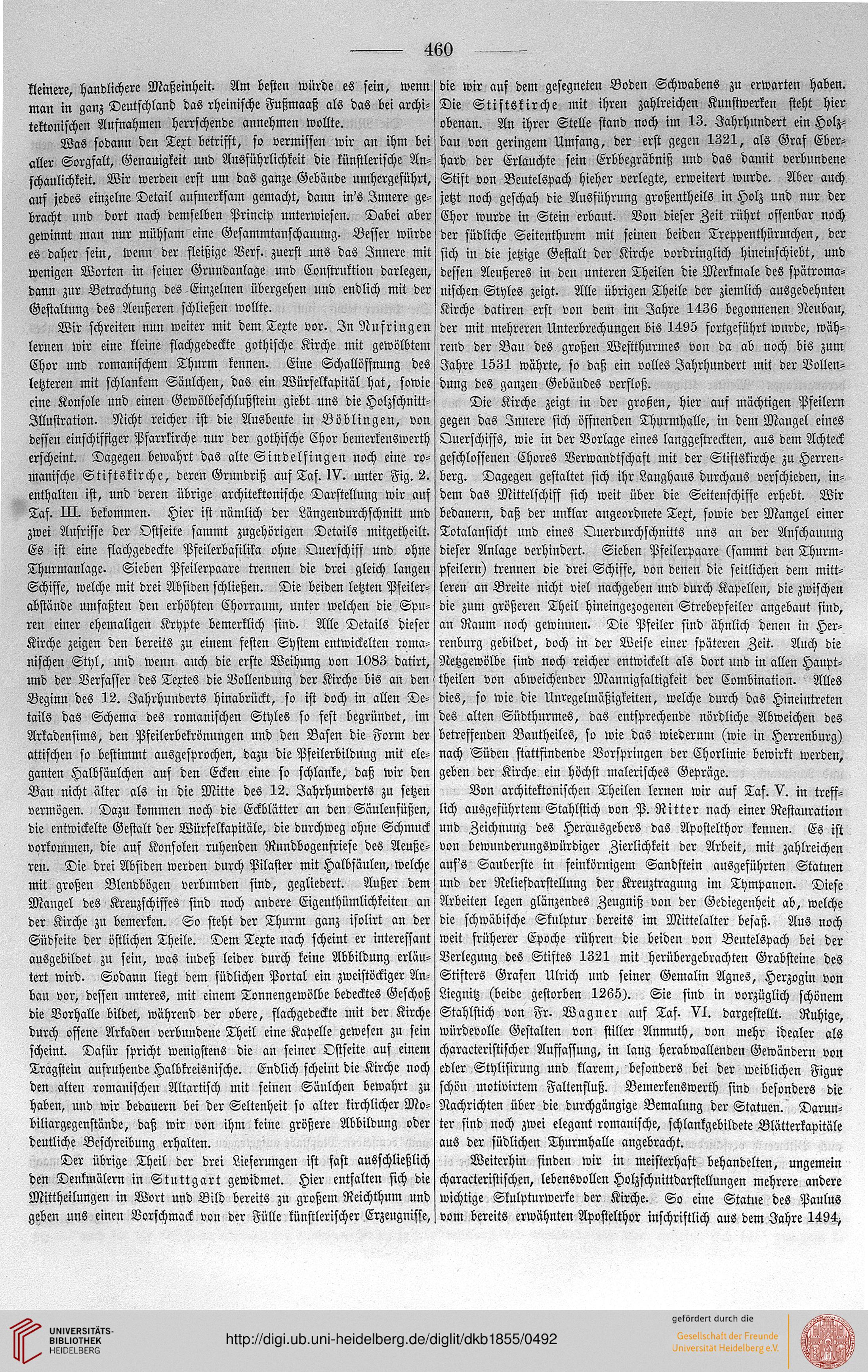460
kleinere, handlichere Maßeinheit. Am besten würde es sein, wenn
man in ganz Deutschland das rheinische Fußmaaß als das bei archi-
tektonischen Aufnahmen herrschende annehmen wollte.
Was sodann den Text betrifft, so vermissen wir an ihm bei
aller Sorgfalt, Genauigkeit und Ausführlichkeit die künstlerische An-
schaulichkeit. Wir werden erst um das ganze Gebäude umhergeführt,
auf jedes einzelne Detail aufmerksam gemacht, dann in's Innere ge-
bracht und dort nach demselben Princip unterwiesen. Dabei aber
gewinnt man nur mühsam eine Gesammtanschauung. Besser würde
es daher sein, wenn der fleißige Vers, zuerst uns das Innere mit
wenigen Worten in seiner Grundanlage und Construktion darlegen,
dann zur Betrachtung des Einzelnen übergehen und endlich mit der
Gestaltung des Aeußeren schließen wollte.
Wir schreiten nun weiter mit dem Texte vor. In Nufringen
lernen wir eine kleine flachgedeckte gothische Arche mit gewölbtem
Chor und romanischem Thurm kennen. Eine Schallöffnung des
letzteren mit schlankem Säulchen, das ein Würfelkapitäl hat, sowie
eine Konsole und einen Gewölbeschlußstein giebt uns die Holzschnitt-
Illustration. Nicht reicher ist die Ausbeute in Böblingen, von
dessen einschiffiger Pfarrkirche nur der gothische Chor bemerkenswerth
erscheint. Dagegen bewahrt das alte Sindelfingen noch eine ro-
manische Stiftskirche, deren Grundriß aus Taf. IV. unter Fig. 2.
enthalten ist, und deren übrige architektonische Darstellung wir auf
Taf. III. bekommen. Hier ist nämlich der Längendurchschnitt und
zwei Aufrisse der Ostseite sammt zugehörigen Details mitgetheilt.
Es ist eine flachgedeckte Pfeilerbasilika ohne Querschisf und ohne
Thurmanlage. Sieben Pfeilerpaare trennen die drei gleich langen
Schiffe, welche mit drei Absiden schließen. Die beiden letzten Pfeiler-
abstände umfaßten den erhöhten Chorraum, unter welchen die Spu-
ren einer ehemaligen Krypte bemerklich sind. Alle Details dieser
Kirche zeigen den bereits zu einem festen System entwickelten roma-
nischen Styl, und wenn auch die erste Weihung von 1083 datirt,
und der Verfasser des Textes die Vollendung der Kirche bis an den
Beginn des 12. Jahrhunderts hinabrückt, so ist doch in allen De-
tails das Schema des romanischen Styles so fest begründet, im
Arkadensims, den Pfeilerbekrönungen und den Basen die Form der
attischen so bestimmt ausgesprochen, dazu die Pfeilerbildung mit ele-
ganten Halbsäulchen auf den Ecken eine so schlanke, daß wir den
Bau nicht älter als in die Mitte des 12. Jahrhunderts zu setzen
vermögen. Dazu kommen noch die Eckblätter an den Säulenfüßen,
die entwickelte Gestalt der Würselkapitäle, die durchweg ohne Schmuck
Vorkommen, die auf Konsolen ruhenden Rundbogenfriese des Aeuße-
ren. Die drei Absiden werden durch Pilaster mit Halbsäulen, welche
mit großen Blendbögen verbunden sind, gegliedert. Außer dem
Mangel des Kreuzschiffes sind noch andere Eigenthümlichkeiten an
der Kirche zu bemerken. So steht der Thurm ganz isolirt an der
Südseite der östlichen Theile. Dem Texte nach scheint er interessant
ausgebildet zu sein, was indeß leider durch keine Abbildung erläu-
tert wird. Sodann liegt dem südlichen Portal ein zweistöckiger An-
bau vor, dessen unteres, mit einem Tonnengewölbe bedecktes Geschoß
die Vorhalle bildet, während der obere, flachgedeckte mit der Kirche
durch offene Arkaden verbundene Theil eine Kapelle gewesen zu sein
scheint. Dafür spricht wenigstens die an seiner Ostseite auf einem
Tragstein aufruhende Halbkreisnische. Endlich scheint die Kirche noch
den alten romanischen Altartisch mit seinen Säulchen bewahrt zu
haben, und wir bedauern bei der Seltenheit so alter kirchlicher Mo-
biliargegenstände, daß wir von ihm keine größere Abbildung oder
deutliche Beschreibung erhalten.
Der übrige Theil der drei Lieferungen ist fast ausschließlich
den Denkmälern in Stuttgart gewidmet. Hier entfalten sich die
Mittheilungen in Wort und Bild bereits zu großem Reichthum und
geben uns einen Vorschmack von der Fülle künstlerischer Erzeugnisse,
die wir auf dem gesegneten Boden Schwabens zu erwarten haben.
Die Stiftskirche mit ihren zahlreichen Kunstwerken steht hier
obenan. An ihrer Stelle stand noch im 13. Jahrhundert ein Holz-
bau von geringem Umfang, der erst gegen 1321, als Graf Eber-
hard der Erlauchte sein Erbbegräbniß und das damit verbundene
Stift von Beutelspach hieher verlegte, erweitert wurde. Aber auch
jetzt noch geschah die Ausführung großentheils in Holz und nur der
Chor wurde in Stein erbaut. Von dieser Zeit rührt offenbar noch
der südliche Seitenthurm mit seinen beiden Treppenthürmchen, der
sich in die jetzige Gestalt der Kirche vordringlich hineinschiebt, und
dessen Aeußeres in den unteren Theilen die Merkmale des spätroma-
nischen Styles zeigt. Alle übrigen Theile der ziemlich ausgedehnten
Kirche datiren erst von dem im Jahre 1436 begonnenen Neubau,
der mit mehreren Unterbrechungen bis 1495 fortgeführt wurde, wäh-
rend der Bau des großen WestthurmeS von da ab noch bis zum
Jahre 1531 währte, so daß ein volles Jahrhundert mit der Vollen-
dung des ganzen Gebäudes verfloß.
Die Kirche zeigt in der großen, hier auf mächtigen Pfeilern
gegen das Innere sich öffnenden Thurmhalle, in dem Mangel eines
Querschiffs, wie in der Vorlage eines langgestreckten, aus dem Achteck
geschlossenen Chores Verwandtschaft mit der Stiftskirche zu Herren-
berg. Dagegen gestaltet sich ihr Langhaus durchaus verschieden, in-
dem das Mittelschiff sich weit über die Seitenschiffe erhebt. Wir
bedauern, daß der unklar angeordnete Text, sowie der Mangel einer
Totalansicht und eines Querdurchschnitts uns an der Anschauung
dieser Anlage verhindert. Sieben Pfeilerpaare (sammt den Thurm-
pfeilern) trennen die drei Schiffe, von denen die seitlichen dem mitt-
leren an Breite nicht viel nachgeben und durch Kapellen, die zwischen
die zum größeren Theil hineingezogenen Strebepfeiler angebaut sind,
an Raum noch gewinnen. Die Pfeiler sind ähnlich denen in Her-
renburg gebildet, doch in der Weise einer späteren Zeit. Auch die
Netzgewölbe sind noch reicher entwickelt als dort und in allen Haupt-
theilen von abweichender Mannigfaltigkeit der Combination. Alles
dies, so wie die Unregelmäßigkeiten, welche durch das Hineintreten
des alten Südthurmes, das entsprechende nördliche Abweichen des
betreffenden Bautheiles, so wie das wiederum (wie in Herrenburg)
nach Süden stattfindende Vorspringen der Chorlinie bewirkt werden,
geben der Kirche ein höchst malerisches Gepräge.
Von architektonischen Theilen lernen wir auf Taf. V. in treff-
lich ausgeführtem Stahlstich von P. Ritter nach einer Restauration
und Zeichnung des Herausgebers das Apostelthor kennen. Es ist
von bewunderungswürdiger Zierlichkeit der Arbeit, mit zahlreichen
auf's Sauberste in feinkörnigem Sandstein ausgeführten Statuen
und der Reliefdarstellung der Kreuztragung im Tympanon. Diese
Arbeiten legen glänzendes Zeugniß von der Gediegenheit ab, welche
die schwäbische Skulptur bereits im Mittelalter besaß. Aus noch
weit früherer Epoche rühren die beiden von Beutelspach bei der
Verlegung des Stiftes 1321 mit herübergebrachten Grabsteine des
Stifters Grafen Ulrich und seiner Gemalin Agnes, Herzogin von
Liegnitz (beide gestorben 1265). Sie sind in vorzüglich schönem
Stahlstich von Fr. Wagner auf Taf. VI. dargestellt. Ruhige,
würdevolle Gestalten von stiller Anmuth, von mehr idealer als
characteristischer Auffassung, in lang herabwallenden Gewändern von
edler Stylisirung und klarem, besonders bei der weiblichen Figur
schön motivirtem Faltenfluß. Bemerkenswerth sind besonders die
Nachrichten über die durchgängige Bemalung der Statuen. Darun-
ter sind noch zwei elegant romanische, schlankgebildete Blätterkapitäle
aus der südlichen Thurmhalle angebracht.
Weiterhin finden wir in meisterhaft behandelten, ungemein
characteristischen, lebensvollen Holzschnittdarstellungen mehrere andere
wichtige Skulpturwerke der Kirche. So eine Statue des Paulus
vom bereits erwähnten Apostelthor inschriftlich auö dem Jahre 1494,
kleinere, handlichere Maßeinheit. Am besten würde es sein, wenn
man in ganz Deutschland das rheinische Fußmaaß als das bei archi-
tektonischen Aufnahmen herrschende annehmen wollte.
Was sodann den Text betrifft, so vermissen wir an ihm bei
aller Sorgfalt, Genauigkeit und Ausführlichkeit die künstlerische An-
schaulichkeit. Wir werden erst um das ganze Gebäude umhergeführt,
auf jedes einzelne Detail aufmerksam gemacht, dann in's Innere ge-
bracht und dort nach demselben Princip unterwiesen. Dabei aber
gewinnt man nur mühsam eine Gesammtanschauung. Besser würde
es daher sein, wenn der fleißige Vers, zuerst uns das Innere mit
wenigen Worten in seiner Grundanlage und Construktion darlegen,
dann zur Betrachtung des Einzelnen übergehen und endlich mit der
Gestaltung des Aeußeren schließen wollte.
Wir schreiten nun weiter mit dem Texte vor. In Nufringen
lernen wir eine kleine flachgedeckte gothische Arche mit gewölbtem
Chor und romanischem Thurm kennen. Eine Schallöffnung des
letzteren mit schlankem Säulchen, das ein Würfelkapitäl hat, sowie
eine Konsole und einen Gewölbeschlußstein giebt uns die Holzschnitt-
Illustration. Nicht reicher ist die Ausbeute in Böblingen, von
dessen einschiffiger Pfarrkirche nur der gothische Chor bemerkenswerth
erscheint. Dagegen bewahrt das alte Sindelfingen noch eine ro-
manische Stiftskirche, deren Grundriß aus Taf. IV. unter Fig. 2.
enthalten ist, und deren übrige architektonische Darstellung wir auf
Taf. III. bekommen. Hier ist nämlich der Längendurchschnitt und
zwei Aufrisse der Ostseite sammt zugehörigen Details mitgetheilt.
Es ist eine flachgedeckte Pfeilerbasilika ohne Querschisf und ohne
Thurmanlage. Sieben Pfeilerpaare trennen die drei gleich langen
Schiffe, welche mit drei Absiden schließen. Die beiden letzten Pfeiler-
abstände umfaßten den erhöhten Chorraum, unter welchen die Spu-
ren einer ehemaligen Krypte bemerklich sind. Alle Details dieser
Kirche zeigen den bereits zu einem festen System entwickelten roma-
nischen Styl, und wenn auch die erste Weihung von 1083 datirt,
und der Verfasser des Textes die Vollendung der Kirche bis an den
Beginn des 12. Jahrhunderts hinabrückt, so ist doch in allen De-
tails das Schema des romanischen Styles so fest begründet, im
Arkadensims, den Pfeilerbekrönungen und den Basen die Form der
attischen so bestimmt ausgesprochen, dazu die Pfeilerbildung mit ele-
ganten Halbsäulchen auf den Ecken eine so schlanke, daß wir den
Bau nicht älter als in die Mitte des 12. Jahrhunderts zu setzen
vermögen. Dazu kommen noch die Eckblätter an den Säulenfüßen,
die entwickelte Gestalt der Würselkapitäle, die durchweg ohne Schmuck
Vorkommen, die auf Konsolen ruhenden Rundbogenfriese des Aeuße-
ren. Die drei Absiden werden durch Pilaster mit Halbsäulen, welche
mit großen Blendbögen verbunden sind, gegliedert. Außer dem
Mangel des Kreuzschiffes sind noch andere Eigenthümlichkeiten an
der Kirche zu bemerken. So steht der Thurm ganz isolirt an der
Südseite der östlichen Theile. Dem Texte nach scheint er interessant
ausgebildet zu sein, was indeß leider durch keine Abbildung erläu-
tert wird. Sodann liegt dem südlichen Portal ein zweistöckiger An-
bau vor, dessen unteres, mit einem Tonnengewölbe bedecktes Geschoß
die Vorhalle bildet, während der obere, flachgedeckte mit der Kirche
durch offene Arkaden verbundene Theil eine Kapelle gewesen zu sein
scheint. Dafür spricht wenigstens die an seiner Ostseite auf einem
Tragstein aufruhende Halbkreisnische. Endlich scheint die Kirche noch
den alten romanischen Altartisch mit seinen Säulchen bewahrt zu
haben, und wir bedauern bei der Seltenheit so alter kirchlicher Mo-
biliargegenstände, daß wir von ihm keine größere Abbildung oder
deutliche Beschreibung erhalten.
Der übrige Theil der drei Lieferungen ist fast ausschließlich
den Denkmälern in Stuttgart gewidmet. Hier entfalten sich die
Mittheilungen in Wort und Bild bereits zu großem Reichthum und
geben uns einen Vorschmack von der Fülle künstlerischer Erzeugnisse,
die wir auf dem gesegneten Boden Schwabens zu erwarten haben.
Die Stiftskirche mit ihren zahlreichen Kunstwerken steht hier
obenan. An ihrer Stelle stand noch im 13. Jahrhundert ein Holz-
bau von geringem Umfang, der erst gegen 1321, als Graf Eber-
hard der Erlauchte sein Erbbegräbniß und das damit verbundene
Stift von Beutelspach hieher verlegte, erweitert wurde. Aber auch
jetzt noch geschah die Ausführung großentheils in Holz und nur der
Chor wurde in Stein erbaut. Von dieser Zeit rührt offenbar noch
der südliche Seitenthurm mit seinen beiden Treppenthürmchen, der
sich in die jetzige Gestalt der Kirche vordringlich hineinschiebt, und
dessen Aeußeres in den unteren Theilen die Merkmale des spätroma-
nischen Styles zeigt. Alle übrigen Theile der ziemlich ausgedehnten
Kirche datiren erst von dem im Jahre 1436 begonnenen Neubau,
der mit mehreren Unterbrechungen bis 1495 fortgeführt wurde, wäh-
rend der Bau des großen WestthurmeS von da ab noch bis zum
Jahre 1531 währte, so daß ein volles Jahrhundert mit der Vollen-
dung des ganzen Gebäudes verfloß.
Die Kirche zeigt in der großen, hier auf mächtigen Pfeilern
gegen das Innere sich öffnenden Thurmhalle, in dem Mangel eines
Querschiffs, wie in der Vorlage eines langgestreckten, aus dem Achteck
geschlossenen Chores Verwandtschaft mit der Stiftskirche zu Herren-
berg. Dagegen gestaltet sich ihr Langhaus durchaus verschieden, in-
dem das Mittelschiff sich weit über die Seitenschiffe erhebt. Wir
bedauern, daß der unklar angeordnete Text, sowie der Mangel einer
Totalansicht und eines Querdurchschnitts uns an der Anschauung
dieser Anlage verhindert. Sieben Pfeilerpaare (sammt den Thurm-
pfeilern) trennen die drei Schiffe, von denen die seitlichen dem mitt-
leren an Breite nicht viel nachgeben und durch Kapellen, die zwischen
die zum größeren Theil hineingezogenen Strebepfeiler angebaut sind,
an Raum noch gewinnen. Die Pfeiler sind ähnlich denen in Her-
renburg gebildet, doch in der Weise einer späteren Zeit. Auch die
Netzgewölbe sind noch reicher entwickelt als dort und in allen Haupt-
theilen von abweichender Mannigfaltigkeit der Combination. Alles
dies, so wie die Unregelmäßigkeiten, welche durch das Hineintreten
des alten Südthurmes, das entsprechende nördliche Abweichen des
betreffenden Bautheiles, so wie das wiederum (wie in Herrenburg)
nach Süden stattfindende Vorspringen der Chorlinie bewirkt werden,
geben der Kirche ein höchst malerisches Gepräge.
Von architektonischen Theilen lernen wir auf Taf. V. in treff-
lich ausgeführtem Stahlstich von P. Ritter nach einer Restauration
und Zeichnung des Herausgebers das Apostelthor kennen. Es ist
von bewunderungswürdiger Zierlichkeit der Arbeit, mit zahlreichen
auf's Sauberste in feinkörnigem Sandstein ausgeführten Statuen
und der Reliefdarstellung der Kreuztragung im Tympanon. Diese
Arbeiten legen glänzendes Zeugniß von der Gediegenheit ab, welche
die schwäbische Skulptur bereits im Mittelalter besaß. Aus noch
weit früherer Epoche rühren die beiden von Beutelspach bei der
Verlegung des Stiftes 1321 mit herübergebrachten Grabsteine des
Stifters Grafen Ulrich und seiner Gemalin Agnes, Herzogin von
Liegnitz (beide gestorben 1265). Sie sind in vorzüglich schönem
Stahlstich von Fr. Wagner auf Taf. VI. dargestellt. Ruhige,
würdevolle Gestalten von stiller Anmuth, von mehr idealer als
characteristischer Auffassung, in lang herabwallenden Gewändern von
edler Stylisirung und klarem, besonders bei der weiblichen Figur
schön motivirtem Faltenfluß. Bemerkenswerth sind besonders die
Nachrichten über die durchgängige Bemalung der Statuen. Darun-
ter sind noch zwei elegant romanische, schlankgebildete Blätterkapitäle
aus der südlichen Thurmhalle angebracht.
Weiterhin finden wir in meisterhaft behandelten, ungemein
characteristischen, lebensvollen Holzschnittdarstellungen mehrere andere
wichtige Skulpturwerke der Kirche. So eine Statue des Paulus
vom bereits erwähnten Apostelthor inschriftlich auö dem Jahre 1494,