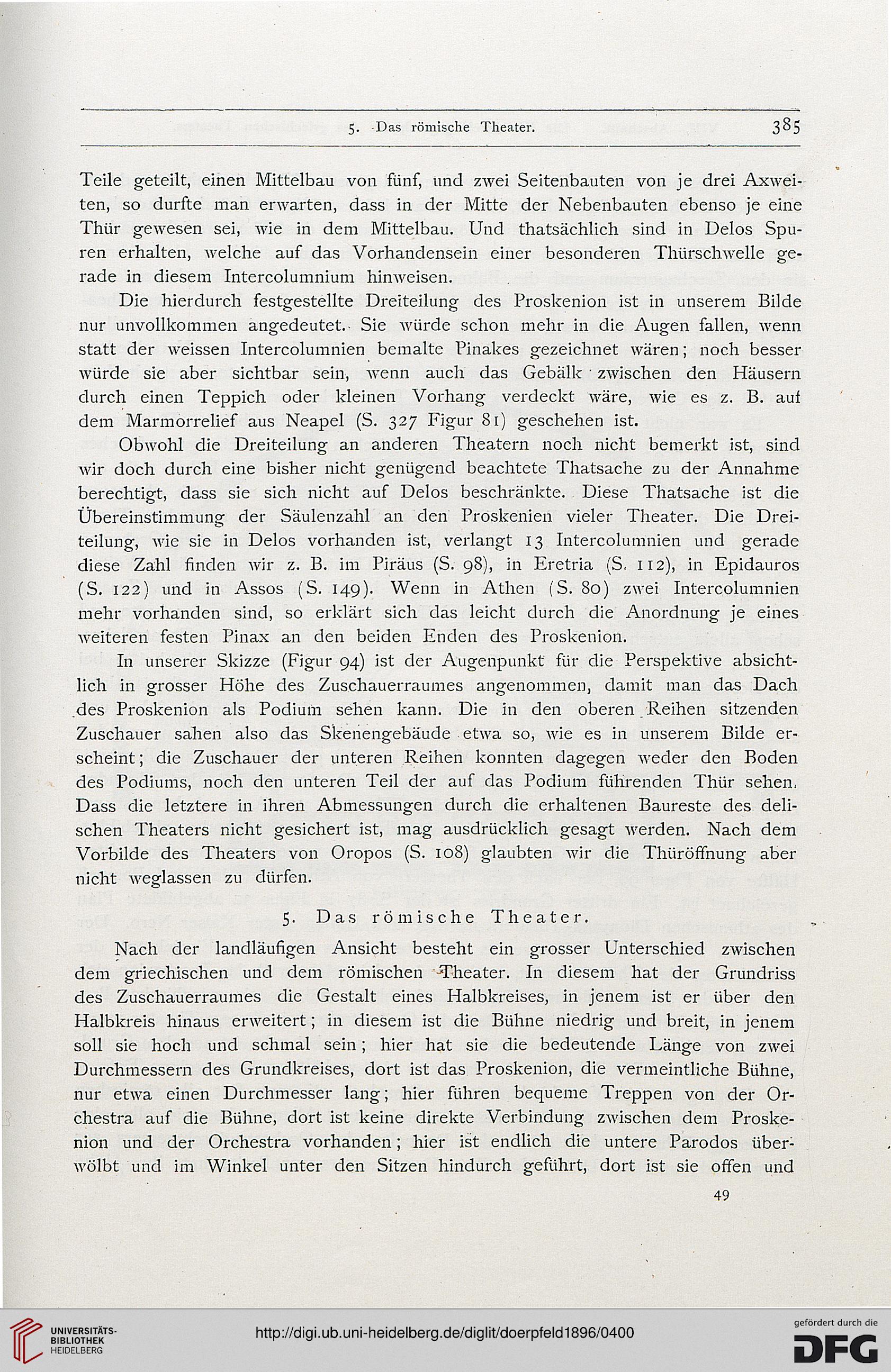5. Das römische Theater.
385
Teile geteilt, einen Mittelbau von fünf, und zwei Seitenbauten von je drei Axwei-
ten, so durfte man erwarten, dass in der Mitte der Nebenbauten ebenso je eine
Thür gewesen sei, wie in dem Mittelbau. Und thatsächlich sind in Delos Spu-
ren erhalten, welche auf das Vorhandensein einer besonderen Thürschwelle ge-
rade in diesem Intercolumnium hinweisen.
Die hierdurch festgestellte Dreiteilung des Proskenion ist in unserem Bilde
nur unvollkommen angedeutet. Sie würde schon mehr in die Augen fallen, wenn
statt der weissen Intercolumnien bemalte Pinakes gezeichnet wären; noch besser
würde sie aber sichtbar sein, wenn auch das Gebälk 1 zwischen den Häusern
durch einen Teppich oder kleinen Vorhang verdeckt wäre, wie es z. B. auf
dem Marmorrelief aus Neapel (S. 327 Figur 81) geschehen ist.
Obwohl die Dreiteilung an anderen Theatern noch nicht bemerkt ist, sind
wir doch durch eine bisher nicht genügend beachtete Thatsache zu der Annahme
berechtigt, dass sie sich nicht auf Delos beschränkte. Diese Thatsache ist die
Übereinstimmung der Säulenzahl an den Pröskenien vieler Theater. Die Drei-
teilung, wie sie in Delos vorhanden ist, verlangt 13 Intercolumnien und gerade
diese Zahl finden wir z. B. im Piräus (S. 98), in Eretria (S, 112), in Epidauros
(S. 122) und in Assos (S. 149). Wenn in Athen ('S. 80) zwei Intercolumnien
mehr vorhanden sind, so erklärt sich das leicht durch die Anordnung je eines
weiteren festen Pinax an den beiden linden des Proskenion.
In unserer Skizze (Figur 94) ist der Augenpunkt für die Perspektive absicht-
lich in grosser Höhe des Zuschauerraumes angenommen, damit man das Dach
des Proskenion als Podium sehen kann. Die in den oberen Reihen sitzenden
Zuschauer sahen also das Skenengebäude etwa so, Avie es in unserem Bilde er-
scheint ; die Zuschauer der unteren Reihen konnten dagegen weder den Boden
des Podiums, noch den unteren Teil der auf das Podium führenden Thür sehen,
Dass die letztere in ihren Abmessungen durch die erhaltenen Baureste des deli-
schen Theaters nicht gesichert ist, mag ausdrücklich gesagt werden. Nach dem
Vorbilde des Theaters von Oropos (S. 108) glaubten wir die Thüröffnung aber
nicht weglassen zu dürfen.
5. Das römische Theater.
Nach der landläufigen Ansicht besteht ein grosser Unterschied zwischen
dem griechischen und dem römischen Theater. In diesem hat der Grundriss
des Zuschauerraumes die Gestalt eines Halbkreises, in jenem ist er über den
Halbkreis hinaus erweitert; in diesem ist die Bühne niedrig und breit, in jenem
soll sie hoch und schmal sein; hier hat sie die bedeutende Länge von zwei
Durchmessern des Grundkreises, dort ist das Proskenion, die vermeintliche Bühne,
nur etwa einen Durchmesser lang; hier führen bequeme Treppen von der Or-
chestra auf die Bühne, dort ist keine direkte Verbindung zwischen dem Proske-
nion und der Orchestra vorhanden; hier ist endlich die untere Parodos über-
wölbt und im Winkel unter den Sitzen hindurch geführt, dort ist sie offen und
49
385
Teile geteilt, einen Mittelbau von fünf, und zwei Seitenbauten von je drei Axwei-
ten, so durfte man erwarten, dass in der Mitte der Nebenbauten ebenso je eine
Thür gewesen sei, wie in dem Mittelbau. Und thatsächlich sind in Delos Spu-
ren erhalten, welche auf das Vorhandensein einer besonderen Thürschwelle ge-
rade in diesem Intercolumnium hinweisen.
Die hierdurch festgestellte Dreiteilung des Proskenion ist in unserem Bilde
nur unvollkommen angedeutet. Sie würde schon mehr in die Augen fallen, wenn
statt der weissen Intercolumnien bemalte Pinakes gezeichnet wären; noch besser
würde sie aber sichtbar sein, wenn auch das Gebälk 1 zwischen den Häusern
durch einen Teppich oder kleinen Vorhang verdeckt wäre, wie es z. B. auf
dem Marmorrelief aus Neapel (S. 327 Figur 81) geschehen ist.
Obwohl die Dreiteilung an anderen Theatern noch nicht bemerkt ist, sind
wir doch durch eine bisher nicht genügend beachtete Thatsache zu der Annahme
berechtigt, dass sie sich nicht auf Delos beschränkte. Diese Thatsache ist die
Übereinstimmung der Säulenzahl an den Pröskenien vieler Theater. Die Drei-
teilung, wie sie in Delos vorhanden ist, verlangt 13 Intercolumnien und gerade
diese Zahl finden wir z. B. im Piräus (S. 98), in Eretria (S, 112), in Epidauros
(S. 122) und in Assos (S. 149). Wenn in Athen ('S. 80) zwei Intercolumnien
mehr vorhanden sind, so erklärt sich das leicht durch die Anordnung je eines
weiteren festen Pinax an den beiden linden des Proskenion.
In unserer Skizze (Figur 94) ist der Augenpunkt für die Perspektive absicht-
lich in grosser Höhe des Zuschauerraumes angenommen, damit man das Dach
des Proskenion als Podium sehen kann. Die in den oberen Reihen sitzenden
Zuschauer sahen also das Skenengebäude etwa so, Avie es in unserem Bilde er-
scheint ; die Zuschauer der unteren Reihen konnten dagegen weder den Boden
des Podiums, noch den unteren Teil der auf das Podium führenden Thür sehen,
Dass die letztere in ihren Abmessungen durch die erhaltenen Baureste des deli-
schen Theaters nicht gesichert ist, mag ausdrücklich gesagt werden. Nach dem
Vorbilde des Theaters von Oropos (S. 108) glaubten wir die Thüröffnung aber
nicht weglassen zu dürfen.
5. Das römische Theater.
Nach der landläufigen Ansicht besteht ein grosser Unterschied zwischen
dem griechischen und dem römischen Theater. In diesem hat der Grundriss
des Zuschauerraumes die Gestalt eines Halbkreises, in jenem ist er über den
Halbkreis hinaus erweitert; in diesem ist die Bühne niedrig und breit, in jenem
soll sie hoch und schmal sein; hier hat sie die bedeutende Länge von zwei
Durchmessern des Grundkreises, dort ist das Proskenion, die vermeintliche Bühne,
nur etwa einen Durchmesser lang; hier führen bequeme Treppen von der Or-
chestra auf die Bühne, dort ist keine direkte Verbindung zwischen dem Proske-
nion und der Orchestra vorhanden; hier ist endlich die untere Parodos über-
wölbt und im Winkel unter den Sitzen hindurch geführt, dort ist sie offen und
49