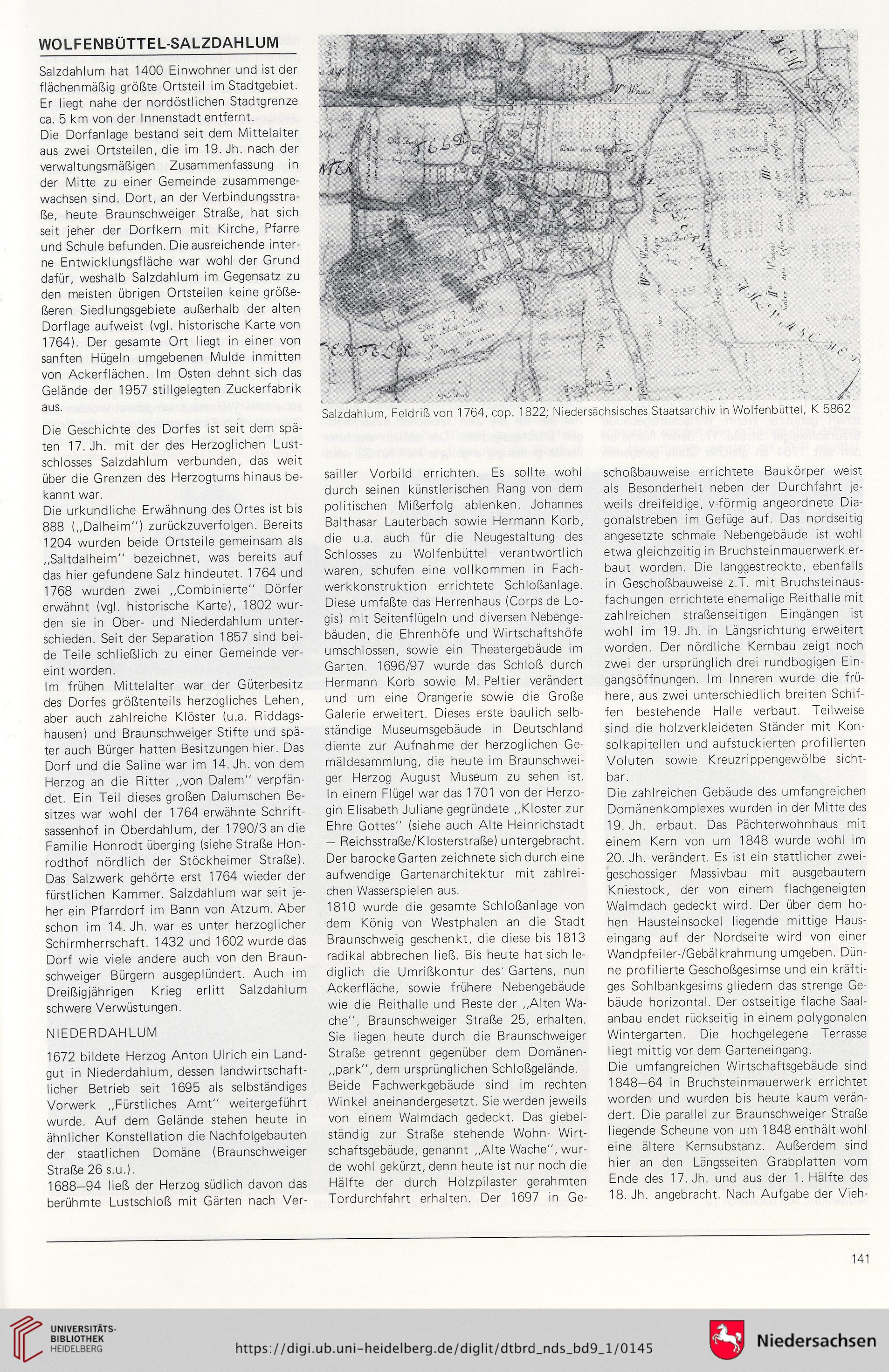WOLFENBÜTTEL-SALZDAHLUM
Salzdahlum hat 1400 Einwohner und ist der
flächenmäßig größte Ortsteil im Stadtgebiet.
Er liegt nahe der nordöstlichen Stadtgrenze
ca. 5 km von der Innenstadt entfernt.
Die Dorfanlage bestand seit dem Mittelalter
aus zwei Ortsteilen, die im 19. Jh. nach der
verwaltungsmäßigen Zusammenfassung in
der Mitte zu einer Gemeinde zusammenge-
wachsen sind. Dort, an der Verbindungsstra-
ße, heute Braunschweiger Straße, hat sich
seit jeher der Dorfkern mit Kirche, Pfarre
und Schule befunden. Die ausreichende inter-
ne Entwicklungsfläche war wohl der Grund
dafür, weshalb Salzdahlum im Gegensatz zu
den meisten übrigen Ortsteilen keine größe-
ßeren Siedlungsgebiete außerhalb der alten
Dorflage aufweist (vgl. historische Karte von
1764). Der gesamte Ort liegt in einer von
sanften Hügeln umgebenen Mulde inmitten
von Ackerflächen. Im Osten dehnt sich das
Gelände der 1957 stillgelegten Zuckerfabrik
aus.
Die Geschichte des Dorfes ist seit dem spä-
ten 17. Jh. mit der des Herzoglichen Lust-
schlosses Salzdahlum verbunden, das weit
über die Grenzen des Herzogtums hinaus be-
kannt war.
Die urkundliche Erwähnung des Ortes ist bis
888 („Dalheim") zurückzuverfolgen. Bereits
1204 wurden beide Ortsteile gemeinsam als
„Saltdalheim" bezeichnet, was bereits auf
das hier gefundene Salz hindeutet. 1764 und
1768 wurden zwei ,kombinierte" Dörfer
erwähnt (vgl. historische Karte), 1802 wur-
den sie in Ober- und Niederdahlum unter-
schieden. Seit der Separation 1857 sind bei-
de Teile schließlich zu einer Gemeinde ver-
eint worden.
Im frühen Mittelalter war der Güterbesitz
des Dorfes größtenteils herzogliches Lehen,
aber auch zahlreiche Klöster (u.a. Riddags-
hausen) und Braunschweiger Stifte und spä-
ter auch Bürger hatten Besitzungen hier. Das
Dorf und die Saline war im 14. Jh. von dem
Herzog an die Ritter „von Dalem" verpfän-
det. Ein Teil dieses großen Dalumschen Be-
sitzes war wohl der 1764 erwähnte Schrift-
sassenhof in Oberdahlum, der 1790/3 an die
Familie Honrodt überging (siehe Straße Hon-
rodthof nördlich der Stockheimer Straße).
Das Salzwerk gehörte erst 1764 wieder der
fürstlichen Kammer. Salzdahlum war seit je-
her ein Pfarrdorf im Bann von Atzum. Aber
schon im 14. Jh. war es unter herzoglicher
Schirmherrschaft. 1432 und 1602 wurde das
Dorf wie viele andere auch von den Braun-
schweiger Bürgern ausgeplündert. Auch im
Dreißigjährigen Krieg erlitt Salzdahlum
schwere Verwüstungen.
NIEDERDAHLUM
1672 bildete Herzog Anton Ulrich ein Land-
gut in Niederdahlum, dessen landwirtschaft-
licher Betrieb seit 1695 als selbständiges
Vorwerk „Fürstliches Amt" weitergeführt
wurde. Auf dem Gelände stehen heute in
ähnlicher Konstellation die Nachfolgebauten
der staatlichen Domäne (Braunschweiger
Straße 26 s.u.).
1688—94 ließ der Herzog südlich davon das
berühmte Lustschloß mit Gärten nach Ver-
Salzdahlum, Feldriß von 1 764, cop. 1822; Niedersächsisches Staatsarchiv in Wolfenbüttel, K 5862
sailler Vorbild errichten. Es sollte wohl
durch seinen künstlerischen Rang von dem
politischen Mißerfolg ablenken. Johannes
Balthasar Lauterbach sowie Hermann Korb,
die u.a. auch für die Neugestaltung des
Schlosses zu Wolfenbüttel verantwortlich
waren, schufen eine vollkommen in Fach-
werkkonstruktion errichtete Schloßanlage.
Diese umfaßte das Herrenhaus (Corps de Lo-
gis) mit Seitenflügeln und diversen Nebenge-
bäuden, die Ehrenhöfe und Wirtschaftshöfe
umschlossen, sowie ein Theatergebäude im
Garten. 1696/97 wurde das Schloß durch
Hermann Korb sowie M. Peltier verändert
und um eine Orangerie sowie die Große
Galerie erweitert. Dieses erste baulich selb-
ständige Museumsgebäude in Deutschland
diente zur Aufnahme der herzoglichen Ge-
mäldesammlung, die heute im Braunschwei-
ger Herzog August Museum zu sehen ist.
In einem Flügel war das 1701 von der Herzo-
gin Elisabeth Juliane gegründete „Kloster zur
Ehre Gottes" (siehe auch Alte Heinrichstadt
— Reichsstraße/Klosterstraße) untergebracht.
Der barocke Garten zeichnete sich durch eine
aufwendige Gartenarchitektur mit zahlrei-
chen Wasserspielen aus.
1810 wurde die gesamte Schloßanlage von
dem König von Westphalen an die Stadt
Braunschweig geschenkt, die diese bis 1813
radikal abbrechen ließ. Bis heute hat sich le-
diglich die Umrißkontur des' Gartens, nun
Ackerfläche, sowie frühere Nebengebäude
wie die Reithalle und Reste der „Alten Wa-
che", Braunschweiger Straße 25, erhalten.
Sie liegen heute durch die Braunschweiger
Straße getrennt gegenüber dem Domänen-
mark", dem ursprünglichen Schloßgelände.
Beide Fachwerkgebäude sind im rechten
Winkel aneinandergesetzt. Sie werden jeweils
von einem Walmdach gedeckt. Das giebel-
ständig zur Straße stehende Wohn- Wirt-
schaftsgebäude, genannt „Alte Wache", wur-
de wohl gekürzt, denn heute ist nur noch die
Hälfte der durch Holzpilaster gerahmten
Tordurchfahrt erhalten. Der 1697 in Ge-
schoßbauweise errichtete Baukörper weist
als Besonderheit neben der Durchfahrt je-
weils dreifeldige, v-förmig angeordnete Dia-
gonalstreben im Gefüge auf. Das nordseitig
angesetzte schmale Nebengebäude ist wohl
etwa gleichzeitig in Bruchsteinmauerwerk er-
baut worden. Die langgestreckte, ebenfalls
in Geschoßbauweise z.T. mit Bruchsteinaus-
fachungen errichtete ehemalige Reithalle mit
zahlreichen straßenseitigen Eingängen ist
wohl im 19. Jh. in Längsrichtung erweitert
worden. Der nördliche Kernbau zeigt noch
zwei der ursprünglich drei rundbogigen Ein-
gangsöffnungen. Im Inneren wurde die frü-
here, aus zwei unterschiedlich breiten Schif-
fen bestehende Halle verbaut. Teilweise
sind die holzverkleideten Ständer mit Kon-
solkapitellen und aufstuckierten profilierten
Voluten sowie Kreuzrippengewölbe sicht-
bar.
Die zahlreichen Gebäude des umfangreichen
Domänenkomplexes wurden in der Mitte des
19. Jh. erbaut. Das Pächterwohnhaus mit
einem Kern von um 1848 wurde wohl im
20. Jh. verändert. Es ist ein stattlicher zwei-
geschossiger Massivbau mit ausgebautem
Kniestock, der von einem flachgeneigten
Walmdach gedeckt wird. Der über dem ho-
hen Hausteinsockel liegende mittige Haus-
eingang auf der Nordseite wird von einer
Wandpfeiler-/Gebälkrahmung umgeben. Dün-
ne profilierte Geschoßgesimse und ein kräfti-
ges Sohlbankgesims gliedern das strenge Ge-
bäude horizontal. Der ostseitige flache Saal-
anbau endet rückseitig in einem polygonalen
Wintergarten. Die hochgelegene Terrasse
liegt mittig vor dem Garteneingang.
Die umfangreichen Wirtschaftsgebäude sind
1848—64 in Bruchsteinmauerwerk errichtet
worden und wurden bis heute kaum verän-
dert. Die parallel zur Braunschweiger Straße
liegende Scheune von um 1848 enthält wohl
eine ältere Kernsubstanz. Außerdem sind
hier an den Längsseiten Grabplatten vom
Ende des 17. Jh. und aus der 1. Hälfte des
18. Jh. angebracht. Nach Aufgabe der Vieh-
141
Salzdahlum hat 1400 Einwohner und ist der
flächenmäßig größte Ortsteil im Stadtgebiet.
Er liegt nahe der nordöstlichen Stadtgrenze
ca. 5 km von der Innenstadt entfernt.
Die Dorfanlage bestand seit dem Mittelalter
aus zwei Ortsteilen, die im 19. Jh. nach der
verwaltungsmäßigen Zusammenfassung in
der Mitte zu einer Gemeinde zusammenge-
wachsen sind. Dort, an der Verbindungsstra-
ße, heute Braunschweiger Straße, hat sich
seit jeher der Dorfkern mit Kirche, Pfarre
und Schule befunden. Die ausreichende inter-
ne Entwicklungsfläche war wohl der Grund
dafür, weshalb Salzdahlum im Gegensatz zu
den meisten übrigen Ortsteilen keine größe-
ßeren Siedlungsgebiete außerhalb der alten
Dorflage aufweist (vgl. historische Karte von
1764). Der gesamte Ort liegt in einer von
sanften Hügeln umgebenen Mulde inmitten
von Ackerflächen. Im Osten dehnt sich das
Gelände der 1957 stillgelegten Zuckerfabrik
aus.
Die Geschichte des Dorfes ist seit dem spä-
ten 17. Jh. mit der des Herzoglichen Lust-
schlosses Salzdahlum verbunden, das weit
über die Grenzen des Herzogtums hinaus be-
kannt war.
Die urkundliche Erwähnung des Ortes ist bis
888 („Dalheim") zurückzuverfolgen. Bereits
1204 wurden beide Ortsteile gemeinsam als
„Saltdalheim" bezeichnet, was bereits auf
das hier gefundene Salz hindeutet. 1764 und
1768 wurden zwei ,kombinierte" Dörfer
erwähnt (vgl. historische Karte), 1802 wur-
den sie in Ober- und Niederdahlum unter-
schieden. Seit der Separation 1857 sind bei-
de Teile schließlich zu einer Gemeinde ver-
eint worden.
Im frühen Mittelalter war der Güterbesitz
des Dorfes größtenteils herzogliches Lehen,
aber auch zahlreiche Klöster (u.a. Riddags-
hausen) und Braunschweiger Stifte und spä-
ter auch Bürger hatten Besitzungen hier. Das
Dorf und die Saline war im 14. Jh. von dem
Herzog an die Ritter „von Dalem" verpfän-
det. Ein Teil dieses großen Dalumschen Be-
sitzes war wohl der 1764 erwähnte Schrift-
sassenhof in Oberdahlum, der 1790/3 an die
Familie Honrodt überging (siehe Straße Hon-
rodthof nördlich der Stockheimer Straße).
Das Salzwerk gehörte erst 1764 wieder der
fürstlichen Kammer. Salzdahlum war seit je-
her ein Pfarrdorf im Bann von Atzum. Aber
schon im 14. Jh. war es unter herzoglicher
Schirmherrschaft. 1432 und 1602 wurde das
Dorf wie viele andere auch von den Braun-
schweiger Bürgern ausgeplündert. Auch im
Dreißigjährigen Krieg erlitt Salzdahlum
schwere Verwüstungen.
NIEDERDAHLUM
1672 bildete Herzog Anton Ulrich ein Land-
gut in Niederdahlum, dessen landwirtschaft-
licher Betrieb seit 1695 als selbständiges
Vorwerk „Fürstliches Amt" weitergeführt
wurde. Auf dem Gelände stehen heute in
ähnlicher Konstellation die Nachfolgebauten
der staatlichen Domäne (Braunschweiger
Straße 26 s.u.).
1688—94 ließ der Herzog südlich davon das
berühmte Lustschloß mit Gärten nach Ver-
Salzdahlum, Feldriß von 1 764, cop. 1822; Niedersächsisches Staatsarchiv in Wolfenbüttel, K 5862
sailler Vorbild errichten. Es sollte wohl
durch seinen künstlerischen Rang von dem
politischen Mißerfolg ablenken. Johannes
Balthasar Lauterbach sowie Hermann Korb,
die u.a. auch für die Neugestaltung des
Schlosses zu Wolfenbüttel verantwortlich
waren, schufen eine vollkommen in Fach-
werkkonstruktion errichtete Schloßanlage.
Diese umfaßte das Herrenhaus (Corps de Lo-
gis) mit Seitenflügeln und diversen Nebenge-
bäuden, die Ehrenhöfe und Wirtschaftshöfe
umschlossen, sowie ein Theatergebäude im
Garten. 1696/97 wurde das Schloß durch
Hermann Korb sowie M. Peltier verändert
und um eine Orangerie sowie die Große
Galerie erweitert. Dieses erste baulich selb-
ständige Museumsgebäude in Deutschland
diente zur Aufnahme der herzoglichen Ge-
mäldesammlung, die heute im Braunschwei-
ger Herzog August Museum zu sehen ist.
In einem Flügel war das 1701 von der Herzo-
gin Elisabeth Juliane gegründete „Kloster zur
Ehre Gottes" (siehe auch Alte Heinrichstadt
— Reichsstraße/Klosterstraße) untergebracht.
Der barocke Garten zeichnete sich durch eine
aufwendige Gartenarchitektur mit zahlrei-
chen Wasserspielen aus.
1810 wurde die gesamte Schloßanlage von
dem König von Westphalen an die Stadt
Braunschweig geschenkt, die diese bis 1813
radikal abbrechen ließ. Bis heute hat sich le-
diglich die Umrißkontur des' Gartens, nun
Ackerfläche, sowie frühere Nebengebäude
wie die Reithalle und Reste der „Alten Wa-
che", Braunschweiger Straße 25, erhalten.
Sie liegen heute durch die Braunschweiger
Straße getrennt gegenüber dem Domänen-
mark", dem ursprünglichen Schloßgelände.
Beide Fachwerkgebäude sind im rechten
Winkel aneinandergesetzt. Sie werden jeweils
von einem Walmdach gedeckt. Das giebel-
ständig zur Straße stehende Wohn- Wirt-
schaftsgebäude, genannt „Alte Wache", wur-
de wohl gekürzt, denn heute ist nur noch die
Hälfte der durch Holzpilaster gerahmten
Tordurchfahrt erhalten. Der 1697 in Ge-
schoßbauweise errichtete Baukörper weist
als Besonderheit neben der Durchfahrt je-
weils dreifeldige, v-förmig angeordnete Dia-
gonalstreben im Gefüge auf. Das nordseitig
angesetzte schmale Nebengebäude ist wohl
etwa gleichzeitig in Bruchsteinmauerwerk er-
baut worden. Die langgestreckte, ebenfalls
in Geschoßbauweise z.T. mit Bruchsteinaus-
fachungen errichtete ehemalige Reithalle mit
zahlreichen straßenseitigen Eingängen ist
wohl im 19. Jh. in Längsrichtung erweitert
worden. Der nördliche Kernbau zeigt noch
zwei der ursprünglich drei rundbogigen Ein-
gangsöffnungen. Im Inneren wurde die frü-
here, aus zwei unterschiedlich breiten Schif-
fen bestehende Halle verbaut. Teilweise
sind die holzverkleideten Ständer mit Kon-
solkapitellen und aufstuckierten profilierten
Voluten sowie Kreuzrippengewölbe sicht-
bar.
Die zahlreichen Gebäude des umfangreichen
Domänenkomplexes wurden in der Mitte des
19. Jh. erbaut. Das Pächterwohnhaus mit
einem Kern von um 1848 wurde wohl im
20. Jh. verändert. Es ist ein stattlicher zwei-
geschossiger Massivbau mit ausgebautem
Kniestock, der von einem flachgeneigten
Walmdach gedeckt wird. Der über dem ho-
hen Hausteinsockel liegende mittige Haus-
eingang auf der Nordseite wird von einer
Wandpfeiler-/Gebälkrahmung umgeben. Dün-
ne profilierte Geschoßgesimse und ein kräfti-
ges Sohlbankgesims gliedern das strenge Ge-
bäude horizontal. Der ostseitige flache Saal-
anbau endet rückseitig in einem polygonalen
Wintergarten. Die hochgelegene Terrasse
liegt mittig vor dem Garteneingang.
Die umfangreichen Wirtschaftsgebäude sind
1848—64 in Bruchsteinmauerwerk errichtet
worden und wurden bis heute kaum verän-
dert. Die parallel zur Braunschweiger Straße
liegende Scheune von um 1848 enthält wohl
eine ältere Kernsubstanz. Außerdem sind
hier an den Längsseiten Grabplatten vom
Ende des 17. Jh. und aus der 1. Hälfte des
18. Jh. angebracht. Nach Aufgabe der Vieh-
141