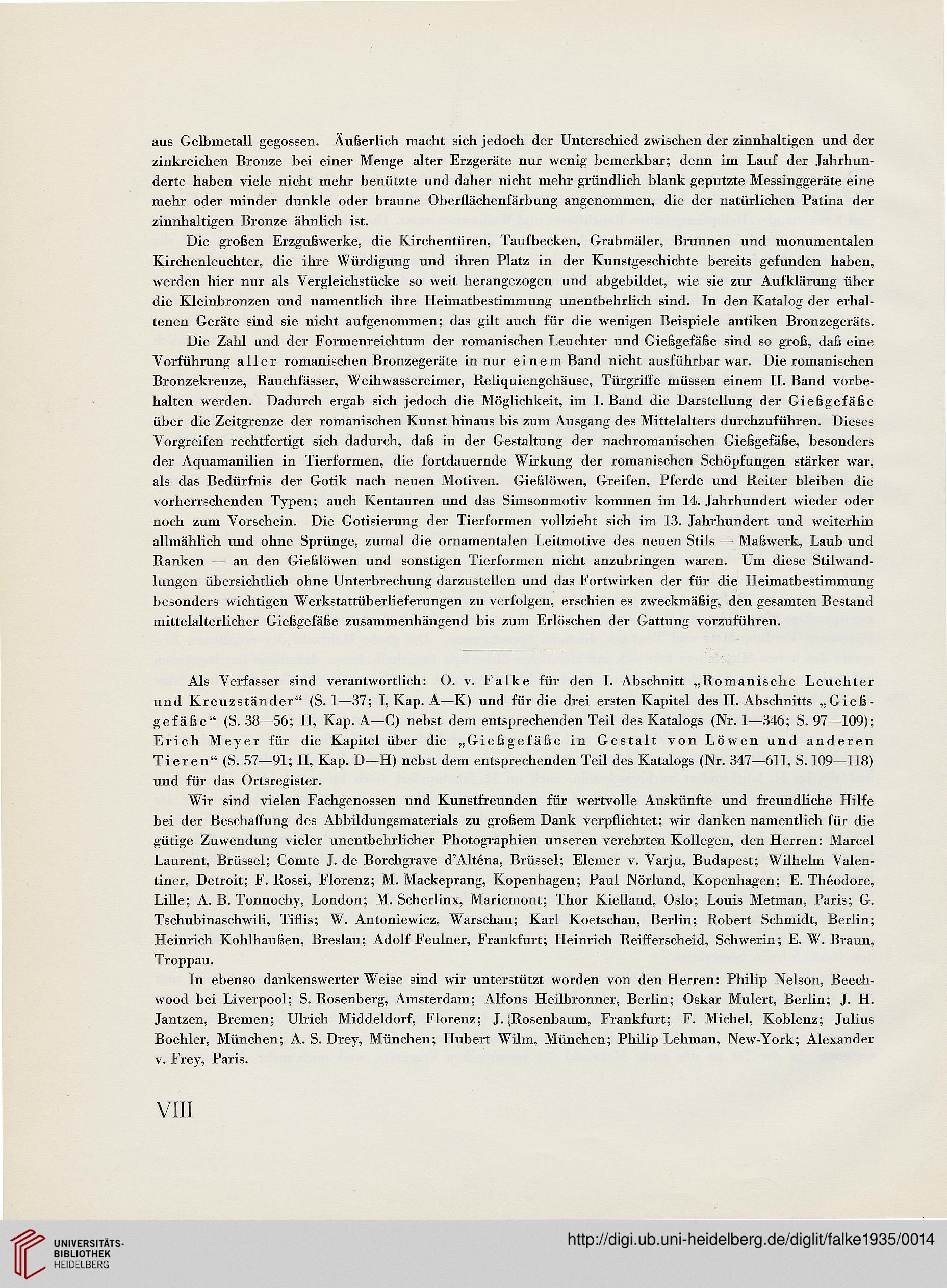aus Gelbmetall gegossen. Äußerlich macht sich jedoch der Unterschied zwischen der zinnhaltigen und der
zinkreichen Bronze bei einer Menge alter Erzgeräte nur wenig bemerkbar; denn im Lauf der Jahrhun-
derte haben viele nicht mehr benützte und daher nicht mehr gründlich blank geputzte Messinggeräte eine
mehr oder minder dunkle oder braune Oberflächenfärbung angenommen, die der natürlichen Patina der
zinnhaltigen Bronze ähnlich ist.
Die großen Erzgußwerke, die Kirchentüren, Taufbecken, Grabmäler, Brunnen und monumentalen
Kirchenleuchter, die ihre Würdigung und ihren Platz in der Kunstgeschichte bereits gefunden haben,
werden hier nur als Vergleichstücke so weit herangezogen und abgebildet, wie sie zur Aufklärung über
die Kleinbronzen und namentlich ihre Heimatbestimmung unentbehrlich sind. In den Katalog der erhal-
tenen Geräte sind sie nicht aufgenommen; das gilt auch für die wenigen Beispiele antiken Bronzegeräts.
Die Zahl und der Formenreichtum der romanischen Leuchter und Gießgefäße sind so groß, daß eine
Vorführung aller romanischen Bronzegeräte in nur einem Band nicht ausführbar war. Die romanischen
Bronzekreuze, Rauchfässer, Weihwassereimer, Reliquiengehäuse, Türgriffe müssen einem IL Band vorbe-
halten werden. Dadurch ergab sich jedoch die Möglichkeit, im I. Band die Darstellung der Gießgefäße
über die Zeitgrenze der romanischen Kunst hinaus bis zum Ausgang des Mittelalters durchzuführen. Dieses
Vorgreifen rechtfertigt sich dadurch, daß in der Gestaltung der nachromanischen Gießgefäße, besonders
der Aquamanilien in Tierformen, die fortdauernde Wirkung der romanischen Schöpfungen stärker war,
als das Bedürfnis der Gotik nach neuen Motiven. Gießlöwen, Greifen, Pferde und Reiter bleiben die
vorherrschenden Typen; auch Kentauren und das Simsonmotiv kommen im 14. Jahrhundert wieder oder
noch zum Vorschein. Die Gotisierung der Tierformen vollzieht sich im 13. Jahrhundert und weiterhin
allmählich und ohne Sprünge, zumal die ornamentalen Leitmotive des neuen Stils — Maßwerk, Laub und
Ranken — an den Gießlöwen und sonstigen Tierformen nicht anzubringen waren. Um diese Stilwand-
lungen übersichtlich ohne Unterbrechung darzustellen und das Fortwirken der für die Heimatbestimmung
besonders wichtigen Werkstattüberlieferungen zu verfolgen, erschien es zweckmäßig, den gesamten Bestand
mittelalterlicher Gießgefäße zusammenhängend bis zum Erlöschen der Gattung vorzuführen.
Als Verfasser sind verantwortlich: O. v. Falke für den I. Abschnitt „Romanische Leuchter
und Kreuzständer" (S. 1—37; I, Kap. A—K) und für die drei ersten Kapitel des II. Abschnitts „Gieß-
gefäße" (S. 38—56; II, Kap. A—C) nebst dem entsprechenden Teil des Katalogs (Nr. 1—346; S. 97—109);
Erich Meyer für die Kapitel über die „Gießgefäße in Gestalt von Löwen und anderen
Tieren" (S. 57—91; II, Kap. D—H) nebst dem entsprechenden Teil des Katalogs (Nr. 347—611, S. 109—118)
und für das Ortsregister.
Wir sind vielen Fachgenossen und Kunstfreunden für wertvolle Auskünfte und freundliche Hilfe
bei der Beschaffung des Abbildungsmaterials zu großem Dank verpflichtet; wir danken namentlich für die
gütige Zuwendung vieler unentbehrlicher Photographien unseren verehrten Kollegen, den Herren: Marcel
Laurent, Brüssel; Comte J. de Borchgrave d'Altena, Brüssel; Elemer v. Varju, Budapest; Wilhelm Valen-
tiner, Detroit; F. Rossi, Florenz; M. Mackeprang, Kopenhagen; Paul Nörlund, Kopenhagen; E. Theodore,
Lille; A. B. Tonnochy, London; M. Scherlinx, Mariemont; Thor Kielland, Oslo; Louis Metman, Paris; G.
Tschubinaschwili, Tiflis; W. Antoniewicz, Warschau; Karl Koetschau, Berlin; Robert Schmidt, Berlin;
Heinrich Kohlhaußen, Breslau; Adolf Feulner, Frankfurt; Heinrich Reifferscheid, Schwerin; E.W.Braun,
Troppau.
In ebenso dankenswerter Weise sind wir unterstützt worden von den Herren: Philip Nelson, Beech-
wood bei Liverpool; S. Rosenberg, Amsterdam; Alfons Heilbronner, Berlin; Oskar Mulert, Berlin; J. H.
Jantzen, Bremen; Ulrich Middeldorf, Florenz; J. [Rosenbaum, Frankfurt; F. Michel, Koblenz; Julius
Boehler, München; A. S. Drey, München; Hubert Wilm, München; Philip Lehman, New-York; Alexander
v. Frey, Paris.
VIII
zinkreichen Bronze bei einer Menge alter Erzgeräte nur wenig bemerkbar; denn im Lauf der Jahrhun-
derte haben viele nicht mehr benützte und daher nicht mehr gründlich blank geputzte Messinggeräte eine
mehr oder minder dunkle oder braune Oberflächenfärbung angenommen, die der natürlichen Patina der
zinnhaltigen Bronze ähnlich ist.
Die großen Erzgußwerke, die Kirchentüren, Taufbecken, Grabmäler, Brunnen und monumentalen
Kirchenleuchter, die ihre Würdigung und ihren Platz in der Kunstgeschichte bereits gefunden haben,
werden hier nur als Vergleichstücke so weit herangezogen und abgebildet, wie sie zur Aufklärung über
die Kleinbronzen und namentlich ihre Heimatbestimmung unentbehrlich sind. In den Katalog der erhal-
tenen Geräte sind sie nicht aufgenommen; das gilt auch für die wenigen Beispiele antiken Bronzegeräts.
Die Zahl und der Formenreichtum der romanischen Leuchter und Gießgefäße sind so groß, daß eine
Vorführung aller romanischen Bronzegeräte in nur einem Band nicht ausführbar war. Die romanischen
Bronzekreuze, Rauchfässer, Weihwassereimer, Reliquiengehäuse, Türgriffe müssen einem IL Band vorbe-
halten werden. Dadurch ergab sich jedoch die Möglichkeit, im I. Band die Darstellung der Gießgefäße
über die Zeitgrenze der romanischen Kunst hinaus bis zum Ausgang des Mittelalters durchzuführen. Dieses
Vorgreifen rechtfertigt sich dadurch, daß in der Gestaltung der nachromanischen Gießgefäße, besonders
der Aquamanilien in Tierformen, die fortdauernde Wirkung der romanischen Schöpfungen stärker war,
als das Bedürfnis der Gotik nach neuen Motiven. Gießlöwen, Greifen, Pferde und Reiter bleiben die
vorherrschenden Typen; auch Kentauren und das Simsonmotiv kommen im 14. Jahrhundert wieder oder
noch zum Vorschein. Die Gotisierung der Tierformen vollzieht sich im 13. Jahrhundert und weiterhin
allmählich und ohne Sprünge, zumal die ornamentalen Leitmotive des neuen Stils — Maßwerk, Laub und
Ranken — an den Gießlöwen und sonstigen Tierformen nicht anzubringen waren. Um diese Stilwand-
lungen übersichtlich ohne Unterbrechung darzustellen und das Fortwirken der für die Heimatbestimmung
besonders wichtigen Werkstattüberlieferungen zu verfolgen, erschien es zweckmäßig, den gesamten Bestand
mittelalterlicher Gießgefäße zusammenhängend bis zum Erlöschen der Gattung vorzuführen.
Als Verfasser sind verantwortlich: O. v. Falke für den I. Abschnitt „Romanische Leuchter
und Kreuzständer" (S. 1—37; I, Kap. A—K) und für die drei ersten Kapitel des II. Abschnitts „Gieß-
gefäße" (S. 38—56; II, Kap. A—C) nebst dem entsprechenden Teil des Katalogs (Nr. 1—346; S. 97—109);
Erich Meyer für die Kapitel über die „Gießgefäße in Gestalt von Löwen und anderen
Tieren" (S. 57—91; II, Kap. D—H) nebst dem entsprechenden Teil des Katalogs (Nr. 347—611, S. 109—118)
und für das Ortsregister.
Wir sind vielen Fachgenossen und Kunstfreunden für wertvolle Auskünfte und freundliche Hilfe
bei der Beschaffung des Abbildungsmaterials zu großem Dank verpflichtet; wir danken namentlich für die
gütige Zuwendung vieler unentbehrlicher Photographien unseren verehrten Kollegen, den Herren: Marcel
Laurent, Brüssel; Comte J. de Borchgrave d'Altena, Brüssel; Elemer v. Varju, Budapest; Wilhelm Valen-
tiner, Detroit; F. Rossi, Florenz; M. Mackeprang, Kopenhagen; Paul Nörlund, Kopenhagen; E. Theodore,
Lille; A. B. Tonnochy, London; M. Scherlinx, Mariemont; Thor Kielland, Oslo; Louis Metman, Paris; G.
Tschubinaschwili, Tiflis; W. Antoniewicz, Warschau; Karl Koetschau, Berlin; Robert Schmidt, Berlin;
Heinrich Kohlhaußen, Breslau; Adolf Feulner, Frankfurt; Heinrich Reifferscheid, Schwerin; E.W.Braun,
Troppau.
In ebenso dankenswerter Weise sind wir unterstützt worden von den Herren: Philip Nelson, Beech-
wood bei Liverpool; S. Rosenberg, Amsterdam; Alfons Heilbronner, Berlin; Oskar Mulert, Berlin; J. H.
Jantzen, Bremen; Ulrich Middeldorf, Florenz; J. [Rosenbaum, Frankfurt; F. Michel, Koblenz; Julius
Boehler, München; A. S. Drey, München; Hubert Wilm, München; Philip Lehman, New-York; Alexander
v. Frey, Paris.
VIII