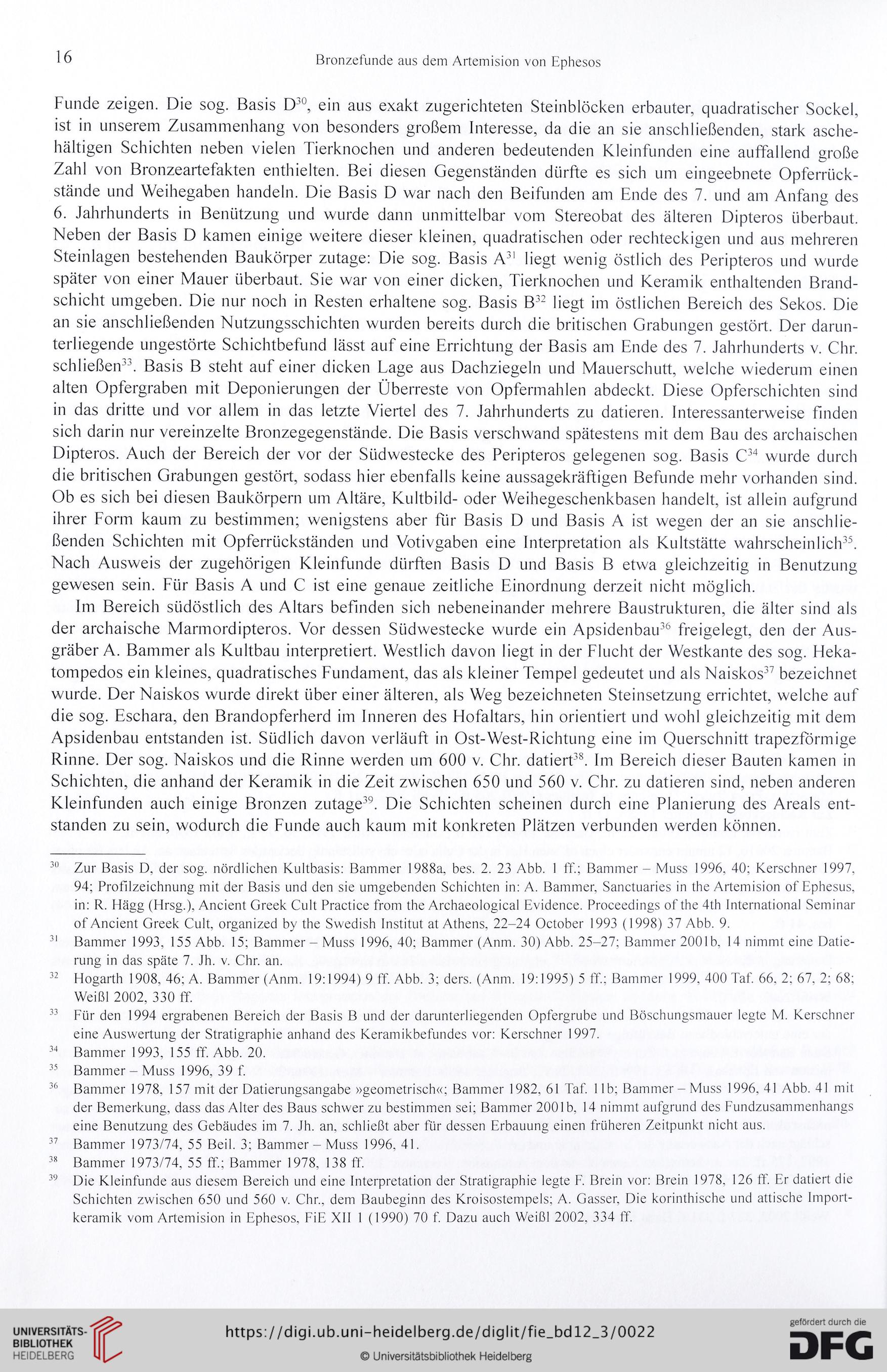16
Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos
Funde zeigen. Die sog. Basis D’°, ein aus exakt zugerichteten Steinblöcken erbauter, quadratischer Sockel,
ist in unserem Zusammenhang von besonders großem Interesse, da die an sie anschließenden, stark asche-
hältigen Schichten neben vielen Tierknochen und anderen bedeutenden Kleinfunden eine auffallend große
Zahl von Bronzeartefakten enthielten. Bei diesen Gegenständen dürfte es sich um eingeebnete Opferrück-
stände und Weihegaben handeln. Die Basis D war nach den Beifunden am Ende des 7. und am Anfang des
6. Jahrhunderts in Benützung und wurde dann unmittelbar vom Stereobat des älteren Dipteros überbaut.
Neben der Basis D kamen einige weitere dieser kleinen, quadratischen oder rechteckigen und aus mehreren
Steinlagen bestehenden Baukörper zutage: Die sog. Basis A31 liegt wenig östlich des Peripteros und wurde
später von einer Mauer überbaut. Sie war von einer dicken, Tierknochen und Keramik enthaltenden Brand-
schicht umgeben. Die nur noch in Resten erhaltene sog. Basis B32 liegt im östlichen Bereich des Sekos. Die
an sie anschließenden Nutzungsschichten wurden bereits durch die britischen Grabungen gestört. Der darun-
terliegende ungestörte Schichtbefund lässt auf eine Errichtung der Basis am Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr.
schließen33. Basis B steht auf einer dicken Lage aus Dachziegeln und Mauerschutt, welche wiederum einen
alten Opfergraben mit Deponierungen der Überreste von Opfermahlen abdeckt. Diese Opferschichten sind
in das dritte und vor allem in das letzte Viertel des 7. Jahrhunderts zu datieren. Interessanterweise finden
sich darin nur vereinzelte Bronzegegenstände. Die Basis verschwand spätestens mit dem Bau des archaischen
Dipteros. Auch der Bereich der vor der Südwestecke des Peripteros gelegenen sog. Basis C34 wurde durch
die britischen Grabungen gestört, sodass hier ebenfalls keine aussagekräftigen Befunde mehr vorhanden sind.
Ob es sich bei diesen Baukörpern um Altäre, Kultbild- oder Weihegeschenkbasen handelt, ist allein aufgrund
ihrer Form kaum zu bestimmen; wenigstens aber für Basis D und Basis A ist wegen der an sie anschlie-
ßenden Schichten mit Opferrückständen und Votivgaben eine Interpretation als Kultstätte wahrscheinlich35.
Nach Ausweis der zugehörigen Kleinfunde dürften Basis D und Basis B etwa gleichzeitig in Benutzung
gewesen sein. Für Basis A und C ist eine genaue zeitliche Einordnung derzeit nicht möglich.
Im Bereich südöstlich des Altars befinden sich nebeneinander mehrere Baustrukturen, die älter sind als
der archaische Marmordipteros. Vor dessen Südwestecke wurde ein Apsidenbau36 freigelegt, den der Aus-
gräber A. Bammer als Kultbau interpretiert. Westlich davon liegt in der Flucht der Westkante des sog. Heka-
tompedos ein kleines, quadratisches Fundament, das als kleiner Tempel gedeutet und als Naiskos37 bezeichnet
wurde. Der Naiskos wurde direkt über einer älteren, als Weg bezeichneten Steinsetzung errichtet, welche auf
die sog. Eschara, den Brandopferherd im Inneren des Hofaltars, hin orientiert und wohl gleichzeitig mit dem
Apsidenbau entstanden ist. Südlich davon verläuft in Ost-West-Richtung eine im Querschnitt trapezförmige
Rinne. Der sog. Naiskos und die Rinne werden um 600 v. Chr. datiert38. Im Bereich dieser Bauten kamen in
Schichten, die anhand der Keramik in die Zeit zwischen 650 und 560 v. Chr. zu datieren sind, neben anderen
Kleinfunden auch einige Bronzen zutage39. Die Schichten scheinen durch eine Planierung des Areals ent-
standen zu sein, wodurch die Funde auch kaum mit konkreten Plätzen verbunden werden können.
30 Zur Basis D. der sog. nördlichen Kultbasis: Bammer 1988a. bes. 2. 23 Abb. 1 ff.; Bammer - Muss 1996. 40; Kerschner 1997,
94; Profilzeichnung mit der Basis und den sie umgebenden Schichten in: A. Bammer, Sanctuaries in the Artemision of Ephesus,
in: R. Hägg (Hrsg.), Ancient Greek Cult Practice from the Archaeological Evidence. Proceedings of the 4th International Seminar
of Ancient Greek Cult, organized by the Swedish Institut at Athens. 22-24 October 1993 (1998) 37 Abb. 9.
31 Bammer 1993, 155 Abb. 15; Bammer - Muss 1996, 40: Bammer (Anm. 30) Abb. 25-27; Bammer 2001 b, 14 nimmt eine Datie-
rung in das späte 7. ,1h. v. Chr. an.
32 Hogarth 1908, 46; A. Bammer (Anm. 19:1994) 9 ff. Abb. 3; ders. (Anm. 19:1995) 5 ff.; Bammer 1999, 400 Taf. 66. 2; 67. 2; 68:
Weißl 2002, 330 ff.
33 Für den 1994 ergrabenen Bereich der Basis B und der darunterliegenden Opfergrube und Böschungsmauer legte M. Kerschner
eine Auswertung der Stratigraphie anhand des Keramikbefundes vor: Kerschner 1997.
34 Bammer 1993, 155 ff. Abb. 20.
35 Bammer - Muss 1996, 39 f.
36 Bammer 1978. 157 mit der Datierungsangabe »geometrisch«: Bammer 1982. 61 Taf. 11 b; Bammer - Muss 1996, 41 Abb. 41 mit
der Bemerkung, dass das Alter des Baus schwer zu bestimmen sei; Bammer 2001 b. 14 nimmt aufgrund des Fundzusammenhangs
eine Benutzung des Gebäudes im 7. Jh. an. schließt aber für dessen Erbauung einen früheren Zeitpunkt nicht aus.
37 Bammer 1973/74. 55 Beil. 3: Bammer - Muss 1996. 41.
38 Bammer 1973/74. 55 ff.: Bammer 1978. 138 ff.
39 Die Kleinfunde aus diesem Bereich und eine Interpretation der Stratigraphie legte F. Brein vor: Brein 1978. 126 ff. Er datiert die
Schichten zwischen 650 und 560 v. Chr., dem Baubeginn des Kroisostempels; A. Gasser, Die korinthische und attische Import-
keramik vom Artemision in Ephesos, FiE XII 1 (1990) 70 f. Dazu auch Weißl 2002. 334 ff.
Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos
Funde zeigen. Die sog. Basis D’°, ein aus exakt zugerichteten Steinblöcken erbauter, quadratischer Sockel,
ist in unserem Zusammenhang von besonders großem Interesse, da die an sie anschließenden, stark asche-
hältigen Schichten neben vielen Tierknochen und anderen bedeutenden Kleinfunden eine auffallend große
Zahl von Bronzeartefakten enthielten. Bei diesen Gegenständen dürfte es sich um eingeebnete Opferrück-
stände und Weihegaben handeln. Die Basis D war nach den Beifunden am Ende des 7. und am Anfang des
6. Jahrhunderts in Benützung und wurde dann unmittelbar vom Stereobat des älteren Dipteros überbaut.
Neben der Basis D kamen einige weitere dieser kleinen, quadratischen oder rechteckigen und aus mehreren
Steinlagen bestehenden Baukörper zutage: Die sog. Basis A31 liegt wenig östlich des Peripteros und wurde
später von einer Mauer überbaut. Sie war von einer dicken, Tierknochen und Keramik enthaltenden Brand-
schicht umgeben. Die nur noch in Resten erhaltene sog. Basis B32 liegt im östlichen Bereich des Sekos. Die
an sie anschließenden Nutzungsschichten wurden bereits durch die britischen Grabungen gestört. Der darun-
terliegende ungestörte Schichtbefund lässt auf eine Errichtung der Basis am Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr.
schließen33. Basis B steht auf einer dicken Lage aus Dachziegeln und Mauerschutt, welche wiederum einen
alten Opfergraben mit Deponierungen der Überreste von Opfermahlen abdeckt. Diese Opferschichten sind
in das dritte und vor allem in das letzte Viertel des 7. Jahrhunderts zu datieren. Interessanterweise finden
sich darin nur vereinzelte Bronzegegenstände. Die Basis verschwand spätestens mit dem Bau des archaischen
Dipteros. Auch der Bereich der vor der Südwestecke des Peripteros gelegenen sog. Basis C34 wurde durch
die britischen Grabungen gestört, sodass hier ebenfalls keine aussagekräftigen Befunde mehr vorhanden sind.
Ob es sich bei diesen Baukörpern um Altäre, Kultbild- oder Weihegeschenkbasen handelt, ist allein aufgrund
ihrer Form kaum zu bestimmen; wenigstens aber für Basis D und Basis A ist wegen der an sie anschlie-
ßenden Schichten mit Opferrückständen und Votivgaben eine Interpretation als Kultstätte wahrscheinlich35.
Nach Ausweis der zugehörigen Kleinfunde dürften Basis D und Basis B etwa gleichzeitig in Benutzung
gewesen sein. Für Basis A und C ist eine genaue zeitliche Einordnung derzeit nicht möglich.
Im Bereich südöstlich des Altars befinden sich nebeneinander mehrere Baustrukturen, die älter sind als
der archaische Marmordipteros. Vor dessen Südwestecke wurde ein Apsidenbau36 freigelegt, den der Aus-
gräber A. Bammer als Kultbau interpretiert. Westlich davon liegt in der Flucht der Westkante des sog. Heka-
tompedos ein kleines, quadratisches Fundament, das als kleiner Tempel gedeutet und als Naiskos37 bezeichnet
wurde. Der Naiskos wurde direkt über einer älteren, als Weg bezeichneten Steinsetzung errichtet, welche auf
die sog. Eschara, den Brandopferherd im Inneren des Hofaltars, hin orientiert und wohl gleichzeitig mit dem
Apsidenbau entstanden ist. Südlich davon verläuft in Ost-West-Richtung eine im Querschnitt trapezförmige
Rinne. Der sog. Naiskos und die Rinne werden um 600 v. Chr. datiert38. Im Bereich dieser Bauten kamen in
Schichten, die anhand der Keramik in die Zeit zwischen 650 und 560 v. Chr. zu datieren sind, neben anderen
Kleinfunden auch einige Bronzen zutage39. Die Schichten scheinen durch eine Planierung des Areals ent-
standen zu sein, wodurch die Funde auch kaum mit konkreten Plätzen verbunden werden können.
30 Zur Basis D. der sog. nördlichen Kultbasis: Bammer 1988a. bes. 2. 23 Abb. 1 ff.; Bammer - Muss 1996. 40; Kerschner 1997,
94; Profilzeichnung mit der Basis und den sie umgebenden Schichten in: A. Bammer, Sanctuaries in the Artemision of Ephesus,
in: R. Hägg (Hrsg.), Ancient Greek Cult Practice from the Archaeological Evidence. Proceedings of the 4th International Seminar
of Ancient Greek Cult, organized by the Swedish Institut at Athens. 22-24 October 1993 (1998) 37 Abb. 9.
31 Bammer 1993, 155 Abb. 15; Bammer - Muss 1996, 40: Bammer (Anm. 30) Abb. 25-27; Bammer 2001 b, 14 nimmt eine Datie-
rung in das späte 7. ,1h. v. Chr. an.
32 Hogarth 1908, 46; A. Bammer (Anm. 19:1994) 9 ff. Abb. 3; ders. (Anm. 19:1995) 5 ff.; Bammer 1999, 400 Taf. 66. 2; 67. 2; 68:
Weißl 2002, 330 ff.
33 Für den 1994 ergrabenen Bereich der Basis B und der darunterliegenden Opfergrube und Böschungsmauer legte M. Kerschner
eine Auswertung der Stratigraphie anhand des Keramikbefundes vor: Kerschner 1997.
34 Bammer 1993, 155 ff. Abb. 20.
35 Bammer - Muss 1996, 39 f.
36 Bammer 1978. 157 mit der Datierungsangabe »geometrisch«: Bammer 1982. 61 Taf. 11 b; Bammer - Muss 1996, 41 Abb. 41 mit
der Bemerkung, dass das Alter des Baus schwer zu bestimmen sei; Bammer 2001 b. 14 nimmt aufgrund des Fundzusammenhangs
eine Benutzung des Gebäudes im 7. Jh. an. schließt aber für dessen Erbauung einen früheren Zeitpunkt nicht aus.
37 Bammer 1973/74. 55 Beil. 3: Bammer - Muss 1996. 41.
38 Bammer 1973/74. 55 ff.: Bammer 1978. 138 ff.
39 Die Kleinfunde aus diesem Bereich und eine Interpretation der Stratigraphie legte F. Brein vor: Brein 1978. 126 ff. Er datiert die
Schichten zwischen 650 und 560 v. Chr., dem Baubeginn des Kroisostempels; A. Gasser, Die korinthische und attische Import-
keramik vom Artemision in Ephesos, FiE XII 1 (1990) 70 f. Dazu auch Weißl 2002. 334 ff.