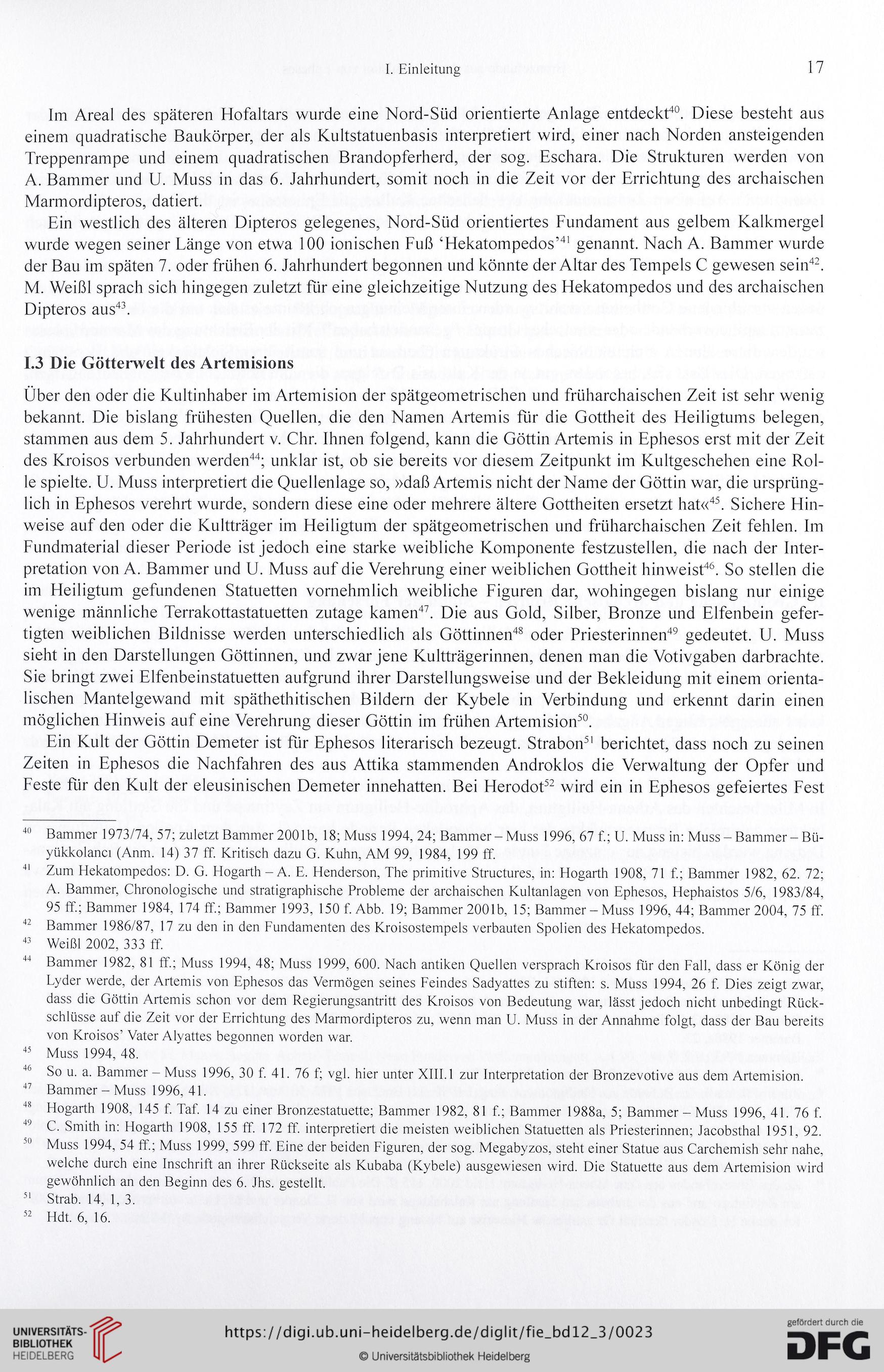I. Einleitung
17
Im Areal des späteren Hofaltars wurde eine Nord-Süd orientierte Anlage entdeckt40. Diese besteht aus
einem quadratische Baukörper, der als Kultstatuenbasis interpretiert wird, einer nach Norden ansteigenden
Treppenrampe und einem quadratischen Brandopferherd, der sog. Eschara. Die Strukturen werden von
A. Bammer und U. Muss in das 6. Jahrhundert, somit noch in die Zeit vor der Errichtung des archaischen
Marmordipteros, datiert.
Ein westlich des älteren Dipteros gelegenes, Nord-Süd orientiertes Fundament aus gelbem Kalkmergel
wurde wegen seiner Länge von etwa 100 ionischen Fuß ‘Hekatompedos’41 genannt. Nach A. Bammer wurde
der Bau im späten 7. oder frühen 6. Jahrhundert begonnen und könnte der Altar des Tempels C gewesen sein42.
M. Weißl sprach sich hingegen zuletzt für eine gleichzeitige Nutzung des Hekatompedos und des archaischen
Dipteros aus43.
1.3 Die Göttenvelt des Artemisions
Über den oder die Kultinhaber im Artemision der spätgeometrischen und früharchaischen Zeit ist sehr wenig
bekannt. Die bislang frühesten Quellen, die den Namen Artemis für die Gottheit des Heiligtums belegen,
stammen aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. Ihnen folgend, kann die Göttin Artemis in Ephesos erst mit der Zeit
des Kroisos verbunden werden44; unklar ist, ob sie bereits vor diesem Zeitpunkt im Kultgeschehen eine Rol-
le spielte. U. Muss interpretiert die Quellenlage so, »daß Artemis nicht der Name der Göttin war, die ursprüng-
lich in Ephesos verehrt wurde, sondern diese eine oder mehrere ältere Gottheiten ersetzt hat«45. Sichere Hin-
weise auf den oder die Kultträger im Heiligtum der spätgeometrischen und früharchaischen Zeit fehlen. Im
Fundmaterial dieser Periode ist jedoch eine starke weibliche Komponente festzustellen, die nach der Inter-
pretation von A. Bammer und U. Muss auf die Verehrung einer weiblichen Gottheit hinweist46. So stellen die
im Heiligtum gefundenen Statuetten vornehmlich weibliche Figuren dar, wohingegen bislang nur einige
wenige männliche Terrakottastatuetten zutage kamen47. Die aus Gold, Silber, Bronze und Elfenbein gefer-
tigten weiblichen Bildnisse werden unterschiedlich als Göttinnen48 oder Priesterinnen49 gedeutet. U. Muss
sieht in den Darstellungen Göttinnen, und zwar jene Kultträgerinnen, denen man die Votivgaben darbrachte.
Sie bringt zwei Elfenbeinstatuetten aufgrund ihrer Darstellungsweise und der Bekleidung mit einem orienta-
lischen Mantelgewand mit spätheth irischen Bildern der Kybele in Verbindung und erkennt darin einen
möglichen Hinweis auf eine Verehrung dieser Göttin im frühen Artemision50.
Ein Kult der Göttin Demeter ist für Ephesos literarisch bezeugt. Strabon51 berichtet, dass noch zu seinen
Zeiten in Ephesos die Nachfahren des aus Attika stammenden Androklos die Verwaltung der Opfer und
Feste für den Kult der eleusinischen Demeter innehatten. Bei Herodot52 wird ein in Ephesos gefeiertes Fest
411 Bammer 1973/74, 57; zuletzt Bammer 2001b. 18; Muss 1994, 24; Bammer - Muss 1996, 67 f.; U. Muss in: Muss - Bammer - Bü-
yükkolanci (Anm. 14) 37 ff. Kritisch dazu G. Kuhn, AM 99, 1984, 199 ff.
41 Zum Elekatompedos: D. G. Hogarth - A. E. Henderson, The primitive Structures, in: Hogarth 1908, 71 f.; Bammer 1982, 62. 72;
A. Bammer, Chronologische und stratigraphische Probleme der archaischen Kultanlagen von Ephesos, Hephaistos 5/6, 1983/84,
95 ff.; Bammer 1984, 174 ff; Bammer 1993, 150 f. Abb. 19; Bammer 2001b, 15; Bammer - Muss 1996, 44; Bammer 2004, 75 ff.
42 Bammer 1986/87, 17 zu den in den Fundamenten des Kroisostempels verbauten Spolien des Hekatompedos.
43 Weißl 2002, 333 ff.
44 Bammer 1982, 81 ff; Muss 1994, 48; Muss 1999, 600. Nach antiken Quellen versprach Kroisos für den Fall, dass er König der
Lyder werde, der Artemis von Ephesos das Vermögen seines Feindes Sadyattes zu stiften: s. Muss 1994, 26 f. Dies zeigt zwar,
dass die Göttin Artemis schon vor dem Regierungsantritt des Kroisos von Bedeutung war, lässt jedoch nicht unbedingt Rück-
schlüsse auf die Zeit vor der Errichtung des Marmordipteros zu, wenn man U. Muss in der Annahme folgt, dass der Bau bereits
von Kroisos’ Vater Alyattes begonnen worden war.
45 Muss 1994, 48.
46 So u. a. Bammer - Muss 1996, 30 f. 41. 76 f; vgL hier unter XIII. 1 zur Interpretation der Bronzevotive aus dem Artemision.
47 Bammer - Muss 1996, 41.
48 Hogarth 1908, 145 f. Taf. 14 zu einer Bronzestatuette; Bammer 1982, 81 f.; Bammer 1988a, 5; Bammer - Muss 1996, 41. 76 f.
49 C. Smith in: Hogarth 1908, 155 ff. 172 ff. interpretiert die meisten weiblichen Statuetten als Priesterinnen; Jacobsthal 1951, 92.
Muss 1994, 54 ff; Muss 1999, 599 ff. Eine der beiden Figuren, der sog. Megabyzos, steht einer Statue aus Carchemish sehr nahe,
welche durch eine Inschrift an ihrer Rückseite als Kubaba (Kybele) ausgewiesen wird. Die Statuette aus dem Artemision wird
gewöhnlich an den Beginn des 6. Jhs. gestellt.
51 Strab. 14, 1, 3.
52 Hdt. 6, 16.
17
Im Areal des späteren Hofaltars wurde eine Nord-Süd orientierte Anlage entdeckt40. Diese besteht aus
einem quadratische Baukörper, der als Kultstatuenbasis interpretiert wird, einer nach Norden ansteigenden
Treppenrampe und einem quadratischen Brandopferherd, der sog. Eschara. Die Strukturen werden von
A. Bammer und U. Muss in das 6. Jahrhundert, somit noch in die Zeit vor der Errichtung des archaischen
Marmordipteros, datiert.
Ein westlich des älteren Dipteros gelegenes, Nord-Süd orientiertes Fundament aus gelbem Kalkmergel
wurde wegen seiner Länge von etwa 100 ionischen Fuß ‘Hekatompedos’41 genannt. Nach A. Bammer wurde
der Bau im späten 7. oder frühen 6. Jahrhundert begonnen und könnte der Altar des Tempels C gewesen sein42.
M. Weißl sprach sich hingegen zuletzt für eine gleichzeitige Nutzung des Hekatompedos und des archaischen
Dipteros aus43.
1.3 Die Göttenvelt des Artemisions
Über den oder die Kultinhaber im Artemision der spätgeometrischen und früharchaischen Zeit ist sehr wenig
bekannt. Die bislang frühesten Quellen, die den Namen Artemis für die Gottheit des Heiligtums belegen,
stammen aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. Ihnen folgend, kann die Göttin Artemis in Ephesos erst mit der Zeit
des Kroisos verbunden werden44; unklar ist, ob sie bereits vor diesem Zeitpunkt im Kultgeschehen eine Rol-
le spielte. U. Muss interpretiert die Quellenlage so, »daß Artemis nicht der Name der Göttin war, die ursprüng-
lich in Ephesos verehrt wurde, sondern diese eine oder mehrere ältere Gottheiten ersetzt hat«45. Sichere Hin-
weise auf den oder die Kultträger im Heiligtum der spätgeometrischen und früharchaischen Zeit fehlen. Im
Fundmaterial dieser Periode ist jedoch eine starke weibliche Komponente festzustellen, die nach der Inter-
pretation von A. Bammer und U. Muss auf die Verehrung einer weiblichen Gottheit hinweist46. So stellen die
im Heiligtum gefundenen Statuetten vornehmlich weibliche Figuren dar, wohingegen bislang nur einige
wenige männliche Terrakottastatuetten zutage kamen47. Die aus Gold, Silber, Bronze und Elfenbein gefer-
tigten weiblichen Bildnisse werden unterschiedlich als Göttinnen48 oder Priesterinnen49 gedeutet. U. Muss
sieht in den Darstellungen Göttinnen, und zwar jene Kultträgerinnen, denen man die Votivgaben darbrachte.
Sie bringt zwei Elfenbeinstatuetten aufgrund ihrer Darstellungsweise und der Bekleidung mit einem orienta-
lischen Mantelgewand mit spätheth irischen Bildern der Kybele in Verbindung und erkennt darin einen
möglichen Hinweis auf eine Verehrung dieser Göttin im frühen Artemision50.
Ein Kult der Göttin Demeter ist für Ephesos literarisch bezeugt. Strabon51 berichtet, dass noch zu seinen
Zeiten in Ephesos die Nachfahren des aus Attika stammenden Androklos die Verwaltung der Opfer und
Feste für den Kult der eleusinischen Demeter innehatten. Bei Herodot52 wird ein in Ephesos gefeiertes Fest
411 Bammer 1973/74, 57; zuletzt Bammer 2001b. 18; Muss 1994, 24; Bammer - Muss 1996, 67 f.; U. Muss in: Muss - Bammer - Bü-
yükkolanci (Anm. 14) 37 ff. Kritisch dazu G. Kuhn, AM 99, 1984, 199 ff.
41 Zum Elekatompedos: D. G. Hogarth - A. E. Henderson, The primitive Structures, in: Hogarth 1908, 71 f.; Bammer 1982, 62. 72;
A. Bammer, Chronologische und stratigraphische Probleme der archaischen Kultanlagen von Ephesos, Hephaistos 5/6, 1983/84,
95 ff.; Bammer 1984, 174 ff; Bammer 1993, 150 f. Abb. 19; Bammer 2001b, 15; Bammer - Muss 1996, 44; Bammer 2004, 75 ff.
42 Bammer 1986/87, 17 zu den in den Fundamenten des Kroisostempels verbauten Spolien des Hekatompedos.
43 Weißl 2002, 333 ff.
44 Bammer 1982, 81 ff; Muss 1994, 48; Muss 1999, 600. Nach antiken Quellen versprach Kroisos für den Fall, dass er König der
Lyder werde, der Artemis von Ephesos das Vermögen seines Feindes Sadyattes zu stiften: s. Muss 1994, 26 f. Dies zeigt zwar,
dass die Göttin Artemis schon vor dem Regierungsantritt des Kroisos von Bedeutung war, lässt jedoch nicht unbedingt Rück-
schlüsse auf die Zeit vor der Errichtung des Marmordipteros zu, wenn man U. Muss in der Annahme folgt, dass der Bau bereits
von Kroisos’ Vater Alyattes begonnen worden war.
45 Muss 1994, 48.
46 So u. a. Bammer - Muss 1996, 30 f. 41. 76 f; vgL hier unter XIII. 1 zur Interpretation der Bronzevotive aus dem Artemision.
47 Bammer - Muss 1996, 41.
48 Hogarth 1908, 145 f. Taf. 14 zu einer Bronzestatuette; Bammer 1982, 81 f.; Bammer 1988a, 5; Bammer - Muss 1996, 41. 76 f.
49 C. Smith in: Hogarth 1908, 155 ff. 172 ff. interpretiert die meisten weiblichen Statuetten als Priesterinnen; Jacobsthal 1951, 92.
Muss 1994, 54 ff; Muss 1999, 599 ff. Eine der beiden Figuren, der sog. Megabyzos, steht einer Statue aus Carchemish sehr nahe,
welche durch eine Inschrift an ihrer Rückseite als Kubaba (Kybele) ausgewiesen wird. Die Statuette aus dem Artemision wird
gewöhnlich an den Beginn des 6. Jhs. gestellt.
51 Strab. 14, 1, 3.
52 Hdt. 6, 16.