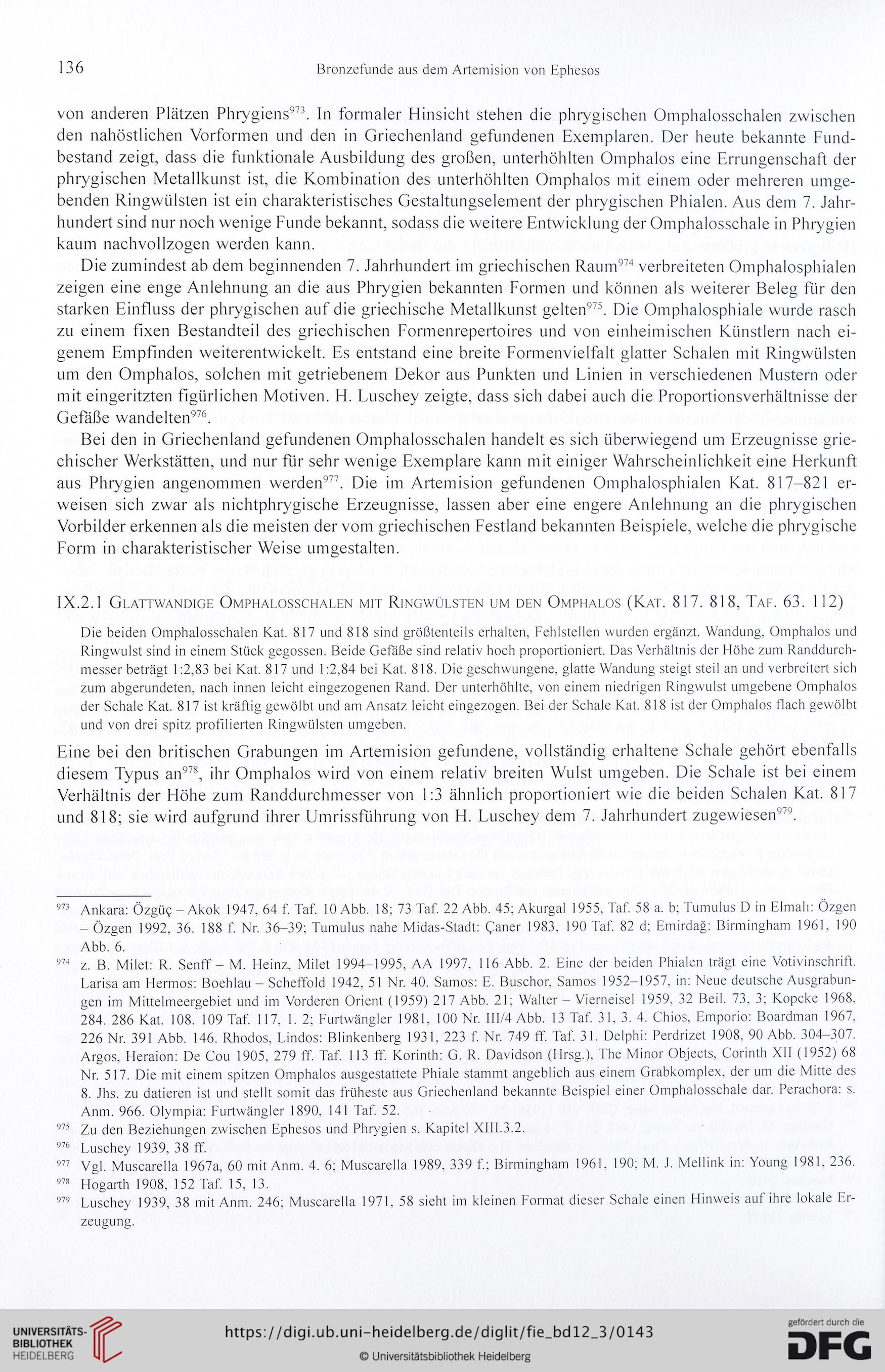136
Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos
von anderen Plätzen Phrygiens973. In formaler Hinsicht stehen die phrygischen Omphalosschalen zwischen
den nahöstlichen Vorformen und den in Griechenland gefundenen Exemplaren. Der heute bekannte Fund-
bestand zeigt, dass die funktionale Ausbildung des großen, unterhöhlten Omphalos eine Errungenschaft der
phrygischen Metallkunst ist, die Kombination des unterhöhlten Omphalos mit einem oder mehreren umge-
benden Ringwülsten ist ein charakteristisches Gestaltungselement der phrygischen Phialen. Aus dem 7. Jahr-
hundert sind nur noch wenige Funde bekannt, sodass die weitere Entwicklung der Omphalosschale in Phrygien
kaum nachvollzogen werden kann.
Die zumindest ab dem beginnenden 7. Jahrhundert im griechischen Raum974 verbreiteten Omphalosphialen
zeigen eine enge Anlehnung an die aus Phrygien bekannten Formen und können als weiterer Beleg für den
starken Einfluss der phrygischen auf die griechische Metallkunst gelten975. Die Omphalosphiale wurde rasch
zu einem fixen Bestandteil des griechischen Formenrepertoires und von einheimischen Künstlern nach ei-
genem Empfinden weiterentwickelt. Es entstand eine breite Formenvielfalt glatter Schalen mit Ringwülsten
um den Omphalos, solchen mit getriebenem Dekor aus Punkten und Linien in verschiedenen Mustern oder
mit eingeritzten figürlichen Motiven. H. Luschey zeigte, dass sich dabei auch die Proportionsverhältnisse der
Gefäße wandelten976.
Bei den in Griechenland gefundenen Omphalosschalen handelt es sich überwiegend um Erzeugnisse grie-
chischer Werkstätten, und nur für sehr wenige Exemplare kann mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Herkunft
aus Phrygien angenommen werden977. Die im Artemision gefundenen Omphalosphialen Kat. 817-821 er-
weisen sich zwar als nichtphrygische Erzeugnisse, lassen aber eine engere Anlehnung an die phrygischen
Vorbilder erkennen als die meisten der vom griechischen Festland bekannten Beispiele, welche die phrygische
Form in charakteristischer Weise umgestalten.
IX.2.1 Glattwandige Omphalosschalen mit Ringwülsten um den Omphalos (Kat. 817. 818, Taf. 63. 112)
Die beiden Omphalosschalen Kat. 817 und 818 sind größtenteils erhalten. Fehlstellen wurden ergänzt. Wandung, Omphalos und
Ringwulst sind in einem Stück gegossen. Beide Gefäße sind relativ hoch proportioniert. Das Verhältnis der Höhe zum Randdurch-
messer beträgt 1:2,83 bei Kat. 817 und 1:2,84 bei Kat. 818. Die geschwungene, glatte Wandung steigt steil an und verbreitert sich
zum abgerundeten, nach innen leicht eingezogenen Rand. Der unterhöhlte, von einem niedrigen Ringwulst umgebene Omphalos
der Schale Kat. 817 ist kräftig gewölbt und am Ansatz leicht eingezogen. Bei der Schale Kat. 818 ist der Omphalos flach gewölbt
und von drei spitz profilierten Ringwülsten umgeben.
Eine bei den britischen Grabungen im Artemision gefundene, vollständig erhaltene Schale gehört ebenfalls
diesem Typus an978, ihr Omphalos wird von einem relativ breiten Wulst umgeben. Die Schale ist bei einem
Verhältnis der Höhe zum Randdurchmesser von 1:3 ähnlich proportioniert wie die beiden Schalen Kat. 817
und 818; sie wird aufgrund ihrer Umrissführung von H. Luschey dem 7. Jahrhundert zugewiesen979.
973 Ankara: Özgü? - Akok 1947, 64 f. Taf. 10 Abb. 18: 73 Taf. 22 Abb. 45; Akurgal 1955. Taf. 58 a. b: Tumulus D in Elmah: Özgen
- Özgen 1992, 36. 188 f. Nr. 36-39: Tumulus nahe Midas-Stadt: faner 1983, 190 Taf. 82 d; Emirdag: Birmingham 1961, 190
Abb. 6.
974 z. B. Milet: R. Senff - M. Heinz, Milet 1994-1995, AA 1997, 116 Abb. 2. Eine der beiden Phialen trägt eine Votivinschrift.
Larisa am Hermos: Boehlau - Scheffold 1942, 51 Nr. 40. Samos: E. Buschor. Samos 1952-1957, in: Neue deutsche Ausgrabun-
gen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient (1959) 217 Abb. 21; Walter - Vierneisel 1959, 32 Beil. 73, 3; Kopeke 1968,
284. 286 Kat. 108. 109 Taf. 117, 1. 2; Furtwängler 1981. 100 Nr. 111/4 Abb. 13 Taf. 31. 3. 4. Chios, Emporio: Boardman 1967,
226 Nr. 391 Abb. 146. Rhodos, Lindos: Blinkenberg 1931. 223 f. Nr. 749 ff. Taf. 31. Delphi: Perdrizet 1908, 90 Abb. 304-307.
Argos, Heraion: De Cou 1905, 279 ff. Taf. 113 ff. Korinth: G. R. Davidson (Hrsg.), The Minor Objects, Corinth XII (1952) 68
Nr. 517. Die mit einem spitzen Omphalos ausgestattete Phiale stammt angeblich aus einem Grabkomplex, der um die Mitte des
8. Jhs. zu datieren ist und stellt somit das früheste aus Griechenland bekannte Beispiel einer Omphalosschale dar. Perachora: s.
Anm. 966. Olympia: Furtwängler 1890, 141 Taf. 52.
975 Zu den Beziehungen zwischen Ephesos und Phrygien s. Kapitel XIII.3.2.
976 Luschey 1939, 38 ff.
977 Vgl. Muscarella 1967a, 60 mit Anm. 4. 6; Muscarella 1989. 339 f.; Birmingham 1961. 190: M. .1. Mellink in: Young 1981. 236.
978 Hogarth 1908. 152 Taf. 15, 13.
979 Luschey 1939, 38 mit Anm. 246; Muscarella 1971. 58 sieht im kleinen Format dieser Schale einen Hinweis auf ihre lokale Er-
zeugung.
Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos
von anderen Plätzen Phrygiens973. In formaler Hinsicht stehen die phrygischen Omphalosschalen zwischen
den nahöstlichen Vorformen und den in Griechenland gefundenen Exemplaren. Der heute bekannte Fund-
bestand zeigt, dass die funktionale Ausbildung des großen, unterhöhlten Omphalos eine Errungenschaft der
phrygischen Metallkunst ist, die Kombination des unterhöhlten Omphalos mit einem oder mehreren umge-
benden Ringwülsten ist ein charakteristisches Gestaltungselement der phrygischen Phialen. Aus dem 7. Jahr-
hundert sind nur noch wenige Funde bekannt, sodass die weitere Entwicklung der Omphalosschale in Phrygien
kaum nachvollzogen werden kann.
Die zumindest ab dem beginnenden 7. Jahrhundert im griechischen Raum974 verbreiteten Omphalosphialen
zeigen eine enge Anlehnung an die aus Phrygien bekannten Formen und können als weiterer Beleg für den
starken Einfluss der phrygischen auf die griechische Metallkunst gelten975. Die Omphalosphiale wurde rasch
zu einem fixen Bestandteil des griechischen Formenrepertoires und von einheimischen Künstlern nach ei-
genem Empfinden weiterentwickelt. Es entstand eine breite Formenvielfalt glatter Schalen mit Ringwülsten
um den Omphalos, solchen mit getriebenem Dekor aus Punkten und Linien in verschiedenen Mustern oder
mit eingeritzten figürlichen Motiven. H. Luschey zeigte, dass sich dabei auch die Proportionsverhältnisse der
Gefäße wandelten976.
Bei den in Griechenland gefundenen Omphalosschalen handelt es sich überwiegend um Erzeugnisse grie-
chischer Werkstätten, und nur für sehr wenige Exemplare kann mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Herkunft
aus Phrygien angenommen werden977. Die im Artemision gefundenen Omphalosphialen Kat. 817-821 er-
weisen sich zwar als nichtphrygische Erzeugnisse, lassen aber eine engere Anlehnung an die phrygischen
Vorbilder erkennen als die meisten der vom griechischen Festland bekannten Beispiele, welche die phrygische
Form in charakteristischer Weise umgestalten.
IX.2.1 Glattwandige Omphalosschalen mit Ringwülsten um den Omphalos (Kat. 817. 818, Taf. 63. 112)
Die beiden Omphalosschalen Kat. 817 und 818 sind größtenteils erhalten. Fehlstellen wurden ergänzt. Wandung, Omphalos und
Ringwulst sind in einem Stück gegossen. Beide Gefäße sind relativ hoch proportioniert. Das Verhältnis der Höhe zum Randdurch-
messer beträgt 1:2,83 bei Kat. 817 und 1:2,84 bei Kat. 818. Die geschwungene, glatte Wandung steigt steil an und verbreitert sich
zum abgerundeten, nach innen leicht eingezogenen Rand. Der unterhöhlte, von einem niedrigen Ringwulst umgebene Omphalos
der Schale Kat. 817 ist kräftig gewölbt und am Ansatz leicht eingezogen. Bei der Schale Kat. 818 ist der Omphalos flach gewölbt
und von drei spitz profilierten Ringwülsten umgeben.
Eine bei den britischen Grabungen im Artemision gefundene, vollständig erhaltene Schale gehört ebenfalls
diesem Typus an978, ihr Omphalos wird von einem relativ breiten Wulst umgeben. Die Schale ist bei einem
Verhältnis der Höhe zum Randdurchmesser von 1:3 ähnlich proportioniert wie die beiden Schalen Kat. 817
und 818; sie wird aufgrund ihrer Umrissführung von H. Luschey dem 7. Jahrhundert zugewiesen979.
973 Ankara: Özgü? - Akok 1947, 64 f. Taf. 10 Abb. 18: 73 Taf. 22 Abb. 45; Akurgal 1955. Taf. 58 a. b: Tumulus D in Elmah: Özgen
- Özgen 1992, 36. 188 f. Nr. 36-39: Tumulus nahe Midas-Stadt: faner 1983, 190 Taf. 82 d; Emirdag: Birmingham 1961, 190
Abb. 6.
974 z. B. Milet: R. Senff - M. Heinz, Milet 1994-1995, AA 1997, 116 Abb. 2. Eine der beiden Phialen trägt eine Votivinschrift.
Larisa am Hermos: Boehlau - Scheffold 1942, 51 Nr. 40. Samos: E. Buschor. Samos 1952-1957, in: Neue deutsche Ausgrabun-
gen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient (1959) 217 Abb. 21; Walter - Vierneisel 1959, 32 Beil. 73, 3; Kopeke 1968,
284. 286 Kat. 108. 109 Taf. 117, 1. 2; Furtwängler 1981. 100 Nr. 111/4 Abb. 13 Taf. 31. 3. 4. Chios, Emporio: Boardman 1967,
226 Nr. 391 Abb. 146. Rhodos, Lindos: Blinkenberg 1931. 223 f. Nr. 749 ff. Taf. 31. Delphi: Perdrizet 1908, 90 Abb. 304-307.
Argos, Heraion: De Cou 1905, 279 ff. Taf. 113 ff. Korinth: G. R. Davidson (Hrsg.), The Minor Objects, Corinth XII (1952) 68
Nr. 517. Die mit einem spitzen Omphalos ausgestattete Phiale stammt angeblich aus einem Grabkomplex, der um die Mitte des
8. Jhs. zu datieren ist und stellt somit das früheste aus Griechenland bekannte Beispiel einer Omphalosschale dar. Perachora: s.
Anm. 966. Olympia: Furtwängler 1890, 141 Taf. 52.
975 Zu den Beziehungen zwischen Ephesos und Phrygien s. Kapitel XIII.3.2.
976 Luschey 1939, 38 ff.
977 Vgl. Muscarella 1967a, 60 mit Anm. 4. 6; Muscarella 1989. 339 f.; Birmingham 1961. 190: M. .1. Mellink in: Young 1981. 236.
978 Hogarth 1908. 152 Taf. 15, 13.
979 Luschey 1939, 38 mit Anm. 246; Muscarella 1971. 58 sieht im kleinen Format dieser Schale einen Hinweis auf ihre lokale Er-
zeugung.