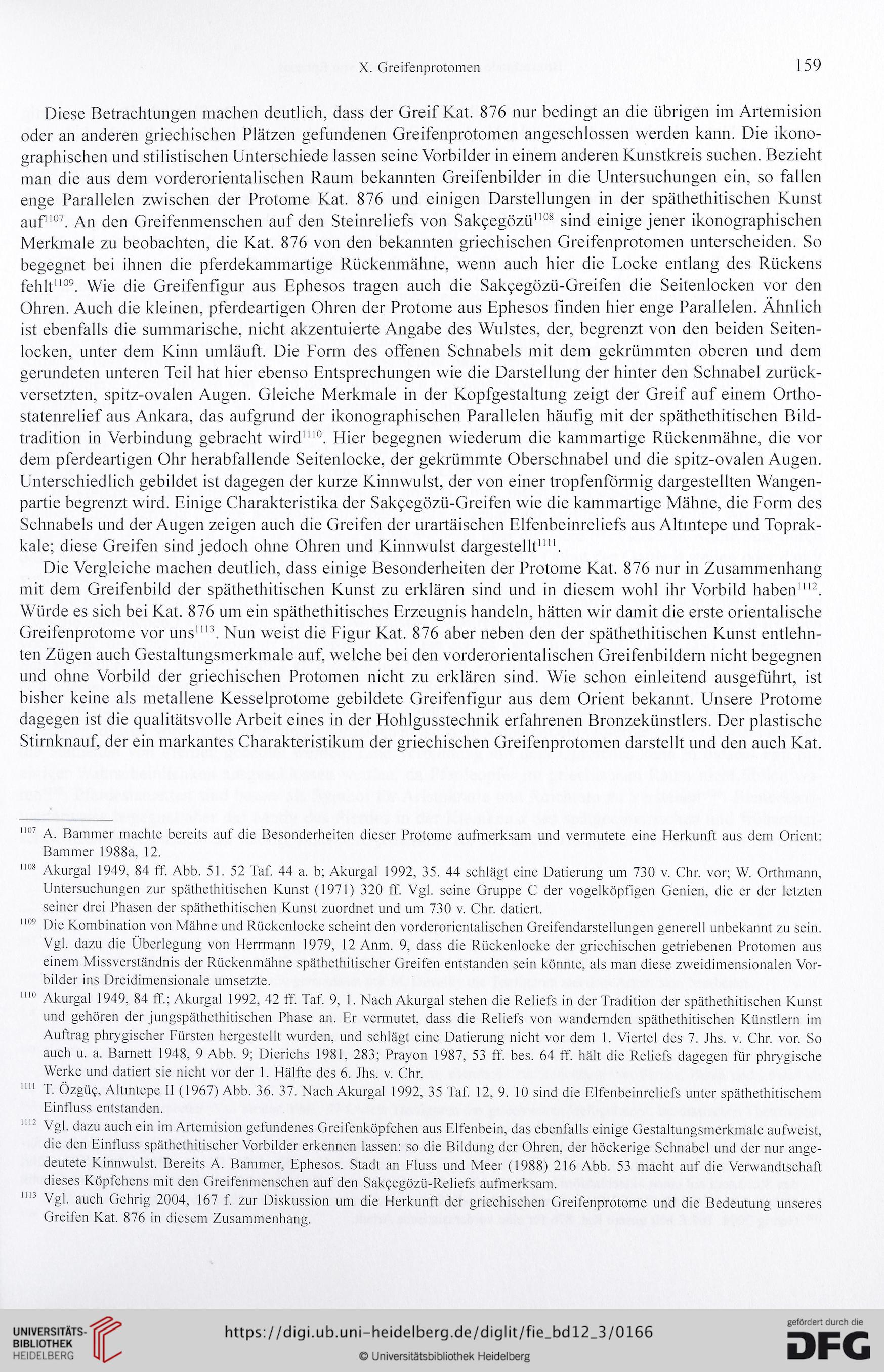X. Greifenprotomen
159
Diese Betrachtungen machen deutlich, dass der Greif Kat. 876 nur bedingt an die übrigen im Artemision
oder an anderen griechischen Plätzen gefundenen Greifenprotomen angeschlossen werden kann. Die ikono-
graphischen und stilistischen Unterschiede lassen seine Vorbilder in einem anderen Kunstkreis suchen. Bezieht
man die aus dem vorderorientalischen Raum bekannten Greifenbilder in die Untersuchungen ein, so fallen
enge Parallelen zwischen der Protome Kat. 876 und einigen Darstellungen in der späthethitischen Kunst
auf107. An den Greifenmenschen auf den Steinreliefs von Sakqegözü1107 1108 sind einige jener ikonographischen
Merkmale zu beobachten, die Kat. 876 von den bekannten griechischen Greifenprotomen unterscheiden. So
begegnet bei ihnen die pferdekammartige Rückenmähne, wenn auch hier die Locke entlang des Rückens
fehlt1109. Wie die Greifenfigur aus Ephesos tragen auch die Sakqegözü-Greifen die Seitenlocken vor den
Ohren. Auch die kleinen, pferdeartigen Ohren der Protome aus Ephesos finden hier enge Parallelen. Ähnlich
ist ebenfalls die summarische, nicht akzentuierte Angabe des Wulstes, der, begrenzt von den beiden Seiten-
locken, unter dem Kinn umläuft. Die Form des offenen Schnabels mit dem gekrümmten oberen und dem
gerundeten unteren Teil hat hier ebenso Entsprechungen wie die Darstellung der hinter den Schnabel zurück-
versetzten, spitz-ovalen Augen. Gleiche Merkmale in der Kopfgestaltung zeigt der Greif auf einem Ortho-
statenrelief aus Ankara, das aufgrund der ikonographischen Parallelen häufig mit der späthethitischen Bild-
tradition in Verbindung gebracht wird1110. Hier begegnen wiederum die kammartige Rückenmähne, die vor
dem pferdeartigen Ohr herabfallende Seitenlocke, der gekrümmte Oberschnabel und die spitz-ovalen Augen.
Unterschiedlich gebildet ist dagegen der kurze Kinnwulst, der von einer tropfenförmig dargestellten Wangen-
partie begrenzt wird. Einige Charakteristika der Sakqegözü-Greifen wie die kammartige Mähne, die Form des
Schnabels und der Augen zeigen auch die Greifen der urartäischen Elfenbeinreliefs aus Altintepe und Toprak-
kale; diese Greifen sind jedoch ohne Ohren und Kinnwulst dargestellt1111.
Die Vergleiche machen deutlich, dass einige Besonderheiten der Protome Kat. 876 nur in Zusammenhang
mit dem Greifenbild der späthethitischen Kunst zu erklären sind und in diesem wohl ihr Vorbild haben1112.
Würde es sich bei Kat. 876 um ein späthethitisches Erzeugnis handeln, hätten wir damit die erste orientalische
Greifenprotome vor uns1113. Nun weist die Figur Kat. 876 aber neben den der späthethitischen Kunst entlehn-
ten Zügen auch Gestaltungsmerkmale auf, welche bei den vorderorientalischen Greifenbildern nicht begegnen
und ohne Vorbild der griechischen Protomen nicht zu erklären sind. Wie schon einleitend ausgeführt, ist
bisher keine als metallene Kesselprotome gebildete Greifenfigur aus dem Orient bekannt. Unsere Protome
dagegen ist die qualitätsvolle Arbeit eines in der Hohlgusstechnik erfahrenen Bronzekünstlers. Der plastische
Stirnknauf, der ein markantes Charakteristikum der griechischen Greifenprotomen darstellt und den auch Kat.
1107 A. Bammer machte bereits auf die Besonderheiten dieser Protome aufmerksam und vermutete eine Herkunft aus dem Orient:
Bammer 1988a, 12.
1108 Akurgal 1949, 84 ff. Abb. 51. 52 Taf. 44 a. b; Akurgal 1992, 35. 44 schlägt eine Datierung um 730 v. Chr. vor; W. Orthmann,
Untersuchungen zur späthethitischen Kunst (1971) 320 ff. Vgl. seine Gruppe C der vogelköpfigen Genien, die er der letzten
seiner drei Phasen der späthethitischen Kunst zuordnet und um 730 v. Chr. datiert.
11119 Die Kombination von Mähne und Rückenlocke scheint den vorderorientalischen Greifendarstellungen generell unbekannt zu sein.
Vgl. dazu die Überlegung von Herrmann 1979, 12 Anm. 9, dass die Rückenlocke der griechischen getriebenen Protomen aus
einem Missverständnis der Rückenmähne späthethitischer Greifen entstanden sein könnte, als man diese zweidimensionalen Vor-
bilder ins Dreidimensionale umsetzte.
1110 Akurgal 1949, 84 ff.; Akurgal 1992, 42 ff. Taf. 9, 1. Nach Akurgal stehen die Reliefs in der Tradition der späthethitischen Kunst
und gehören der jungspäthethitischen Phase an. Er vermutet, dass die Reliefs von wandernden späthethitischen Künstlern im
Auftrag phrygischer Fürsten hergestellt wurden, und schlägt eine Datierung nicht vor dem 1. Viertel des 7. Jhs. v. Chr. vor. So
auch u. a. Barnett 1948, 9 Abb. 9; Dierichs 1981, 283; Prayon 1987, 53 ff. bes. 64 ff. hält die Reliefs dagegen für phrygische
Werke und datiert sie nicht vor der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.
1111 T. Özgüp, Altintepe II (1967) Abb. 36. 37. Nach Akurgal 1992, 35 Taf. 12,9. 10 sind die Elfenbeinreliefs unter späthethitischem
Einfluss entstanden.
1112 Vgl. dazu auch ein im Artemision gefundenes Greifenköpfchen aus Elfenbein, das ebenfalls einige Gestaltungsmerkmale aufweist,
die den Einfluss späthethitischer Vorbilder erkennen lassen: so die Bildung der Ohren, der höckerige Schnabel und der nur ange-
deutete Kinnwulst. Bereits A. Bammer, Ephesos. Stadt an Fluss und Meer (1988) 216 Abb. 53 macht auf die Verwandtschaft
dieses Köpfchens mit den Greifenmenschen auf den Sakpegözü-Reliefs aufmerksam.
Vgl. auch Gehrig 2004, 167 f. zur Diskussion um die Herkunft der griechischen Greifenprotome und die Bedeutung unseres
Greifen Kat. 876 in diesem Zusammenhang.
159
Diese Betrachtungen machen deutlich, dass der Greif Kat. 876 nur bedingt an die übrigen im Artemision
oder an anderen griechischen Plätzen gefundenen Greifenprotomen angeschlossen werden kann. Die ikono-
graphischen und stilistischen Unterschiede lassen seine Vorbilder in einem anderen Kunstkreis suchen. Bezieht
man die aus dem vorderorientalischen Raum bekannten Greifenbilder in die Untersuchungen ein, so fallen
enge Parallelen zwischen der Protome Kat. 876 und einigen Darstellungen in der späthethitischen Kunst
auf107. An den Greifenmenschen auf den Steinreliefs von Sakqegözü1107 1108 sind einige jener ikonographischen
Merkmale zu beobachten, die Kat. 876 von den bekannten griechischen Greifenprotomen unterscheiden. So
begegnet bei ihnen die pferdekammartige Rückenmähne, wenn auch hier die Locke entlang des Rückens
fehlt1109. Wie die Greifenfigur aus Ephesos tragen auch die Sakqegözü-Greifen die Seitenlocken vor den
Ohren. Auch die kleinen, pferdeartigen Ohren der Protome aus Ephesos finden hier enge Parallelen. Ähnlich
ist ebenfalls die summarische, nicht akzentuierte Angabe des Wulstes, der, begrenzt von den beiden Seiten-
locken, unter dem Kinn umläuft. Die Form des offenen Schnabels mit dem gekrümmten oberen und dem
gerundeten unteren Teil hat hier ebenso Entsprechungen wie die Darstellung der hinter den Schnabel zurück-
versetzten, spitz-ovalen Augen. Gleiche Merkmale in der Kopfgestaltung zeigt der Greif auf einem Ortho-
statenrelief aus Ankara, das aufgrund der ikonographischen Parallelen häufig mit der späthethitischen Bild-
tradition in Verbindung gebracht wird1110. Hier begegnen wiederum die kammartige Rückenmähne, die vor
dem pferdeartigen Ohr herabfallende Seitenlocke, der gekrümmte Oberschnabel und die spitz-ovalen Augen.
Unterschiedlich gebildet ist dagegen der kurze Kinnwulst, der von einer tropfenförmig dargestellten Wangen-
partie begrenzt wird. Einige Charakteristika der Sakqegözü-Greifen wie die kammartige Mähne, die Form des
Schnabels und der Augen zeigen auch die Greifen der urartäischen Elfenbeinreliefs aus Altintepe und Toprak-
kale; diese Greifen sind jedoch ohne Ohren und Kinnwulst dargestellt1111.
Die Vergleiche machen deutlich, dass einige Besonderheiten der Protome Kat. 876 nur in Zusammenhang
mit dem Greifenbild der späthethitischen Kunst zu erklären sind und in diesem wohl ihr Vorbild haben1112.
Würde es sich bei Kat. 876 um ein späthethitisches Erzeugnis handeln, hätten wir damit die erste orientalische
Greifenprotome vor uns1113. Nun weist die Figur Kat. 876 aber neben den der späthethitischen Kunst entlehn-
ten Zügen auch Gestaltungsmerkmale auf, welche bei den vorderorientalischen Greifenbildern nicht begegnen
und ohne Vorbild der griechischen Protomen nicht zu erklären sind. Wie schon einleitend ausgeführt, ist
bisher keine als metallene Kesselprotome gebildete Greifenfigur aus dem Orient bekannt. Unsere Protome
dagegen ist die qualitätsvolle Arbeit eines in der Hohlgusstechnik erfahrenen Bronzekünstlers. Der plastische
Stirnknauf, der ein markantes Charakteristikum der griechischen Greifenprotomen darstellt und den auch Kat.
1107 A. Bammer machte bereits auf die Besonderheiten dieser Protome aufmerksam und vermutete eine Herkunft aus dem Orient:
Bammer 1988a, 12.
1108 Akurgal 1949, 84 ff. Abb. 51. 52 Taf. 44 a. b; Akurgal 1992, 35. 44 schlägt eine Datierung um 730 v. Chr. vor; W. Orthmann,
Untersuchungen zur späthethitischen Kunst (1971) 320 ff. Vgl. seine Gruppe C der vogelköpfigen Genien, die er der letzten
seiner drei Phasen der späthethitischen Kunst zuordnet und um 730 v. Chr. datiert.
11119 Die Kombination von Mähne und Rückenlocke scheint den vorderorientalischen Greifendarstellungen generell unbekannt zu sein.
Vgl. dazu die Überlegung von Herrmann 1979, 12 Anm. 9, dass die Rückenlocke der griechischen getriebenen Protomen aus
einem Missverständnis der Rückenmähne späthethitischer Greifen entstanden sein könnte, als man diese zweidimensionalen Vor-
bilder ins Dreidimensionale umsetzte.
1110 Akurgal 1949, 84 ff.; Akurgal 1992, 42 ff. Taf. 9, 1. Nach Akurgal stehen die Reliefs in der Tradition der späthethitischen Kunst
und gehören der jungspäthethitischen Phase an. Er vermutet, dass die Reliefs von wandernden späthethitischen Künstlern im
Auftrag phrygischer Fürsten hergestellt wurden, und schlägt eine Datierung nicht vor dem 1. Viertel des 7. Jhs. v. Chr. vor. So
auch u. a. Barnett 1948, 9 Abb. 9; Dierichs 1981, 283; Prayon 1987, 53 ff. bes. 64 ff. hält die Reliefs dagegen für phrygische
Werke und datiert sie nicht vor der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.
1111 T. Özgüp, Altintepe II (1967) Abb. 36. 37. Nach Akurgal 1992, 35 Taf. 12,9. 10 sind die Elfenbeinreliefs unter späthethitischem
Einfluss entstanden.
1112 Vgl. dazu auch ein im Artemision gefundenes Greifenköpfchen aus Elfenbein, das ebenfalls einige Gestaltungsmerkmale aufweist,
die den Einfluss späthethitischer Vorbilder erkennen lassen: so die Bildung der Ohren, der höckerige Schnabel und der nur ange-
deutete Kinnwulst. Bereits A. Bammer, Ephesos. Stadt an Fluss und Meer (1988) 216 Abb. 53 macht auf die Verwandtschaft
dieses Köpfchens mit den Greifenmenschen auf den Sakpegözü-Reliefs aufmerksam.
Vgl. auch Gehrig 2004, 167 f. zur Diskussion um die Herkunft der griechischen Greifenprotome und die Bedeutung unseres
Greifen Kat. 876 in diesem Zusammenhang.