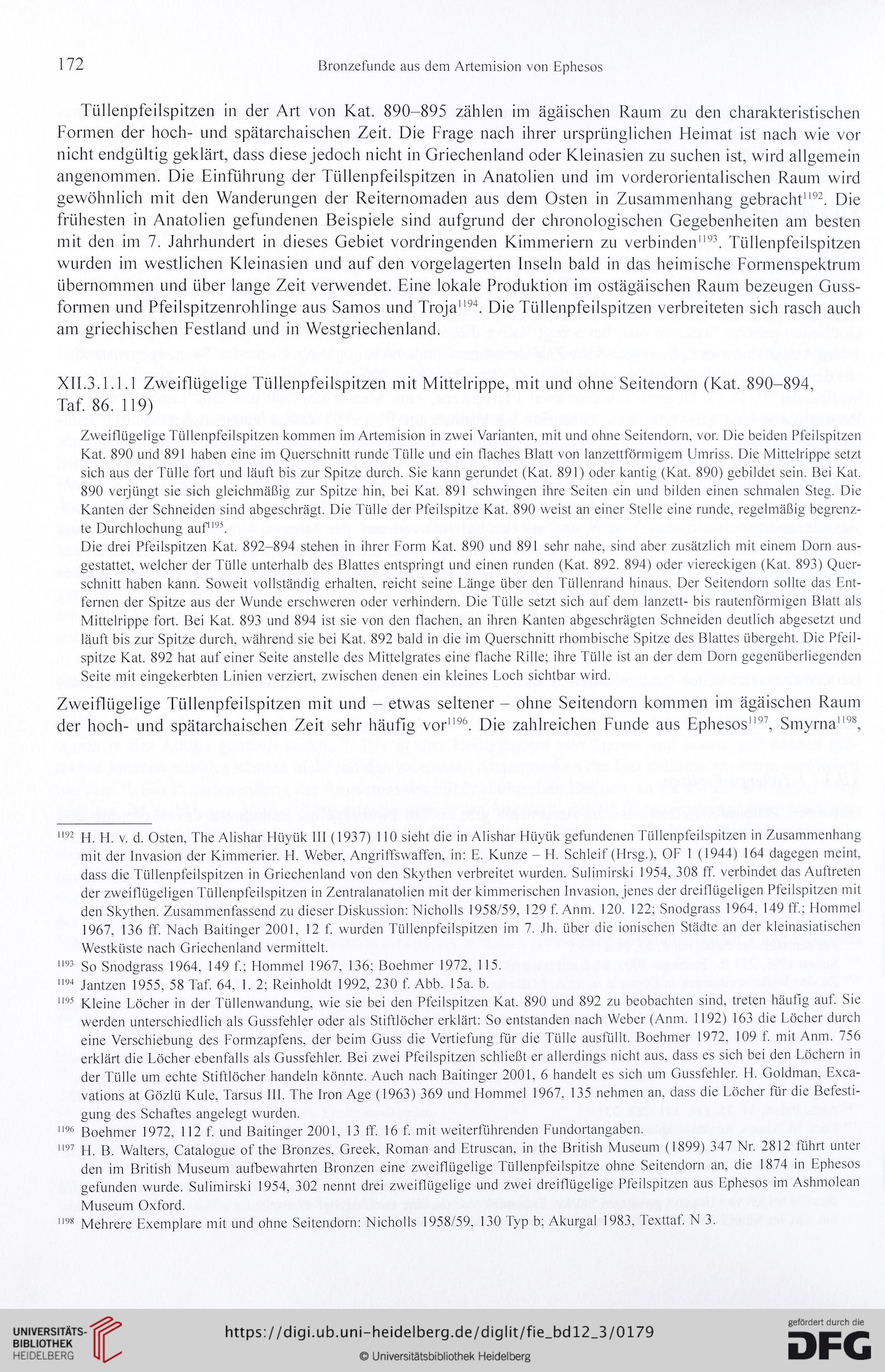172
Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos
Tüllenpfeilspitzen in der Art von Kat. 890-895 zählen im ägäischen Raum zu den charakteristischen
Formen der hoch- und spätarchaischen Zeit. Die Frage nach ihrer ursprünglichen Heimat ist nach wie vor
nicht endgültig geklärt, dass diese jedoch nicht in Griechenland oder Kleinasien zu suchen ist, wird allgemein
angenommen. Die Einführung der Tüllenpfeilspitzen in Anatolien und im vorderorientalischen Raum wird
gewöhnlich mit den Wanderungen der Reiternomaden aus dem Osten in Zusammenhang gebracht1192. Die
frühesten in Anatolien gefundenen Beispiele sind aufgrund der chronologischen Gegebenheiten am besten
mit den im 7. Jahrhundert in dieses Gebiet vordringenden Kimmeriern zu verbinden"93. Tüllenpfeilspitzen
wurden im westlichen Kleinasien und auf den vorgelagerten Inseln bald in das heimische Formenspektrum
übernommen und über lange Zeit verwendet. Eine lokale Produktion im ostägäischen Raum bezeugen Guss-
formen und Pfeilspitzenrohlinge aus Samos und Troja1194. Die Tüllenpfeilspitzen verbreiteten sich rasch auch
am griechischen Festland und in Westgriechenland.
XII.3.1.1.1 Zweiflügelige Tüllenpfeilspitzen mit Mittelrippe, mit und ohne Seitendorn (Kat. 890-894,
Taf. 86. 119)
Zweiflügelige Tüllenpfeilspitzen kommen im Artemision in zwei Varianten, mit und ohne Seitendorn, vor. Die beiden Pfeilspitzen
Kat. 890 und 891 haben eine im Querschnitt runde Tülle und ein flaches Blatt von lanzettförmigem Umriss. Die Mittelrippe setzt
sich aus der Tülle fort und läuft bis zur Spitze durch. Sie kann gerundet (Kat. 891) oder kantig (Kat. 890) gebildet sein. Bei Kat.
890 verjüngt sie sich gleichmäßig zur Spitze hin, bei Kat. 891 schwingen ihre Seiten ein und bilden einen schmalen Steg. Die
Kanten der Schneiden sind abgeschrägt. Die Tülle der Pfeilspitze Kat. 890 weist an einer Stelle eine runde, regelmäßig begrenz-
te Durchlochung auf195.
Die drei Pfeilspitzen Kat. 892-894 stehen in ihrer Form Kat. 890 und 891 sehr nahe, sind aber zusätzlich mit einem Dorn aus-
gestattet, welcher der Tülle unterhalb des Blattes entspringt und einen runden (Kat. 892. 894) oder viereckigen (Kat. 893) Quer-
schnitt haben kann. Soweit vollständig erhalten, reicht seine Länge über den Tüllenrand hinaus. Der Seitendorn sollte das Ent-
fernen der Spitze aus der Wunde erschweren oder verhindern. Die Tülle setzt sich auf dem lanzett- bis rautenförmigen Blatt als
Mittelrippe fort. Bei Kat. 893 und 894 ist sie von den flachen, an ihren Kanten abgeschrägten Schneiden deutlich abgesetzt und
läuft bis zur Spitze durch, während sie bei Kat. 892 bald in die im Querschnitt rhombische Spitze des Blattes übergeht. Die Pfeil-
spitze Kat. 892 hat auf einer Seite anstelle des Mittelgrates eine flache Rille; ihre Tülle ist an der dem Dorn gegenüberliegenden
Seite mit eingekerbten Linien verziert, zwischen denen ein kleines Loch sichtbar wird.
Zweiflügelige Tüllenpfeilspitzen mit und - etwas seltener - ohne Seitendorn kommen im ägäischen Raum
der hoch- und spätarchaischen Zeit sehr häufig vor1196 1197 1198. Die zahlreichen Funde aus Ephesos"97, Smyrna"98,
1192 I I. H. v. d. Osten, The Alishar Hüyük III (1937) 110 sieht die in Alishar Hüyük gefundenen Tüllenpfeilspitzen in Zusammenhang
mit der Invasion der Kimmerier. H. Weber, Angriffswaffen, in: E. Kunze - H. Schleif (Hrsg.), OF 1 (1944) 164 dagegen meint,
dass die Tüllenpfeilspitzen in Griechenland von den Skythen verbreitet wurden. Sulimirski 1954, 308 ff. verbindet das Auftreten
der zweiflügeligen Tüllenpfeilspitzen in Zentralanatolien mit der kimmerischen Invasion, jenes der dreiflügeligen Pfeilspitzen mit
den Skythen. Zusammenfassend zu dieser Diskussion: Nicholls 1958/59. 129 f. Anm. 120. 122; Snodgrass 1964. 149 ff; Hommel
1967, 136 ff. Nach Baitinger 2001. 12 f. wurden Tüllenpfeilspitzen im 7. Jh. über die ionischen Städte an der kleinasiatischen
Westküste nach Griechenland vermittelt.
1193 So Snodgrass 1964, 149 f.; Hommel 1967, 136; Boehmer 1972, 115.
1194 Jantzen 1955, 58 Taf. 64. I. 2; Reinholdt 1992, 230 f. Abb. 15a. b.
1195 Kleine Löcher in der Tüllenwandung, wie sie bei den Pfeilspitzen Kat. 890 und 892 zu beobachten sind, treten häufig auf. Sie
werden unterschiedlich als Gussfehler oder als Stiftlöcher erklärt: So entstanden nach Weber (Anm. 1192) 163 die Löcher durch
eine Verschiebung des Formzapfens, der beim Guss die Vertiefung für die Tülle ausfüllt. Boehmer 1972, 109 f. mit Anm. 756
erklärt die Löcher ebenfalls als Gussfehler. Bei zwei Pfeilspitzen schließt er allerdings nicht aus, dass es sich bei den Löchern in
der Tülle um echte Stiftlöcher handeln könnte. Auch nach Baitinger 2001, 6 handelt es sich um Gussfehler. H. Goldman, Exca-
vations at Gözlü Kule, Tarsus III. The Iron Age (1963) 369 und Hommel 1967, 135 nehmen an. dass die Löcher für die Befesti-
gung des Schaftes angelegt wurden.
1196 Boehmer 1972, 112 f. und Baitinger 2001, 13 ff. 16 f. mit weiterführenden Fundortangaben.
1197 H. B. Walters, Catalogue of the Bronzes, Greek. Roman and Etruscan. in the British Museum (1899) 347 Nr. 2812 führt unter
den im British Museum aufbewahrten Bronzen eine zweiflügelige I üllenpfeilspitze ohne Seitendorn an, die 1874 in Ephesos
gefunden wurde. Sulimirski 1954. 302 nennt drei zweiflügelige und zwei dreiflügelige Pfeilspitzen aus Ephesos im Ashmolean
Museum Oxford.
1198 Mehrere Exemplare mit und ohne Seitendorn: Nicholls 1958/59, 130 Typ b; Akurgal 1983, lexttaf. N 3.
Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos
Tüllenpfeilspitzen in der Art von Kat. 890-895 zählen im ägäischen Raum zu den charakteristischen
Formen der hoch- und spätarchaischen Zeit. Die Frage nach ihrer ursprünglichen Heimat ist nach wie vor
nicht endgültig geklärt, dass diese jedoch nicht in Griechenland oder Kleinasien zu suchen ist, wird allgemein
angenommen. Die Einführung der Tüllenpfeilspitzen in Anatolien und im vorderorientalischen Raum wird
gewöhnlich mit den Wanderungen der Reiternomaden aus dem Osten in Zusammenhang gebracht1192. Die
frühesten in Anatolien gefundenen Beispiele sind aufgrund der chronologischen Gegebenheiten am besten
mit den im 7. Jahrhundert in dieses Gebiet vordringenden Kimmeriern zu verbinden"93. Tüllenpfeilspitzen
wurden im westlichen Kleinasien und auf den vorgelagerten Inseln bald in das heimische Formenspektrum
übernommen und über lange Zeit verwendet. Eine lokale Produktion im ostägäischen Raum bezeugen Guss-
formen und Pfeilspitzenrohlinge aus Samos und Troja1194. Die Tüllenpfeilspitzen verbreiteten sich rasch auch
am griechischen Festland und in Westgriechenland.
XII.3.1.1.1 Zweiflügelige Tüllenpfeilspitzen mit Mittelrippe, mit und ohne Seitendorn (Kat. 890-894,
Taf. 86. 119)
Zweiflügelige Tüllenpfeilspitzen kommen im Artemision in zwei Varianten, mit und ohne Seitendorn, vor. Die beiden Pfeilspitzen
Kat. 890 und 891 haben eine im Querschnitt runde Tülle und ein flaches Blatt von lanzettförmigem Umriss. Die Mittelrippe setzt
sich aus der Tülle fort und läuft bis zur Spitze durch. Sie kann gerundet (Kat. 891) oder kantig (Kat. 890) gebildet sein. Bei Kat.
890 verjüngt sie sich gleichmäßig zur Spitze hin, bei Kat. 891 schwingen ihre Seiten ein und bilden einen schmalen Steg. Die
Kanten der Schneiden sind abgeschrägt. Die Tülle der Pfeilspitze Kat. 890 weist an einer Stelle eine runde, regelmäßig begrenz-
te Durchlochung auf195.
Die drei Pfeilspitzen Kat. 892-894 stehen in ihrer Form Kat. 890 und 891 sehr nahe, sind aber zusätzlich mit einem Dorn aus-
gestattet, welcher der Tülle unterhalb des Blattes entspringt und einen runden (Kat. 892. 894) oder viereckigen (Kat. 893) Quer-
schnitt haben kann. Soweit vollständig erhalten, reicht seine Länge über den Tüllenrand hinaus. Der Seitendorn sollte das Ent-
fernen der Spitze aus der Wunde erschweren oder verhindern. Die Tülle setzt sich auf dem lanzett- bis rautenförmigen Blatt als
Mittelrippe fort. Bei Kat. 893 und 894 ist sie von den flachen, an ihren Kanten abgeschrägten Schneiden deutlich abgesetzt und
läuft bis zur Spitze durch, während sie bei Kat. 892 bald in die im Querschnitt rhombische Spitze des Blattes übergeht. Die Pfeil-
spitze Kat. 892 hat auf einer Seite anstelle des Mittelgrates eine flache Rille; ihre Tülle ist an der dem Dorn gegenüberliegenden
Seite mit eingekerbten Linien verziert, zwischen denen ein kleines Loch sichtbar wird.
Zweiflügelige Tüllenpfeilspitzen mit und - etwas seltener - ohne Seitendorn kommen im ägäischen Raum
der hoch- und spätarchaischen Zeit sehr häufig vor1196 1197 1198. Die zahlreichen Funde aus Ephesos"97, Smyrna"98,
1192 I I. H. v. d. Osten, The Alishar Hüyük III (1937) 110 sieht die in Alishar Hüyük gefundenen Tüllenpfeilspitzen in Zusammenhang
mit der Invasion der Kimmerier. H. Weber, Angriffswaffen, in: E. Kunze - H. Schleif (Hrsg.), OF 1 (1944) 164 dagegen meint,
dass die Tüllenpfeilspitzen in Griechenland von den Skythen verbreitet wurden. Sulimirski 1954, 308 ff. verbindet das Auftreten
der zweiflügeligen Tüllenpfeilspitzen in Zentralanatolien mit der kimmerischen Invasion, jenes der dreiflügeligen Pfeilspitzen mit
den Skythen. Zusammenfassend zu dieser Diskussion: Nicholls 1958/59. 129 f. Anm. 120. 122; Snodgrass 1964. 149 ff; Hommel
1967, 136 ff. Nach Baitinger 2001. 12 f. wurden Tüllenpfeilspitzen im 7. Jh. über die ionischen Städte an der kleinasiatischen
Westküste nach Griechenland vermittelt.
1193 So Snodgrass 1964, 149 f.; Hommel 1967, 136; Boehmer 1972, 115.
1194 Jantzen 1955, 58 Taf. 64. I. 2; Reinholdt 1992, 230 f. Abb. 15a. b.
1195 Kleine Löcher in der Tüllenwandung, wie sie bei den Pfeilspitzen Kat. 890 und 892 zu beobachten sind, treten häufig auf. Sie
werden unterschiedlich als Gussfehler oder als Stiftlöcher erklärt: So entstanden nach Weber (Anm. 1192) 163 die Löcher durch
eine Verschiebung des Formzapfens, der beim Guss die Vertiefung für die Tülle ausfüllt. Boehmer 1972, 109 f. mit Anm. 756
erklärt die Löcher ebenfalls als Gussfehler. Bei zwei Pfeilspitzen schließt er allerdings nicht aus, dass es sich bei den Löchern in
der Tülle um echte Stiftlöcher handeln könnte. Auch nach Baitinger 2001, 6 handelt es sich um Gussfehler. H. Goldman, Exca-
vations at Gözlü Kule, Tarsus III. The Iron Age (1963) 369 und Hommel 1967, 135 nehmen an. dass die Löcher für die Befesti-
gung des Schaftes angelegt wurden.
1196 Boehmer 1972, 112 f. und Baitinger 2001, 13 ff. 16 f. mit weiterführenden Fundortangaben.
1197 H. B. Walters, Catalogue of the Bronzes, Greek. Roman and Etruscan. in the British Museum (1899) 347 Nr. 2812 führt unter
den im British Museum aufbewahrten Bronzen eine zweiflügelige I üllenpfeilspitze ohne Seitendorn an, die 1874 in Ephesos
gefunden wurde. Sulimirski 1954. 302 nennt drei zweiflügelige und zwei dreiflügelige Pfeilspitzen aus Ephesos im Ashmolean
Museum Oxford.
1198 Mehrere Exemplare mit und ohne Seitendorn: Nicholls 1958/59, 130 Typ b; Akurgal 1983, lexttaf. N 3.