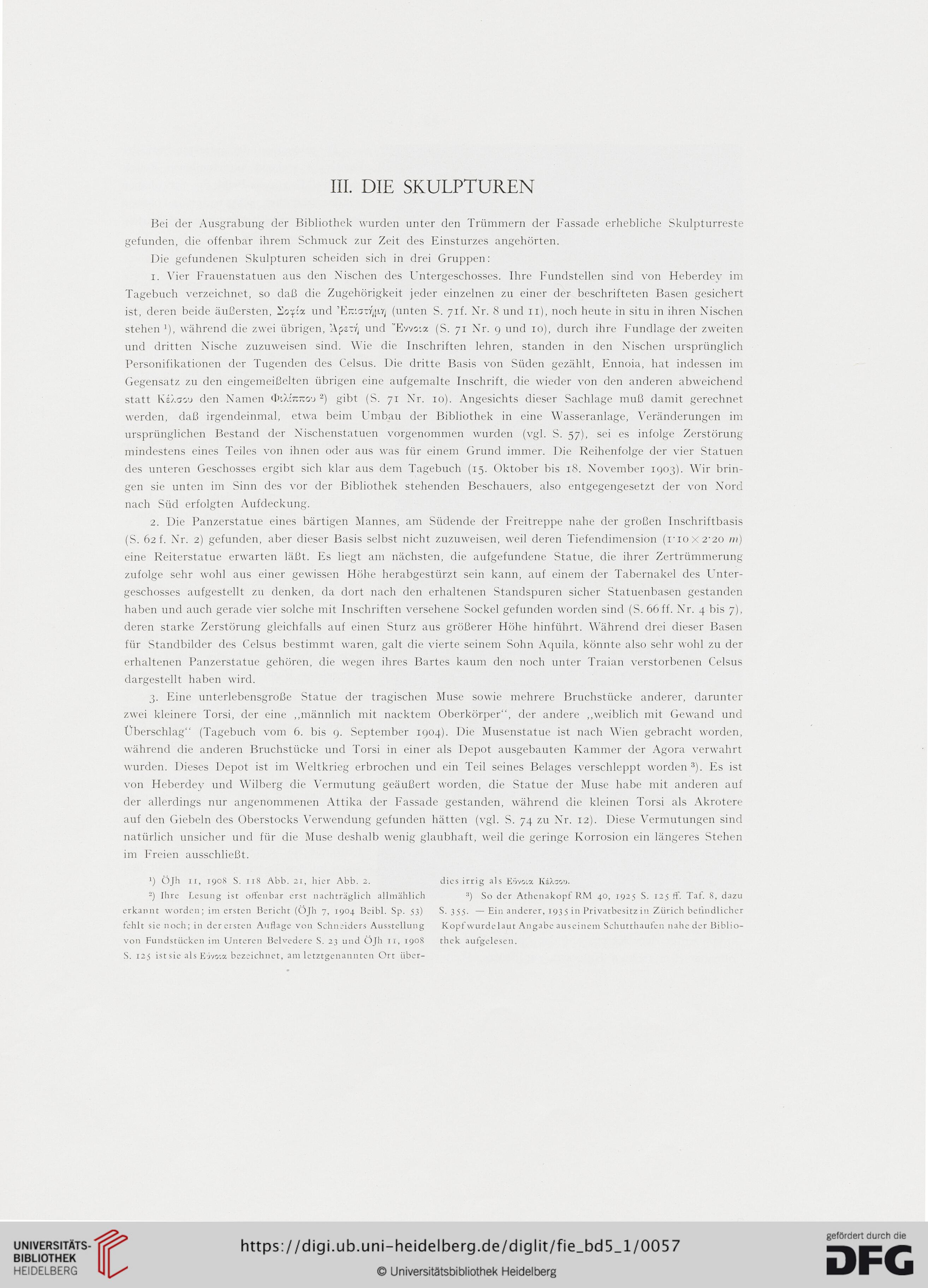III. DIE SKULPTUREN
Bei der Ausgrabung der Bibliothek wurden unter den Trümmern der Fassade erhebliche Skulpturreste
gefunden, die offenbar ihrem Schmuck zur Zeit des Einsturzes angehörten.
Die gefundenen Skulpturen scheiden sich in drei Gruppen:
1. Vier Frauenstatuen aus den Nischen des Untergeschosses. Ihre Fundstellen sind von Heberdey im
Tagebuch verzeichnet, so daß die Zugehörigkeit jeder einzelnen zu einer deK beschrifteten Basen gesichert
ist, deren beide äußersten, Sotpia und ’EnzcrcTjpj (unten S. yif. Nr. 8 und n), noch heute in situ in ihren Nischen
stehen3), während die zwei übrigen, und ”Evvota (S. 71 Nr. 9 und 10), durch ihre Fundlage der zweiten
und dritten Nische zuzuweisen sind. Wie die Inschriften lehren, standen in den Nischen ursprünglich
Personifikationen der Tugenden des Celsus. Die dritte Basis von Süden gezählt, Ennoia, hat indessen im
Gegensatz zu den eingemeißelten übrigen eine aufgemalte Inschrift, die wieder von den anderen abweichend
statt Ke/.aou den Namen 2) gibt (S. 71 Nr. 10). Angesichts dieser Sachlage muß damit gerechnet
werden, daß irgendeinmal, etwa beim Umbau der Bibliothek in eine Wasseranlage, Veränderungen im
ursprünglichen Bestand der Nischenstatuen vorgenommen wurden (vgl. S. 57), sei es infolge Zerstörung
mindestens eines Teiles von ihnen oder aus was für einem Grund immer. Die Reihenfolge der vier Statuen
des unteren Geschosses ergibt sich klar aus dem Tagebuch (15. Oktober bis 18. November 1903). Wir brin-
gen sie unten im Sinn des vor der Bibliothek stehenden Beschauers, also entgegengesetzt der von Nord
nach Süd erfolgten Aufdeckung.
2. Die Panzerstatue eines bärtigen Mannes, am Südende der Freitreppe nahe der großen Inschriftbasis
(S. 62 f. Nr. 2) gefunden, aber dieser Basis selbst nicht zuzuweisen, weil deren Tiefendimension (iuoX2-2O ni)
eine Reiterstatue erwarten läßt. Es liegt am nächsten, die aufgefundene Statue, die ihrer Zertrümmerung
zufolge sehr wohl aus einer gewissen Höhe herabgestürzt sein kann, auf einem der Tabernakel des Unter-
geschosses aufgestellt zu denken, da dort nach den erhaltenen Standspuren sicher Statuenbasen gestanden
haben und auch gerade vier solche mit Inschriften versehene Sockel gefunden worden sind (S. 66ff. Nr. 4 bis 7),
deren starke Zerstörung gleichfalls auf einen Sturz aus größerer Höhe hinführt. Während drei dieser Basen
für Standbilder des Celsus bestimmt waren, galt die vierte seinem Sohn Aquila, könnte also sehr wohl zu der
erhaltenen Panzerstatue gehören, die wegen ihres Bartes kaum den noch unter Traian verstorbenen Celsus
dargestellt haben wird.
3. Eine unterlebensgroße Statue der tragischen Muse sowie mehrere Bruchstücke anderer, darunter
zwei kleinere Torsi, der eine „männlich mit nacktem Oberkörper", der andere „weiblich mit Gewand und
Überschlag“ (Tagebuch vom 6. bis 9. September 1904). Die Musenstatue ist nach Wien gebracht worden,
während die anderen Bruchstücke und Torsi in einer als Depot ausgebauten Kammer der Agora verwahrt
wurden. Dieses Depot ist im Weltkrieg erbrochen und ein Teil seines Belages verschleppt worden3). Es ist
von Heberdey und Wilberg die Vermutung geäußert worden, die Statue der Muse habe mit anderen auf
der allerdings nur angenommenen Attika der Fassade gestanden, während die kleinen Torsi als Akrotere
auf den Giebeln des Oberstocks Verwendung gefunden hätten (vgl. S. 74 zu Nr. 12). Diese Vermutungen sind
natürlich unsicher und für die Muse deshalb wenig glaubhaft, weil die geringe Korrosion ein längeres Stehen
im Freien ausschließt.
■’) ÖJh 11, 1908 S. 118 Abb. 21, hier Abb. 2.
2) Ihre Lesung ist offenbar erst nachträglich allmählich
erkannt worden; im ersten Bericht (ÖJh 7, 1904 Beibl. Sp. 53)
fehlt sie noch; in der eisten Auflage von Schneiders Ausstellung
von Fundstücken im Unteren Belvedere S. 23 und ÖJh II, 1908
S. 125 ist sie als Eivota bezeichnet, am letztgenannten Ort über-
dies irrig als Eüvoia KsXacu.
3) So der Athenakopf RM 40, 1925 S. 125 ft'. Taf. 8, dazu
S. 355. — Ein anderer, 193 5 in Privatbesitz in Zürich befindlicher
Kopfwurdelaut Angabe auseinem Schutthaufen nahe der Biblio-
thek aufgelesen.
Bei der Ausgrabung der Bibliothek wurden unter den Trümmern der Fassade erhebliche Skulpturreste
gefunden, die offenbar ihrem Schmuck zur Zeit des Einsturzes angehörten.
Die gefundenen Skulpturen scheiden sich in drei Gruppen:
1. Vier Frauenstatuen aus den Nischen des Untergeschosses. Ihre Fundstellen sind von Heberdey im
Tagebuch verzeichnet, so daß die Zugehörigkeit jeder einzelnen zu einer deK beschrifteten Basen gesichert
ist, deren beide äußersten, Sotpia und ’EnzcrcTjpj (unten S. yif. Nr. 8 und n), noch heute in situ in ihren Nischen
stehen3), während die zwei übrigen, und ”Evvota (S. 71 Nr. 9 und 10), durch ihre Fundlage der zweiten
und dritten Nische zuzuweisen sind. Wie die Inschriften lehren, standen in den Nischen ursprünglich
Personifikationen der Tugenden des Celsus. Die dritte Basis von Süden gezählt, Ennoia, hat indessen im
Gegensatz zu den eingemeißelten übrigen eine aufgemalte Inschrift, die wieder von den anderen abweichend
statt Ke/.aou den Namen 2) gibt (S. 71 Nr. 10). Angesichts dieser Sachlage muß damit gerechnet
werden, daß irgendeinmal, etwa beim Umbau der Bibliothek in eine Wasseranlage, Veränderungen im
ursprünglichen Bestand der Nischenstatuen vorgenommen wurden (vgl. S. 57), sei es infolge Zerstörung
mindestens eines Teiles von ihnen oder aus was für einem Grund immer. Die Reihenfolge der vier Statuen
des unteren Geschosses ergibt sich klar aus dem Tagebuch (15. Oktober bis 18. November 1903). Wir brin-
gen sie unten im Sinn des vor der Bibliothek stehenden Beschauers, also entgegengesetzt der von Nord
nach Süd erfolgten Aufdeckung.
2. Die Panzerstatue eines bärtigen Mannes, am Südende der Freitreppe nahe der großen Inschriftbasis
(S. 62 f. Nr. 2) gefunden, aber dieser Basis selbst nicht zuzuweisen, weil deren Tiefendimension (iuoX2-2O ni)
eine Reiterstatue erwarten läßt. Es liegt am nächsten, die aufgefundene Statue, die ihrer Zertrümmerung
zufolge sehr wohl aus einer gewissen Höhe herabgestürzt sein kann, auf einem der Tabernakel des Unter-
geschosses aufgestellt zu denken, da dort nach den erhaltenen Standspuren sicher Statuenbasen gestanden
haben und auch gerade vier solche mit Inschriften versehene Sockel gefunden worden sind (S. 66ff. Nr. 4 bis 7),
deren starke Zerstörung gleichfalls auf einen Sturz aus größerer Höhe hinführt. Während drei dieser Basen
für Standbilder des Celsus bestimmt waren, galt die vierte seinem Sohn Aquila, könnte also sehr wohl zu der
erhaltenen Panzerstatue gehören, die wegen ihres Bartes kaum den noch unter Traian verstorbenen Celsus
dargestellt haben wird.
3. Eine unterlebensgroße Statue der tragischen Muse sowie mehrere Bruchstücke anderer, darunter
zwei kleinere Torsi, der eine „männlich mit nacktem Oberkörper", der andere „weiblich mit Gewand und
Überschlag“ (Tagebuch vom 6. bis 9. September 1904). Die Musenstatue ist nach Wien gebracht worden,
während die anderen Bruchstücke und Torsi in einer als Depot ausgebauten Kammer der Agora verwahrt
wurden. Dieses Depot ist im Weltkrieg erbrochen und ein Teil seines Belages verschleppt worden3). Es ist
von Heberdey und Wilberg die Vermutung geäußert worden, die Statue der Muse habe mit anderen auf
der allerdings nur angenommenen Attika der Fassade gestanden, während die kleinen Torsi als Akrotere
auf den Giebeln des Oberstocks Verwendung gefunden hätten (vgl. S. 74 zu Nr. 12). Diese Vermutungen sind
natürlich unsicher und für die Muse deshalb wenig glaubhaft, weil die geringe Korrosion ein längeres Stehen
im Freien ausschließt.
■’) ÖJh 11, 1908 S. 118 Abb. 21, hier Abb. 2.
2) Ihre Lesung ist offenbar erst nachträglich allmählich
erkannt worden; im ersten Bericht (ÖJh 7, 1904 Beibl. Sp. 53)
fehlt sie noch; in der eisten Auflage von Schneiders Ausstellung
von Fundstücken im Unteren Belvedere S. 23 und ÖJh II, 1908
S. 125 ist sie als Eivota bezeichnet, am letztgenannten Ort über-
dies irrig als Eüvoia KsXacu.
3) So der Athenakopf RM 40, 1925 S. 125 ft'. Taf. 8, dazu
S. 355. — Ein anderer, 193 5 in Privatbesitz in Zürich befindlicher
Kopfwurdelaut Angabe auseinem Schutthaufen nahe der Biblio-
thek aufgelesen.