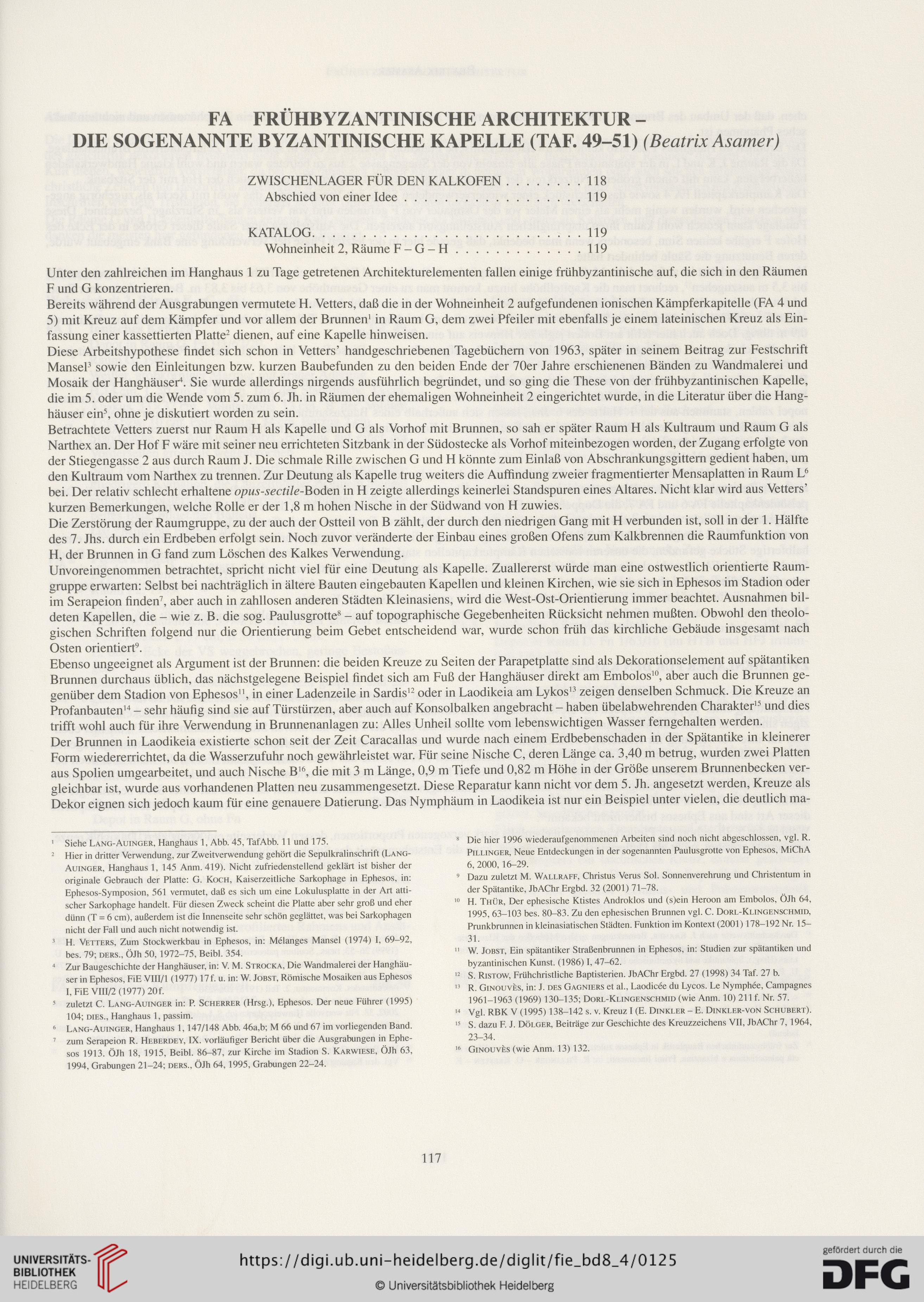FA FRÜHBYZANTINISCHE ARCHITEKTUR -
DIE SOGENANNTE BYZANTINISCHE KAPELLE (TAF. 49-51) (Beatrix Asamer)
ZWISCHENLAGER FÜR DEN KALKOFEN.118
Abschied von einer Idee.119
KATALOG.119
Wohneinheit 2, Räume F - G - H.119
Unter den zahlreichen im Hanghaus 1 zu Tage getretenen Architekturelementen fallen einige frühbyzantinische auf, die sich in den Räumen
F und G konzentrieren.
Bereits während der Ausgrabungen vermutete H. Vetters, daß die in der Wohneinheit 2 aufgefundenen ionischen Kämpferkapitelle (FA 4 und
5) mit Kreuz auf dem Kämpfer und vor allem der Brunnen1 in Raum G, dem zwei Pfeiler mit ebenfalls je einem lateinischen Kreuz als Ein-
fassung einer kassettierten Platte2 dienen, auf eine Kapelle hinweisen.
Diese Arbeitshypothese findet sich schon in Vetters’ handgeschriebenen Tagebüchern von 1963, später in seinem Beitrag zur Festschrift
Mansel3 sowie den Einleitungen bzw. kurzen Baubefunden zu den beiden Ende der 70er Jahre erschienenen Bänden zu Wandmalerei und
Mosaik der Hanghäuser4. Sie wurde allerdings nirgends ausführlich begründet, und so ging die These von der frühbyzantinischen Kapelle,
die im 5. oder um die Wende vom 5. zum 6. Jh. in Räumen der ehemaligen Wohneinheit 2 eingerichtet wurde, in die Literatur über die Hang-
häuser ein5, ohne je diskutiert worden zu sein.
Betrachtete Vetters zuerst nur Raum H als Kapelle und G als Vorhof mit Brunnen, so sah er später Raum H als Kultraum und Raum G als
Narthex an. Der Hof F wäre mit seiner neu errichteten Sitzbank in der Südostecke als Vorhof miteinbezogen worden, der Zugang erfolgte von
der Stiegengasse 2 aus durch Raum J. Die schmale Rille zwischen G und H könnte zum Einlaß von Abschrankungsgittem gedient haben, um
den Kultraum vom Narthex zu trennen. Zur Deutung als Kapelle trug weiters die Auffindung zweier fragmentierter Mensaplatten in Raum L6
bei. Der relativ schlecht erhaltene opus-sectile-Boden in H zeigte allerdings keinerlei Standspuren eines Altares. Nicht klar wird aus Vetters’
kurzen Bemerkungen, welche Rolle er der 1,8 m hohen Nische in der Südwand von H zuwies.
Die Zerstörung der Raumgruppe, zu der auch der Ostteil von B zählt, der durch den niedrigen Gang mit H verbunden ist, soll in der 1. Hälfte
des 7. Jhs. durch ein Erdbeben erfolgt sein. Noch zuvor veränderte der Einbau eines großen Ofens zum Kalkbrennen die Raumfunktion von
H, der Brunnen in G fand zum Löschen des Kalkes Verwendung.
Unvoreingenommen betrachtet, spricht nicht viel für eine Deutung als Kapelle. Zuallererst würde man eine ostwestlich orientierte Raum-
gruppe erwarten: Selbst bei nachträglich in ältere Bauten eingebauten Kapellen und kleinen Kirchen, wie sie sich in Ephesos im Stadion oder
im Serapeion finden7, aber auch in zahllosen anderen Städten Kleinasiens, wird die West-Ost-Orientierung immer beachtet. Ausnahmen bil-
deten Kapellen, die - wie z. B. die sog. Paulusgrotte8 - auf topographische Gegebenheiten Rücksicht nehmen mußten. Obwohl den theolo-
gischen Schriften folgend nur die Orientierung beim Gebet entscheidend war, wurde schon früh das kirchliche Gebäude insgesamt nach
Osten orientiert9.
Ebenso ungeeignet als Argument ist der Brunnen: die beiden Kreuze zu Seiten der Parapetplatte sind als Dekorationselement auf spätantiken
Brunnen durchaus üblich, das nächstgelegene Beispiel findet sich am Fuß der Hanghäuser direkt am Embolos10, aber auch die Brunnen ge-
genüber dem Stadion von Ephesos11, in einer Ladenzeile in Sardis12 oder in Laodikeia am Lykos13 zeigen denselben Schmuck. Die Kreuze an
Profanbauten14 — sehr häufig sind sie auf Türstürzen, aber auch auf Konsolbalken angebracht - haben übelabwehrenden Charakter15 und dies
trifft wohl auch für ihre Verwendung in Brunnenanlagen zu: Alles Unheil sollte vom lebenswichtigen Wasser femgehalten werden.
Der Brunnen in Laodikeia existierte schon seit der Zeit Caracallas und wurde nach einem Erdbebenschaden in der Spätantike in kleinerer
Form wiedererrichtet, da die Wasserzufuhr noch gewährleistet war. Für seine Nische C, deren Länge ca. 3,40 m betrug, wurden zwei Platten
aus Spolien umgearbeitet, und auch Nische B16, die mit 3 m Länge, 0,9 m Tiefe und 0,82 m Höhe in der Größe unserem Brunnenbecken ver-
gleichbar ist, wurde aus vorhandenen Platten neu zusammengesetzt. Diese Reparatur kann nicht vor dem 5. Jh. angesetzt werden, Kreuze als
Dekor eignen sich jedoch kaum für eine genauere Datierung. Das Nymphäum in Laodikeia ist nur ein Beispiel unter vielen, die deutlich ma-
1 Siehe Lang-Auinger, Hanghaus 1, Abb. 45, TafAbb. 11 und 175.
2 Hier in dritter Verwendung, zur Zweitverwendung gehört die Sepulkralinschrift (Lang-
Auinger, Hanghaus 1, 145 Anm. 419). Nicht zufriedenstellend geklärt ist bisher der
originale Gebrauch der Platte: G. Koch, Kaiserzeitliche Sarkophage in Ephesos, in:
Ephesos-Symposion, 561 vermutet, daß es sich um eine Lokulusplatte in der Art atti-
scher Sarkophage handelt. Für diesen Zweck scheint die Platte aber sehr groß und eher
dünn (T = 6 cm), außerdem ist die Innenseite sehr schön geglättet, was bei Sarkophagen
nicht der Fall und auch nicht notwendig ist.
3 H. Vetters, Zum Stockwerkbau in Ephesos, in: Melanges Mansel (1974) I, 69-92,
bes. 79; ders., ÖJh 50, 1972-75, Beibl. 354.
4 Zur Baugeschichte der Hanghäuser, in: V. M. Strocka, Die Wandmalerei der Hanghäu-
ser in Ephesos, FiE VIII/1 (1977) 17 f. u. in: W. Jobst, Römische Mosaiken aus Ephesos
I, FiE VIII/2 (1977) 20f.
5 zuletzt C. Lang-Auinger in: P. Scherrer (Hrsg.), Ephesos. Der neue Führer (1995)
104; dies., Hanghaus 1, passim.
6 Lang-Auinger, Hanghaus 1,147/148 Abb. 46a,b; M 66 und 67 im vorliegenden Band.
7 zum Serapeion R. Heberdey, IX. vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephe-
sos 1913. ÖJh 18, 1915, Beibl. 86-87, zur Kirche im Stadion S. Karwiese, ÖJh 63,
1994, Grabungen 21-24; ders., ÖJh 64, 1995, Grabungen 22-24.
8 Die hier 1996 wiederaufgenommenen Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, vgl. R.
Pillinger, Neue Entdeckungen in der sogenannten Paulusgrotte von Ephesos, MiChA
6, 2000, 16-29.
9 Dazu zuletzt M. Wallraff, Christus Verus Sol. Sonnenverehrung und Christentum in
der Spätantike, JbAChr Ergbd. 32 (2001) 71-78.
10 H. Thür, Der ephesische Ktistes Androklos und (s)ein Heroon am Embolos, ÖJh 64,
1995, 63-103 bes. 80-83. Zu den ephesischen Brunnen vgl. C. Dorl-Klingenschmid,
Prunkbrunnen in kleinasiatischen Städten. Funktion im Kontext (2001) 178-192 Nr. 15-
31.
11 W. Jobst, Ein spätantiker Straßenbrunnen in Ephesos, in: Studien zur spätantiken und
byzantinischen Kunst. (1986) I, 47-62.
12 S. Ristow, Frühchristliche Baptisterien. JbAChr Ergbd. 27 (1998) 34 Taf. 27 b.
13 R. Ginouves, in: J. des Gagniers et al., Laodicee du Lycos. Le Nymphee, Campagnes
1961-1963 (1969) 130-135; Dorl-Klingenschmid (wie Anm. 10) 211 f. Nr. 57.
14 Vgl. RBK V (1995) 138-142 s. v. Kreuz I (E. Dinkler - E. Dinkler-von Schubert).
15 S. dazu F. J. Dölger, Beiträge zur Geschichte des Kreuzzeichens VII, JbAChr 7,1964,
23-34.
16 Ginouves (wie Anm. 13) 132.
117
DIE SOGENANNTE BYZANTINISCHE KAPELLE (TAF. 49-51) (Beatrix Asamer)
ZWISCHENLAGER FÜR DEN KALKOFEN.118
Abschied von einer Idee.119
KATALOG.119
Wohneinheit 2, Räume F - G - H.119
Unter den zahlreichen im Hanghaus 1 zu Tage getretenen Architekturelementen fallen einige frühbyzantinische auf, die sich in den Räumen
F und G konzentrieren.
Bereits während der Ausgrabungen vermutete H. Vetters, daß die in der Wohneinheit 2 aufgefundenen ionischen Kämpferkapitelle (FA 4 und
5) mit Kreuz auf dem Kämpfer und vor allem der Brunnen1 in Raum G, dem zwei Pfeiler mit ebenfalls je einem lateinischen Kreuz als Ein-
fassung einer kassettierten Platte2 dienen, auf eine Kapelle hinweisen.
Diese Arbeitshypothese findet sich schon in Vetters’ handgeschriebenen Tagebüchern von 1963, später in seinem Beitrag zur Festschrift
Mansel3 sowie den Einleitungen bzw. kurzen Baubefunden zu den beiden Ende der 70er Jahre erschienenen Bänden zu Wandmalerei und
Mosaik der Hanghäuser4. Sie wurde allerdings nirgends ausführlich begründet, und so ging die These von der frühbyzantinischen Kapelle,
die im 5. oder um die Wende vom 5. zum 6. Jh. in Räumen der ehemaligen Wohneinheit 2 eingerichtet wurde, in die Literatur über die Hang-
häuser ein5, ohne je diskutiert worden zu sein.
Betrachtete Vetters zuerst nur Raum H als Kapelle und G als Vorhof mit Brunnen, so sah er später Raum H als Kultraum und Raum G als
Narthex an. Der Hof F wäre mit seiner neu errichteten Sitzbank in der Südostecke als Vorhof miteinbezogen worden, der Zugang erfolgte von
der Stiegengasse 2 aus durch Raum J. Die schmale Rille zwischen G und H könnte zum Einlaß von Abschrankungsgittem gedient haben, um
den Kultraum vom Narthex zu trennen. Zur Deutung als Kapelle trug weiters die Auffindung zweier fragmentierter Mensaplatten in Raum L6
bei. Der relativ schlecht erhaltene opus-sectile-Boden in H zeigte allerdings keinerlei Standspuren eines Altares. Nicht klar wird aus Vetters’
kurzen Bemerkungen, welche Rolle er der 1,8 m hohen Nische in der Südwand von H zuwies.
Die Zerstörung der Raumgruppe, zu der auch der Ostteil von B zählt, der durch den niedrigen Gang mit H verbunden ist, soll in der 1. Hälfte
des 7. Jhs. durch ein Erdbeben erfolgt sein. Noch zuvor veränderte der Einbau eines großen Ofens zum Kalkbrennen die Raumfunktion von
H, der Brunnen in G fand zum Löschen des Kalkes Verwendung.
Unvoreingenommen betrachtet, spricht nicht viel für eine Deutung als Kapelle. Zuallererst würde man eine ostwestlich orientierte Raum-
gruppe erwarten: Selbst bei nachträglich in ältere Bauten eingebauten Kapellen und kleinen Kirchen, wie sie sich in Ephesos im Stadion oder
im Serapeion finden7, aber auch in zahllosen anderen Städten Kleinasiens, wird die West-Ost-Orientierung immer beachtet. Ausnahmen bil-
deten Kapellen, die - wie z. B. die sog. Paulusgrotte8 - auf topographische Gegebenheiten Rücksicht nehmen mußten. Obwohl den theolo-
gischen Schriften folgend nur die Orientierung beim Gebet entscheidend war, wurde schon früh das kirchliche Gebäude insgesamt nach
Osten orientiert9.
Ebenso ungeeignet als Argument ist der Brunnen: die beiden Kreuze zu Seiten der Parapetplatte sind als Dekorationselement auf spätantiken
Brunnen durchaus üblich, das nächstgelegene Beispiel findet sich am Fuß der Hanghäuser direkt am Embolos10, aber auch die Brunnen ge-
genüber dem Stadion von Ephesos11, in einer Ladenzeile in Sardis12 oder in Laodikeia am Lykos13 zeigen denselben Schmuck. Die Kreuze an
Profanbauten14 — sehr häufig sind sie auf Türstürzen, aber auch auf Konsolbalken angebracht - haben übelabwehrenden Charakter15 und dies
trifft wohl auch für ihre Verwendung in Brunnenanlagen zu: Alles Unheil sollte vom lebenswichtigen Wasser femgehalten werden.
Der Brunnen in Laodikeia existierte schon seit der Zeit Caracallas und wurde nach einem Erdbebenschaden in der Spätantike in kleinerer
Form wiedererrichtet, da die Wasserzufuhr noch gewährleistet war. Für seine Nische C, deren Länge ca. 3,40 m betrug, wurden zwei Platten
aus Spolien umgearbeitet, und auch Nische B16, die mit 3 m Länge, 0,9 m Tiefe und 0,82 m Höhe in der Größe unserem Brunnenbecken ver-
gleichbar ist, wurde aus vorhandenen Platten neu zusammengesetzt. Diese Reparatur kann nicht vor dem 5. Jh. angesetzt werden, Kreuze als
Dekor eignen sich jedoch kaum für eine genauere Datierung. Das Nymphäum in Laodikeia ist nur ein Beispiel unter vielen, die deutlich ma-
1 Siehe Lang-Auinger, Hanghaus 1, Abb. 45, TafAbb. 11 und 175.
2 Hier in dritter Verwendung, zur Zweitverwendung gehört die Sepulkralinschrift (Lang-
Auinger, Hanghaus 1, 145 Anm. 419). Nicht zufriedenstellend geklärt ist bisher der
originale Gebrauch der Platte: G. Koch, Kaiserzeitliche Sarkophage in Ephesos, in:
Ephesos-Symposion, 561 vermutet, daß es sich um eine Lokulusplatte in der Art atti-
scher Sarkophage handelt. Für diesen Zweck scheint die Platte aber sehr groß und eher
dünn (T = 6 cm), außerdem ist die Innenseite sehr schön geglättet, was bei Sarkophagen
nicht der Fall und auch nicht notwendig ist.
3 H. Vetters, Zum Stockwerkbau in Ephesos, in: Melanges Mansel (1974) I, 69-92,
bes. 79; ders., ÖJh 50, 1972-75, Beibl. 354.
4 Zur Baugeschichte der Hanghäuser, in: V. M. Strocka, Die Wandmalerei der Hanghäu-
ser in Ephesos, FiE VIII/1 (1977) 17 f. u. in: W. Jobst, Römische Mosaiken aus Ephesos
I, FiE VIII/2 (1977) 20f.
5 zuletzt C. Lang-Auinger in: P. Scherrer (Hrsg.), Ephesos. Der neue Führer (1995)
104; dies., Hanghaus 1, passim.
6 Lang-Auinger, Hanghaus 1,147/148 Abb. 46a,b; M 66 und 67 im vorliegenden Band.
7 zum Serapeion R. Heberdey, IX. vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephe-
sos 1913. ÖJh 18, 1915, Beibl. 86-87, zur Kirche im Stadion S. Karwiese, ÖJh 63,
1994, Grabungen 21-24; ders., ÖJh 64, 1995, Grabungen 22-24.
8 Die hier 1996 wiederaufgenommenen Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, vgl. R.
Pillinger, Neue Entdeckungen in der sogenannten Paulusgrotte von Ephesos, MiChA
6, 2000, 16-29.
9 Dazu zuletzt M. Wallraff, Christus Verus Sol. Sonnenverehrung und Christentum in
der Spätantike, JbAChr Ergbd. 32 (2001) 71-78.
10 H. Thür, Der ephesische Ktistes Androklos und (s)ein Heroon am Embolos, ÖJh 64,
1995, 63-103 bes. 80-83. Zu den ephesischen Brunnen vgl. C. Dorl-Klingenschmid,
Prunkbrunnen in kleinasiatischen Städten. Funktion im Kontext (2001) 178-192 Nr. 15-
31.
11 W. Jobst, Ein spätantiker Straßenbrunnen in Ephesos, in: Studien zur spätantiken und
byzantinischen Kunst. (1986) I, 47-62.
12 S. Ristow, Frühchristliche Baptisterien. JbAChr Ergbd. 27 (1998) 34 Taf. 27 b.
13 R. Ginouves, in: J. des Gagniers et al., Laodicee du Lycos. Le Nymphee, Campagnes
1961-1963 (1969) 130-135; Dorl-Klingenschmid (wie Anm. 10) 211 f. Nr. 57.
14 Vgl. RBK V (1995) 138-142 s. v. Kreuz I (E. Dinkler - E. Dinkler-von Schubert).
15 S. dazu F. J. Dölger, Beiträge zur Geschichte des Kreuzzeichens VII, JbAChr 7,1964,
23-34.
16 Ginouves (wie Anm. 13) 132.
117