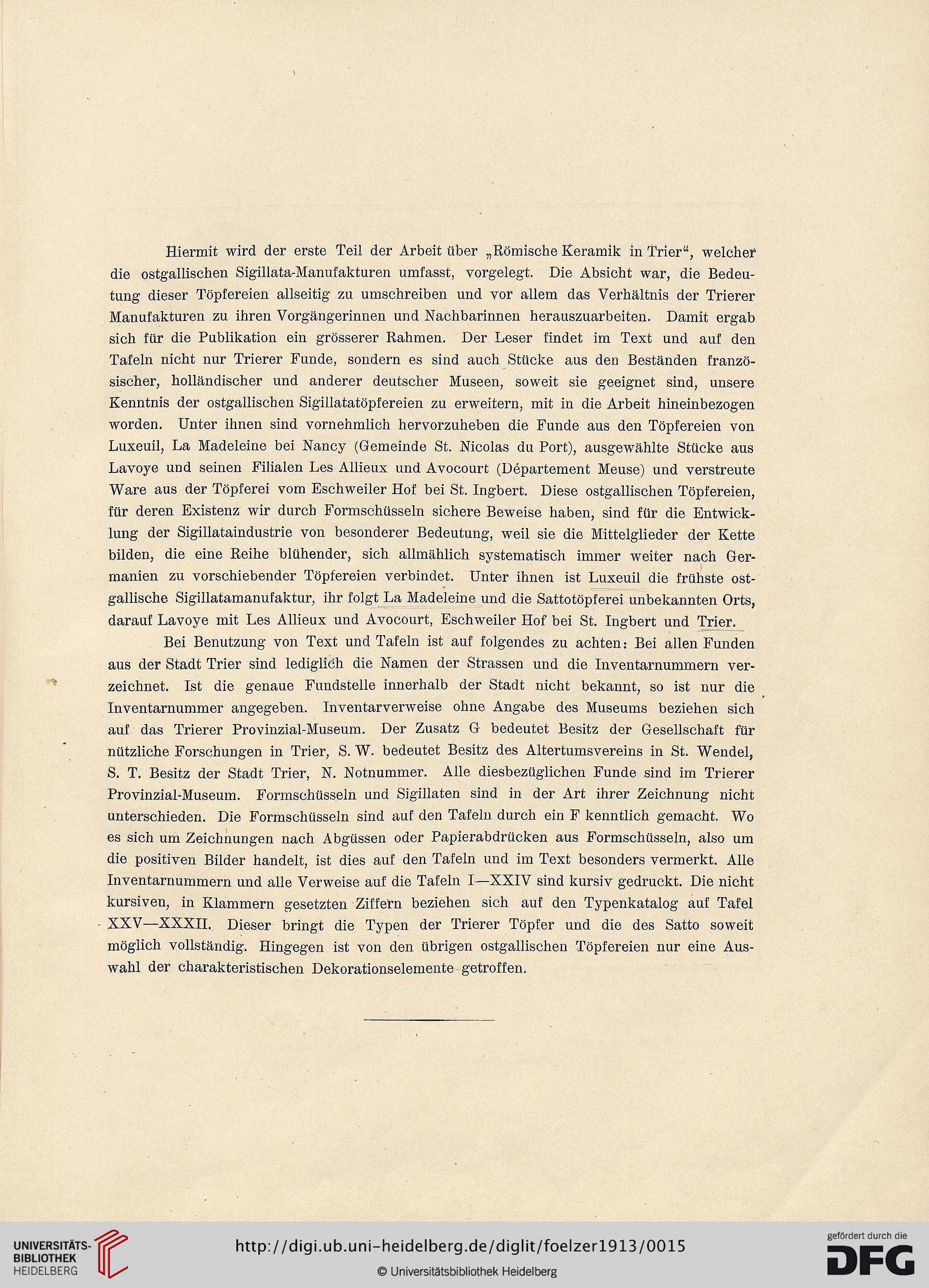Hiermit wird der erste Teil der Arbeit über „Römische Keramik in Trier", welcher
die ostgallischen Sigillata-Manufakturen umfasst, vorgelegt. Die Absicht war, die Bedeu-
tung dieser Töpfereien allseitig zu umschreiben und vor allem das Verhältnis der Trierer
Manufakturen zu ihren Vorgängerinnen und Nachbarinnen herauszuarbeiten. Damit ergab
sich für die Publikation ein grösserer Rahmen. Der Leser findet im Text und auf den
Tafeln nicht nur Trierer Funde, sondern es sind auch Stücke aus den Beständen franzö-
sischer, holländischer und anderer deutscher Museen, soweit sie geeignet sind, unsere
Kenntnis der ostgallischen Sigillatatöpfereien zu erweitern, mit in die Arbeit hineinbezogen
worden. Unter ihnen sind vornehmlich hervorzuheben die Funde aus den Töpfereien von
Luxeuil, La Madeleine bei Nancy (Gemeinde St. Nicolas du Port), ausgewählte Stücke aus
Lavoye und seinen Filialen Les Allieux und Avocourt (Departement Meuse) und verstreute
Ware aus der Töpferei vom Eschweiler Hof bei St. Ingbert. Diese ostgallischen Töpfereien,
für deren Existenz wir durch Formschüsseln sichere Beweise haben, sind für die Entwick-
lung der Sigillataindustrie von besonderer Bedeutung, weil sie die Mittelglieder der Kette
bilden, die eine Reihe blühender, sich allmählich systematisch immer weiter nach Ger-
manien zu vorschiebender Töpfereien verbindet. Unter ihnen ist Luxeuil die frühste ost-
gallische Sigillatamanufaktur, ihr folgt La Madeleine und die Sattotöpferei unbekannten Orts,
darauf Lavoye mit Les Allieux und Avocourt, Eschweiler Hof bei St. Ingbert und Trier.
Bei Benutzung von Text und Tafeln ist auf folgendes zu achten: Bei allen Funden
aus der Stadt Trier sind lediglich die Namen der Strassen und die Inventarnummern ver-
zeichnet. Ist die genaue Fundstelle innerhalb der Stadt nicht bekannt, so ist nur die
Inventarnummer angegeben. Inventarverweise ohne Angabe des Museums beziehen sich
auf das Trierer Provinzial-Museum. Der Zusatz G bedeutet Besitz der Gesellschaft für
nützliche Forschungen in Trier, S. W. bedeutet Besitz des Altertumsvereins in St. Wendel,
S. T. Besitz der Stadt Trier, N. Notnummer. Alle diesbezüglichen Funde sind im Trierer
Provinzial-Museum. Formschüsseln und Sigillaten sind in der Art ihrer Zeichnung nicht
unterschieden. Die Formschüsseln sind auf den Tafeln durch ein F kenntlich gemacht. Wo
es sich um Zeichnungen nach Abgüssen oder Papierabdrücken aus Formschüsseln, also um
die positiven Bilder handelt, ist dies auf den Tafeln und im Text besonders vermerkt. Alle
Inventarnummern und alle Verweise auf die Tafeln I—XXIV sind kursiv gedruckt. Die nicht
kursiven, in Klammern gesetzten Ziffern beziehen sich auf den Typenkatalog auf Tafel
XXV—XXXII. Dieser bringt die Typen der Trierer Töpfer und die des Satto soweit
möglich vollständig. Hingegen ist von den übrigen ostgallischen Töpfereien nur eine Aus-
wahl der charakteristischen Dekorationselemente getroffen.
die ostgallischen Sigillata-Manufakturen umfasst, vorgelegt. Die Absicht war, die Bedeu-
tung dieser Töpfereien allseitig zu umschreiben und vor allem das Verhältnis der Trierer
Manufakturen zu ihren Vorgängerinnen und Nachbarinnen herauszuarbeiten. Damit ergab
sich für die Publikation ein grösserer Rahmen. Der Leser findet im Text und auf den
Tafeln nicht nur Trierer Funde, sondern es sind auch Stücke aus den Beständen franzö-
sischer, holländischer und anderer deutscher Museen, soweit sie geeignet sind, unsere
Kenntnis der ostgallischen Sigillatatöpfereien zu erweitern, mit in die Arbeit hineinbezogen
worden. Unter ihnen sind vornehmlich hervorzuheben die Funde aus den Töpfereien von
Luxeuil, La Madeleine bei Nancy (Gemeinde St. Nicolas du Port), ausgewählte Stücke aus
Lavoye und seinen Filialen Les Allieux und Avocourt (Departement Meuse) und verstreute
Ware aus der Töpferei vom Eschweiler Hof bei St. Ingbert. Diese ostgallischen Töpfereien,
für deren Existenz wir durch Formschüsseln sichere Beweise haben, sind für die Entwick-
lung der Sigillataindustrie von besonderer Bedeutung, weil sie die Mittelglieder der Kette
bilden, die eine Reihe blühender, sich allmählich systematisch immer weiter nach Ger-
manien zu vorschiebender Töpfereien verbindet. Unter ihnen ist Luxeuil die frühste ost-
gallische Sigillatamanufaktur, ihr folgt La Madeleine und die Sattotöpferei unbekannten Orts,
darauf Lavoye mit Les Allieux und Avocourt, Eschweiler Hof bei St. Ingbert und Trier.
Bei Benutzung von Text und Tafeln ist auf folgendes zu achten: Bei allen Funden
aus der Stadt Trier sind lediglich die Namen der Strassen und die Inventarnummern ver-
zeichnet. Ist die genaue Fundstelle innerhalb der Stadt nicht bekannt, so ist nur die
Inventarnummer angegeben. Inventarverweise ohne Angabe des Museums beziehen sich
auf das Trierer Provinzial-Museum. Der Zusatz G bedeutet Besitz der Gesellschaft für
nützliche Forschungen in Trier, S. W. bedeutet Besitz des Altertumsvereins in St. Wendel,
S. T. Besitz der Stadt Trier, N. Notnummer. Alle diesbezüglichen Funde sind im Trierer
Provinzial-Museum. Formschüsseln und Sigillaten sind in der Art ihrer Zeichnung nicht
unterschieden. Die Formschüsseln sind auf den Tafeln durch ein F kenntlich gemacht. Wo
es sich um Zeichnungen nach Abgüssen oder Papierabdrücken aus Formschüsseln, also um
die positiven Bilder handelt, ist dies auf den Tafeln und im Text besonders vermerkt. Alle
Inventarnummern und alle Verweise auf die Tafeln I—XXIV sind kursiv gedruckt. Die nicht
kursiven, in Klammern gesetzten Ziffern beziehen sich auf den Typenkatalog auf Tafel
XXV—XXXII. Dieser bringt die Typen der Trierer Töpfer und die des Satto soweit
möglich vollständig. Hingegen ist von den übrigen ostgallischen Töpfereien nur eine Aus-
wahl der charakteristischen Dekorationselemente getroffen.