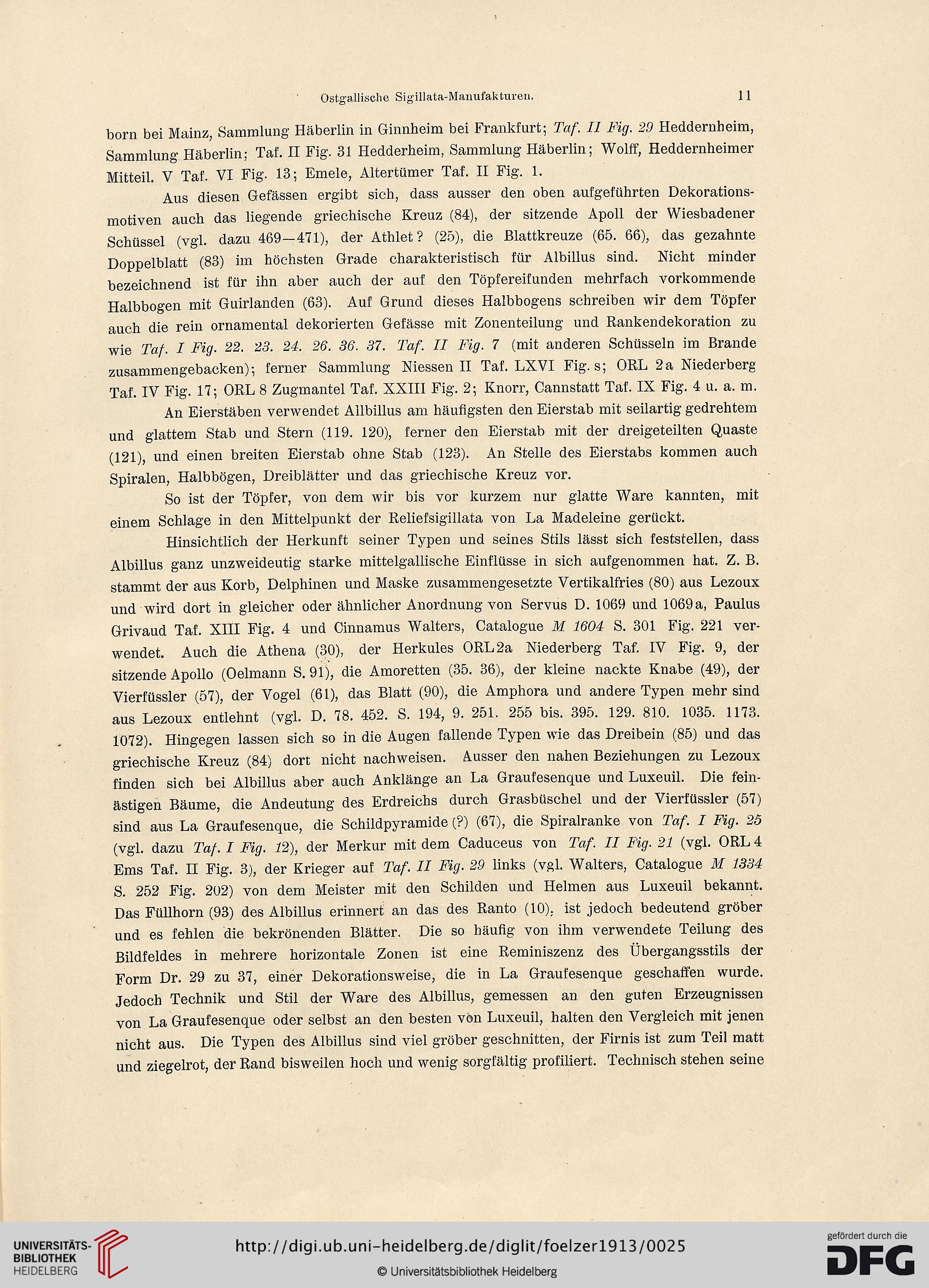Ostg'altische Sigillata-Maiiufaktureu.
11
born bei Mainz, Sammlung' Häberlin in Ginnheim bei Frankfurt; 7b/'. 77 77g. 29 Heddernheim,
Sammlung Häberlin; Taf. II Fig. 31 Hedderheim, Sammlung Häberlin; Wollt', Heddernheimer
Mitteil. V Taf. VI Fig. 13; Emele, Altertümer Taf. II Fig. 1.
Aus diesen Gefässen ergibt sich, dass ausser den oben aufgeführten Dekorations-
motiven auch das liegende griechische Kreuz (84), der sitzende Apoll der Wiesbadener
Schüssel (vgl. dazu 469—471), der Athlet? (25), die ßlattkreuze (65. 66), das gezahnte
Doppelblatt (83) im höchsten Grade charakteristisch für Albillus sind. Nicht minder
bezeichnend ist für ihn aber auch der auf den Töpfereifunden mehrfach vorkommende
Halbbogen mit Guirlanden (63). Auf Grund dieses Halbbogens schreiben wir dem Töpfer
auch die rein ornamental dekorierten Gefässe mit Zonenteilung und Rankendekoration zu
wie Tn/. 7 7%. 22. 29. 24. 26. 96. 97. 7h/. 77 7<7g. 7 (mit anderen Schüsseln im Brande
zusammengebacken); ferner Sammlung Niessenil Taf. LXVI Fig. s; ORL 2a Niederberg
Taf. IV Fig. 17; ORL 8 Zugmantel Taf. XXIII Fig. 2; Knorr, Cannstatt Taf. IX Fig. 4 u. a. m.
An Eierstäben verwendet Ailbillus am häufigsten den Eierstab mit seilartig gedrehtem
und glattem Stab und Stern (119. 120), ferner den Eierstab mit der dreigeteilten Quaste
(121), und einen breiten Eierstab ohne Stab (123). An Stelle des Eierstabs kommen auch
Spiralen, Halbbögen, Dreiblätter und das griechische Kreuz vor.
So ist der Töpfer, von dem wir bis vor kurzem nur glatte Ware kannten, mit
einem Schlage in den Mittelpunkt der Reliefsigillata von La Madeleine gerückt.
Hinsichtlich der Herkunft seiner Typen und seines Stils lässt sich festsfelien, dass
Albillus ganz unzweideutig starke mittelgallische Einflüsse in sich aufgenommen hat. Z. B.
stammt der aus Korb, Delphinen und Maske zusammengesetzte Vertikalfries (80) aus Lezoux
und wird dort in gleicher oder ähnlicher Anordnung von Servus D. 1069 und 1069a, Paulus
Grivaud Taf. XIII Fig. 4 und Cinnamus Walters, Catalogue 47 1604 S. 301 Fig. 221 ver-
wendet. Auch die Athena (30), der Herkules ORL 2a Niederberg Taf. IV Fig. 9, der
sitzende Apollo (Oelmann S. 91), die Amoretten (35. 36), der kleine nackte Knabe (49), der
Vierfüssler (57), der Vogel (61), das Blatt (90), die Amphora und andere Typen mehr sind
aus Lezoux entlehnt (vgl. D. 78. 452. S. 194, 9. 251. 255 bis. 395. 129. 810. 1035. 1173.
1072). Hingegen lassen sich so in die Augen fallende Typen wie das Dreibein (85) und das
griechische Kreuz (84) dort nicht nachweisen. Ausser den nahen Beziehungen zu Lezoux
finden sich bei Albillus aber auch Anklänge an La Graufesenque und Luxeuil. Die fein-
ästigen Bäume, die Andeutung des Erdreichs durch Grasbüschel und der Vierfüssler (57)
sind aus La Graufesenque, die Schildpyramide (?) (67), die Spiralranke von Ta/. 7 F7g. 25
(vgl. dazu 7h/. 7 77g. 12), der Merkur mit dem Caduceus von Ta/. 77 Fig. 21 (vgl. ORL 4
Ems Taf. II Fig. 3), der Krieger auf Ta/'. 77 Fig. 29 links (vgl. Walters, Catalogue 47 7994
S. 252 Fig. 202) von dem Meister mit den Schilden und Helmen aus Luxeuil bekannt.
Das Füllhorn (93) des Albillus erinnert an das des Ranto (10), ist jedoch bedeutend gröber
und es fehlen die bekrönenden Blätter. Die so häufig von ihm verwendete Teilung des
Bildfeldes in mehrere horizontale Zonen ist eine Reminiszenz des Übergangsstils der
Form Dr. 29 zu 37, einer Dekorationsweise, die in La Graufesenque geschaffen wurde.
Jedoch Technik und Stil der Ware des Albillus, gemessen an den guten Erzeugnissen
von La Graufesenque oder selbst an den besten von Luxeuil, halten den Vergleich mit jenen
nicht aus. Die Typen des Albillus sind viel gröber geschnitten, der Firnis ist zum Teil matt
und ziegelrot, der Rand bisweilen hoch und wenig sorgfältig profiliert. Technisch stehen seine
11
born bei Mainz, Sammlung' Häberlin in Ginnheim bei Frankfurt; 7b/'. 77 77g. 29 Heddernheim,
Sammlung Häberlin; Taf. II Fig. 31 Hedderheim, Sammlung Häberlin; Wollt', Heddernheimer
Mitteil. V Taf. VI Fig. 13; Emele, Altertümer Taf. II Fig. 1.
Aus diesen Gefässen ergibt sich, dass ausser den oben aufgeführten Dekorations-
motiven auch das liegende griechische Kreuz (84), der sitzende Apoll der Wiesbadener
Schüssel (vgl. dazu 469—471), der Athlet? (25), die ßlattkreuze (65. 66), das gezahnte
Doppelblatt (83) im höchsten Grade charakteristisch für Albillus sind. Nicht minder
bezeichnend ist für ihn aber auch der auf den Töpfereifunden mehrfach vorkommende
Halbbogen mit Guirlanden (63). Auf Grund dieses Halbbogens schreiben wir dem Töpfer
auch die rein ornamental dekorierten Gefässe mit Zonenteilung und Rankendekoration zu
wie Tn/. 7 7%. 22. 29. 24. 26. 96. 97. 7h/. 77 7<7g. 7 (mit anderen Schüsseln im Brande
zusammengebacken); ferner Sammlung Niessenil Taf. LXVI Fig. s; ORL 2a Niederberg
Taf. IV Fig. 17; ORL 8 Zugmantel Taf. XXIII Fig. 2; Knorr, Cannstatt Taf. IX Fig. 4 u. a. m.
An Eierstäben verwendet Ailbillus am häufigsten den Eierstab mit seilartig gedrehtem
und glattem Stab und Stern (119. 120), ferner den Eierstab mit der dreigeteilten Quaste
(121), und einen breiten Eierstab ohne Stab (123). An Stelle des Eierstabs kommen auch
Spiralen, Halbbögen, Dreiblätter und das griechische Kreuz vor.
So ist der Töpfer, von dem wir bis vor kurzem nur glatte Ware kannten, mit
einem Schlage in den Mittelpunkt der Reliefsigillata von La Madeleine gerückt.
Hinsichtlich der Herkunft seiner Typen und seines Stils lässt sich festsfelien, dass
Albillus ganz unzweideutig starke mittelgallische Einflüsse in sich aufgenommen hat. Z. B.
stammt der aus Korb, Delphinen und Maske zusammengesetzte Vertikalfries (80) aus Lezoux
und wird dort in gleicher oder ähnlicher Anordnung von Servus D. 1069 und 1069a, Paulus
Grivaud Taf. XIII Fig. 4 und Cinnamus Walters, Catalogue 47 1604 S. 301 Fig. 221 ver-
wendet. Auch die Athena (30), der Herkules ORL 2a Niederberg Taf. IV Fig. 9, der
sitzende Apollo (Oelmann S. 91), die Amoretten (35. 36), der kleine nackte Knabe (49), der
Vierfüssler (57), der Vogel (61), das Blatt (90), die Amphora und andere Typen mehr sind
aus Lezoux entlehnt (vgl. D. 78. 452. S. 194, 9. 251. 255 bis. 395. 129. 810. 1035. 1173.
1072). Hingegen lassen sich so in die Augen fallende Typen wie das Dreibein (85) und das
griechische Kreuz (84) dort nicht nachweisen. Ausser den nahen Beziehungen zu Lezoux
finden sich bei Albillus aber auch Anklänge an La Graufesenque und Luxeuil. Die fein-
ästigen Bäume, die Andeutung des Erdreichs durch Grasbüschel und der Vierfüssler (57)
sind aus La Graufesenque, die Schildpyramide (?) (67), die Spiralranke von Ta/. 7 F7g. 25
(vgl. dazu 7h/. 7 77g. 12), der Merkur mit dem Caduceus von Ta/. 77 Fig. 21 (vgl. ORL 4
Ems Taf. II Fig. 3), der Krieger auf Ta/'. 77 Fig. 29 links (vgl. Walters, Catalogue 47 7994
S. 252 Fig. 202) von dem Meister mit den Schilden und Helmen aus Luxeuil bekannt.
Das Füllhorn (93) des Albillus erinnert an das des Ranto (10), ist jedoch bedeutend gröber
und es fehlen die bekrönenden Blätter. Die so häufig von ihm verwendete Teilung des
Bildfeldes in mehrere horizontale Zonen ist eine Reminiszenz des Übergangsstils der
Form Dr. 29 zu 37, einer Dekorationsweise, die in La Graufesenque geschaffen wurde.
Jedoch Technik und Stil der Ware des Albillus, gemessen an den guten Erzeugnissen
von La Graufesenque oder selbst an den besten von Luxeuil, halten den Vergleich mit jenen
nicht aus. Die Typen des Albillus sind viel gröber geschnitten, der Firnis ist zum Teil matt
und ziegelrot, der Rand bisweilen hoch und wenig sorgfältig profiliert. Technisch stehen seine