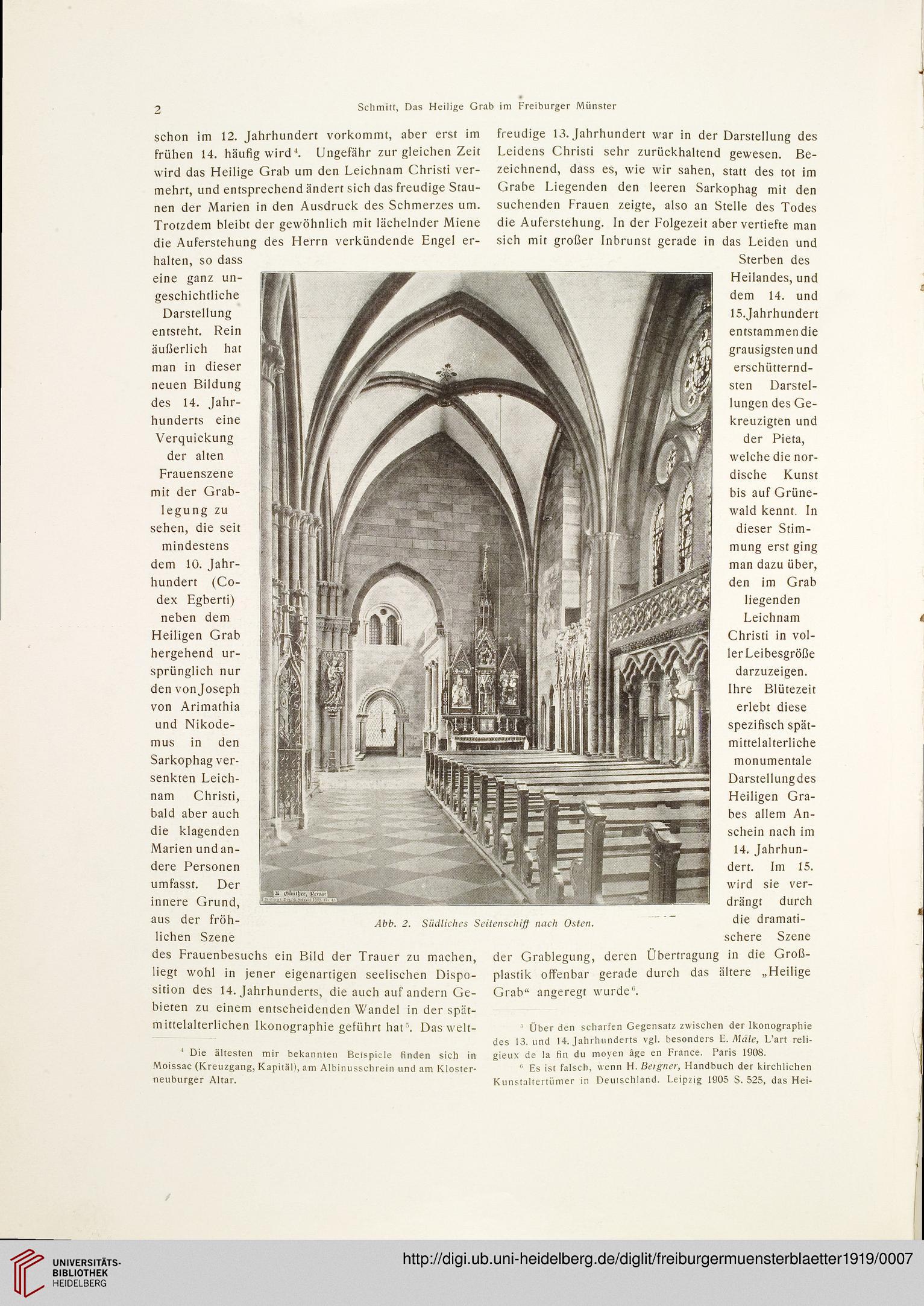Schmitt, Das Heilige Grab im Freiburger Münster
schon im 12. Jahrhundert vorkommt, aber erst im freudige 13. Jahrhundert war in der Darstellung des
frühen 14. häufig wird4. Ungefähr zur gleichen Zeit Leidens Christi sehr zurückhaltend gewesen. Be-
wird das Heilige Grab um den Leichnam Christi ver- zeichnend, dass es, wie wir sahen, statt des tot im
mehrt, und entsprechend ändert sich das freudige Stau- Grabe Liegenden den leeren Sarkophag mit den
nen der Marien in den Ausdruck des Schmerzes um. suchenden Frauen zeigte, also an Stelle des Todes
Trotzdem bleibt der gewöhnlich mit lächelnder Miene die Auferstehung. In der Folgezeit aber vertiefte man
die Auferstehung des Herrn verkündende Engel er- sich mit großer Inbrunst gerade in das Leiden und
halten, so dass
eine ganz un-
geschichtliche
Darstellung
entsteht. Rein
äußerlich hat
man in dieser
neuen Bildung
des 14. Jahr-
hunderts eine
Verquickung
der alten
Frauenszene
mit der Grab-
legung zu
sehen, die seit
mindestens
dem lö. Jahr-
hundert (Co-
dex Egberti)
neben dem
Heiligen Grab
hergehend ur-
sprünglich nur
den von Joseph
von Arimathia
und Nikode-
mus in den
Sarkophag ver-
senkten Leich-
nam Christi,
bald aber auch
die klagenden
Marien undan-
dere Personen
umfasst. Der
innere Grund,
aus der fröh-
lichen Szene
Abb. 2. Südliches Seitenschiff nach Osten.
Sterben des
Heilandes, und
dem 14. und
15.Jahrhundert
entstammen die
grausigsten und
erschütternd-
sten Darstel-
lungen des Ge-
kreuzigten und
der Pieta,
welche die nor-
dische Kunst
bis auf Grüne-
wald kennt. In
dieser Stim-
mung erst ging
man dazu über,
den im Grab
liegenden
Leichnam
Christi in vol-
ler Leibesgröße
darzuzeigen.
Ihre Blütezeit
erlebt diese
spezifisch spät-
mittelalterliche
monumentale
Darstellungdes
Heiligen Gra-
bes allem An-
schein nach im
14. Jahrhun-
dert. Im 15.
wird sie ver-
drängt durch
die dramati-
schere Szene
des Frauenbesuchs ein Bild der Trauer zu machen, der Grablegung, deren Übertragung in die Groß-
liegt wohl in jener eigenartigen seelischen Dispo-
sition des 14. Jahrhunderts, die auch auf andern Ge-
bieten zu einem entscheidenden Wandel in der spät-
mittelalterlichen Ikonographie geführt hat5. Das welt-
4 Die ältesten mir bekannten Beispiele finden sich in
Moissac (Kreuzgang, Kapital), am Albinusschrein und am Kloster-
neuburger Altar.
plastik offenbar gerade durch das ältere „Heilige
Grab" angeregt wurde".
' Über den scharfen Gegensatz zwischen der Ikonographie
des 13. und 14. Jahrhunderts vgl. besonders E. Male, L'art reli-
gieux de la fin du moyen Ige en France. Paris 1908.
6 Es ist falsch, wenn H. Bergner, Handbuch der kirchlichen
Kunstaltertümer in Deuischland. Leipzig 1905 S. 525, das Hei-
schon im 12. Jahrhundert vorkommt, aber erst im freudige 13. Jahrhundert war in der Darstellung des
frühen 14. häufig wird4. Ungefähr zur gleichen Zeit Leidens Christi sehr zurückhaltend gewesen. Be-
wird das Heilige Grab um den Leichnam Christi ver- zeichnend, dass es, wie wir sahen, statt des tot im
mehrt, und entsprechend ändert sich das freudige Stau- Grabe Liegenden den leeren Sarkophag mit den
nen der Marien in den Ausdruck des Schmerzes um. suchenden Frauen zeigte, also an Stelle des Todes
Trotzdem bleibt der gewöhnlich mit lächelnder Miene die Auferstehung. In der Folgezeit aber vertiefte man
die Auferstehung des Herrn verkündende Engel er- sich mit großer Inbrunst gerade in das Leiden und
halten, so dass
eine ganz un-
geschichtliche
Darstellung
entsteht. Rein
äußerlich hat
man in dieser
neuen Bildung
des 14. Jahr-
hunderts eine
Verquickung
der alten
Frauenszene
mit der Grab-
legung zu
sehen, die seit
mindestens
dem lö. Jahr-
hundert (Co-
dex Egberti)
neben dem
Heiligen Grab
hergehend ur-
sprünglich nur
den von Joseph
von Arimathia
und Nikode-
mus in den
Sarkophag ver-
senkten Leich-
nam Christi,
bald aber auch
die klagenden
Marien undan-
dere Personen
umfasst. Der
innere Grund,
aus der fröh-
lichen Szene
Abb. 2. Südliches Seitenschiff nach Osten.
Sterben des
Heilandes, und
dem 14. und
15.Jahrhundert
entstammen die
grausigsten und
erschütternd-
sten Darstel-
lungen des Ge-
kreuzigten und
der Pieta,
welche die nor-
dische Kunst
bis auf Grüne-
wald kennt. In
dieser Stim-
mung erst ging
man dazu über,
den im Grab
liegenden
Leichnam
Christi in vol-
ler Leibesgröße
darzuzeigen.
Ihre Blütezeit
erlebt diese
spezifisch spät-
mittelalterliche
monumentale
Darstellungdes
Heiligen Gra-
bes allem An-
schein nach im
14. Jahrhun-
dert. Im 15.
wird sie ver-
drängt durch
die dramati-
schere Szene
des Frauenbesuchs ein Bild der Trauer zu machen, der Grablegung, deren Übertragung in die Groß-
liegt wohl in jener eigenartigen seelischen Dispo-
sition des 14. Jahrhunderts, die auch auf andern Ge-
bieten zu einem entscheidenden Wandel in der spät-
mittelalterlichen Ikonographie geführt hat5. Das welt-
4 Die ältesten mir bekannten Beispiele finden sich in
Moissac (Kreuzgang, Kapital), am Albinusschrein und am Kloster-
neuburger Altar.
plastik offenbar gerade durch das ältere „Heilige
Grab" angeregt wurde".
' Über den scharfen Gegensatz zwischen der Ikonographie
des 13. und 14. Jahrhunderts vgl. besonders E. Male, L'art reli-
gieux de la fin du moyen Ige en France. Paris 1908.
6 Es ist falsch, wenn H. Bergner, Handbuch der kirchlichen
Kunstaltertümer in Deuischland. Leipzig 1905 S. 525, das Hei-