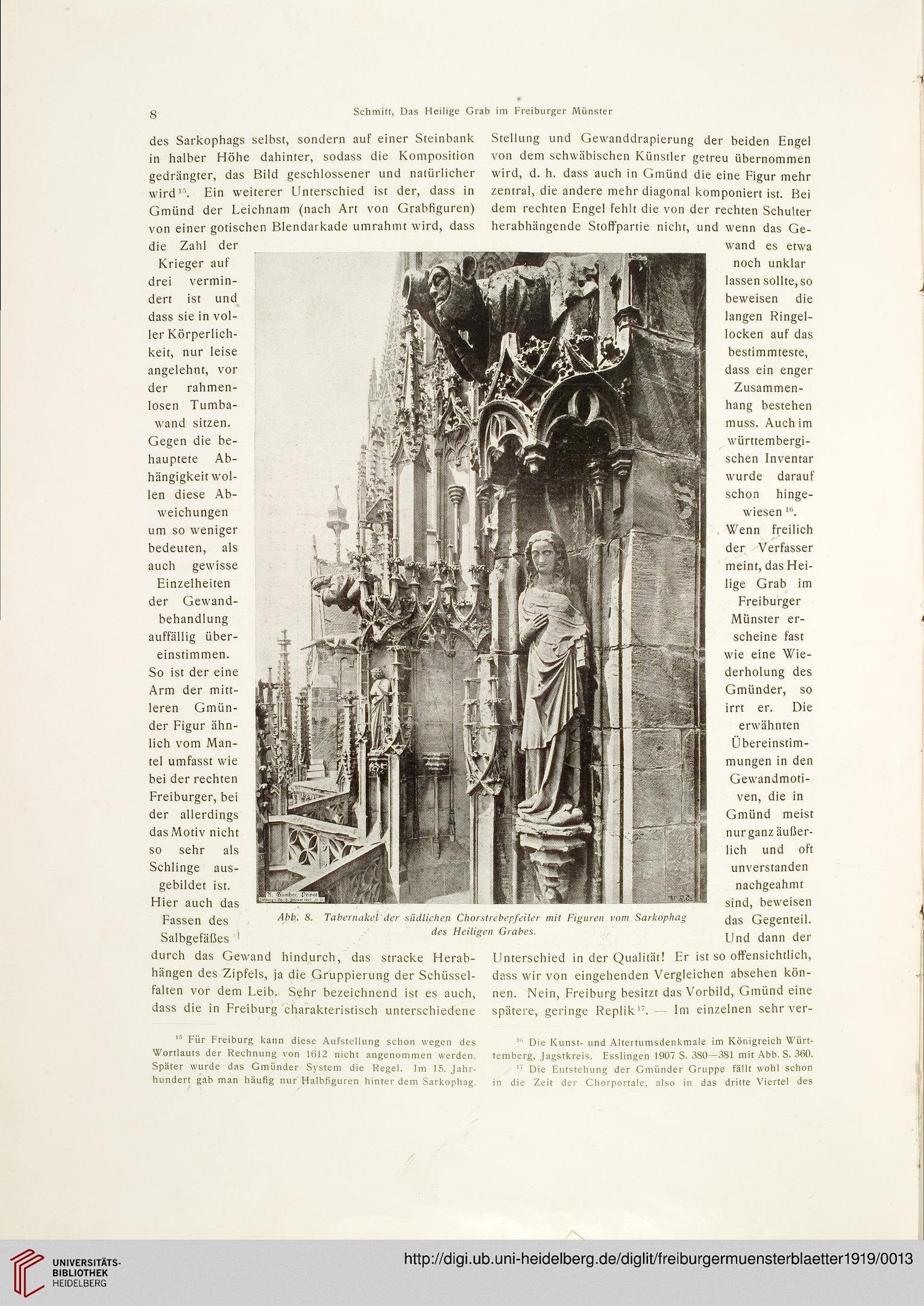s
Schmitt, Das Heilige Grab im Freiburger Münster
des Sarkophags selbst, sondern auf einer Steinbank Stellung und Gewanddrapierung der beiden Engel
in halber Höhe dahinter, sodass die Komposition von dem schwäbischen Künstler getreu übernommen
gedrängter, das Bild geschlossener und natürlicher wird, d. h. dass auch in Gmünd die eine Figur mehr
■wird15. Ein weiterer Unterschied ist der, dass in zentral, die andere mehr diagonal komponiert ist. Bei
Gmünd der Leichnam (nach Art von Grabfiguren) dem rechten Engel fehlt die von der rechten Schulter
von einer gotischen Blendarkade umrahmt wird, dass herabhängende Stoffpartie nicht, und wenn das Ge-
wand es etwa
noch unklar
lassen sollte, so
beweisen die
langen Ringel-
locken auf das
bestimmteste,
dass ein enger
Zusammen-
hang bestehen
muss. Auch im
württembergi-
schen Inventar
wurde darauf
schon hinge-
wiesen 16.
Wenn freilich
der Verfasser
meint, das Hei-
lige Grab im
Freiburger
Münster er-
scheine fast
wie eine Wie-
derholung des
Gmünder, so
irrt er. Die
erwähnten
Übereinstim-
mungen in den
Gewandmoti-
ven, die in
Gmünd meist
nur ganz äußer-
lich und oft
unverstanden
nachgeahmt
sind, beweisen
das Gegenteil.
Und dann der
durch das Gewand hindurch, das stracke Herab- Unterschied in der Qualität! Er ist so offensichtlich,
hängen des Zipfels, ja die Gruppierung der Schüssel- dass wir von eingehenden Vergleichen absehen kön-
falten vor dem Leib. Sehr bezeichnend ist es auch, nen. Nein, Freiburg besitzt das Vorbild, Gmünd eine
dass die in Freiburg charakteristisch unterschiedene spätere, geringe Replik17. — Im einzelnen sehr ver-
die Zahl der
Krieger auf
drei vermin-
dert ist und
dass sie in vol-
ler Körperlich-
keit, nur leise
angelehnt, vor
der rahmen-
losen Tumba-
wand sitzen.
Gegen die be-
hauptete Ab-
hängigkeitwol-
len diese Ab-
weichungen
um so weniger
bedeuten, als
auch gewisse
Einzelheiten
der Gewand-
behandlung
auffällig über-
einstimmen.
So ist der eine
Arm der mitt-
leren Gmün-
der Figur ähn-
lich vom Man-
tel umfasst wie
bei der rechten
Freiburger, bei
der allerdings
das Motiv nicht
so sehr als
Schlinge aus-
gebildet ist.
Hier auch das
Fassen des
Salbgefäßes '
Abb. 8.
Tabernakel der südlichen Chorstrebepfeiler mit Figuren vom Sarkophag
des Heiligen Grabes.
ls Für Freiburg kann diese Aufstellung schon wegen des "' Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Königreich Würt
Wortlauts der Rechnung von 1612 nicht angenommen werden. temberg, Jagstkreis. Esslingen 1907 S. 380—381 mit Abb. S. 360.
Später wurde das Gmünder System die Regel. Im 15. Jahr
hundert gab man häufig nur Halbfiguren hinter dem Sarkophag
17 Die Entstehung der Gmünder Gruppe fällt wohl schon
in die Zeit der Chorportale, also in das dritte Viertel des
Schmitt, Das Heilige Grab im Freiburger Münster
des Sarkophags selbst, sondern auf einer Steinbank Stellung und Gewanddrapierung der beiden Engel
in halber Höhe dahinter, sodass die Komposition von dem schwäbischen Künstler getreu übernommen
gedrängter, das Bild geschlossener und natürlicher wird, d. h. dass auch in Gmünd die eine Figur mehr
■wird15. Ein weiterer Unterschied ist der, dass in zentral, die andere mehr diagonal komponiert ist. Bei
Gmünd der Leichnam (nach Art von Grabfiguren) dem rechten Engel fehlt die von der rechten Schulter
von einer gotischen Blendarkade umrahmt wird, dass herabhängende Stoffpartie nicht, und wenn das Ge-
wand es etwa
noch unklar
lassen sollte, so
beweisen die
langen Ringel-
locken auf das
bestimmteste,
dass ein enger
Zusammen-
hang bestehen
muss. Auch im
württembergi-
schen Inventar
wurde darauf
schon hinge-
wiesen 16.
Wenn freilich
der Verfasser
meint, das Hei-
lige Grab im
Freiburger
Münster er-
scheine fast
wie eine Wie-
derholung des
Gmünder, so
irrt er. Die
erwähnten
Übereinstim-
mungen in den
Gewandmoti-
ven, die in
Gmünd meist
nur ganz äußer-
lich und oft
unverstanden
nachgeahmt
sind, beweisen
das Gegenteil.
Und dann der
durch das Gewand hindurch, das stracke Herab- Unterschied in der Qualität! Er ist so offensichtlich,
hängen des Zipfels, ja die Gruppierung der Schüssel- dass wir von eingehenden Vergleichen absehen kön-
falten vor dem Leib. Sehr bezeichnend ist es auch, nen. Nein, Freiburg besitzt das Vorbild, Gmünd eine
dass die in Freiburg charakteristisch unterschiedene spätere, geringe Replik17. — Im einzelnen sehr ver-
die Zahl der
Krieger auf
drei vermin-
dert ist und
dass sie in vol-
ler Körperlich-
keit, nur leise
angelehnt, vor
der rahmen-
losen Tumba-
wand sitzen.
Gegen die be-
hauptete Ab-
hängigkeitwol-
len diese Ab-
weichungen
um so weniger
bedeuten, als
auch gewisse
Einzelheiten
der Gewand-
behandlung
auffällig über-
einstimmen.
So ist der eine
Arm der mitt-
leren Gmün-
der Figur ähn-
lich vom Man-
tel umfasst wie
bei der rechten
Freiburger, bei
der allerdings
das Motiv nicht
so sehr als
Schlinge aus-
gebildet ist.
Hier auch das
Fassen des
Salbgefäßes '
Abb. 8.
Tabernakel der südlichen Chorstrebepfeiler mit Figuren vom Sarkophag
des Heiligen Grabes.
ls Für Freiburg kann diese Aufstellung schon wegen des "' Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Königreich Würt
Wortlauts der Rechnung von 1612 nicht angenommen werden. temberg, Jagstkreis. Esslingen 1907 S. 380—381 mit Abb. S. 360.
Später wurde das Gmünder System die Regel. Im 15. Jahr
hundert gab man häufig nur Halbfiguren hinter dem Sarkophag
17 Die Entstehung der Gmünder Gruppe fällt wohl schon
in die Zeit der Chorportale, also in das dritte Viertel des