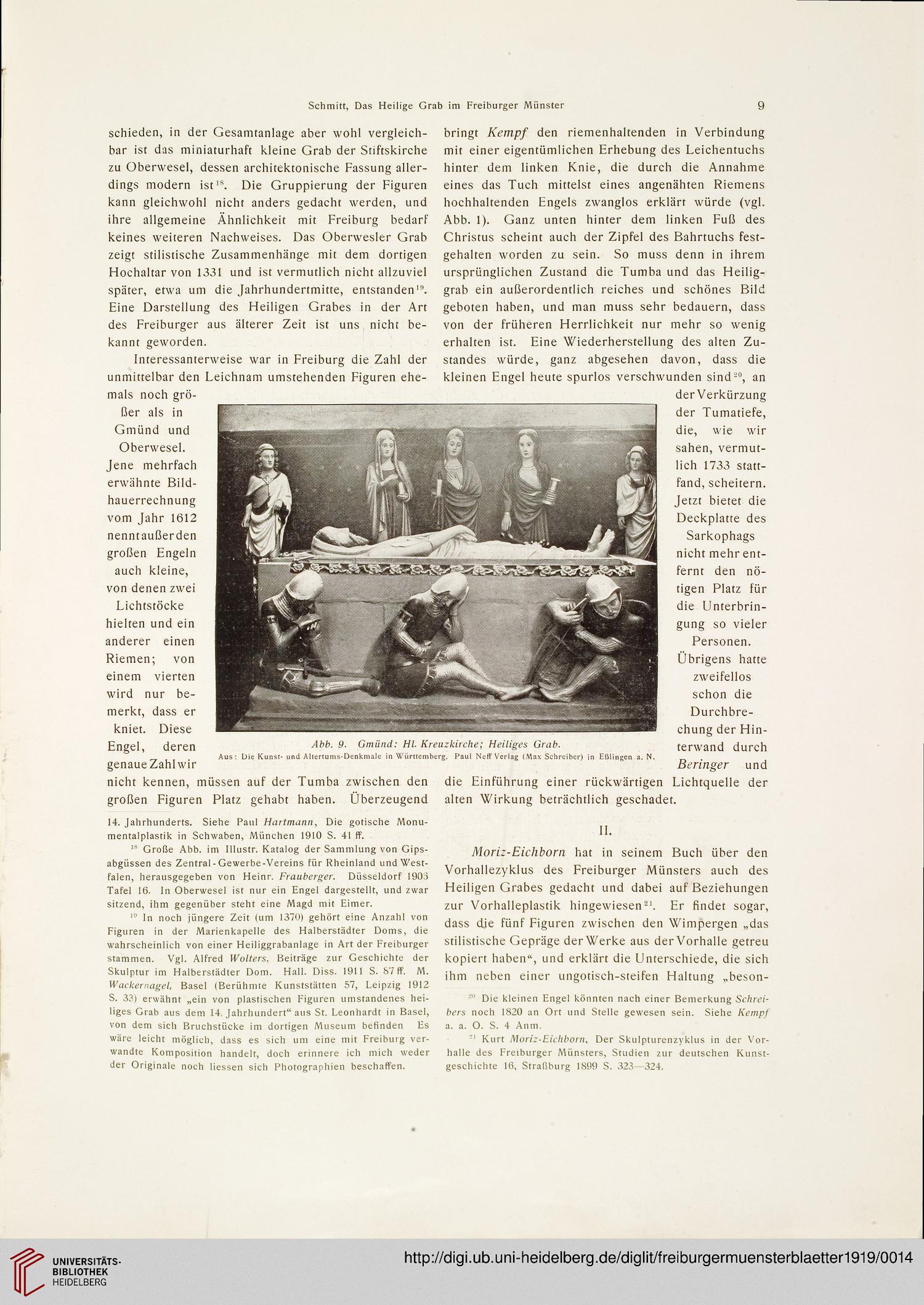Schmitt, Das Heilige Grab im Freiburger Münster
9
schieden, in der Gesamtanlage aber wohl vergleich-
bar ist das miniaturhaft kleine Grab der Stiftskirche
zu Oberwesel, dessen architektonische Fassung aller-
dings modern istis. Die Gruppierung der Figuren
kann gleichwohl nicht anders gedacht werden, und
ihre allgemeine Ähnlichkeit mit Freiburg bedarf
keines weiteren Nachweises. Das Oberwesler Grab
zeigt stilistische Zusammenhänge mit dem dortigen
Hochaltar von 1331 und ist vermutlich nicht allzuviel
später, etwa um die Jahrhundertmitte, entstanden19.
Eine Darstellung des Heiligen Grabes in der Art
des Freiburger aus älterer Zeit ist uns nicht be-
kannt geworden.
Interessanterweise war in Freiburg die Zahl der
unmittelbar den Leichnam umstehenden Figuren ehe-
mals noch grö-
ßer als in
Gmünd und
Oberwesel.
Jene mehrfach
erwähnte Bild-
hauerrechnung
vom Jahr 1612
nenntaußerden
großen Engeln
auch kleine,
von denen zwei
Lichtstöcke
hielten und ein
anderer einen
Riemen; von
einem vierten
wird nur be-
merkt, dass er
kniet. Diese
Engel, deren
genaue Zahl wir
nicht kennen, müssen auf der Tumba zwischen den
großen Figuren Platz gehabt haben. Überzeugend
14. Jahrhunderts. Siehe Paul Hartmann, Die gotische Monu-
mentalplastik in Schwaben, München 1910 S. 41 ff.
18 Große Abb. im Illustr. Katalog der Sammlung von Gips-
abgüssen des Zentral-Gewerbe-Vereins für Rheinland und West-
falen, herausgegeben von Heinr. Frauberger. Düsseldorf 1903
Tafel 16. In Oberwesel ist nur ein Engel dargestellt, und zwar
sitzend, ihm gegenüber steht eine Magd mit Eimer.
111 In noch jüngere Zeit (um 1370) gehört eine Anzahl von
Figuren in der Marienkapelle des Halberstädter Doms, die
wahrscheinlich von einer Heiliggrabanlage in Art der Freiburger
stammen. Vgl. Alfred Wolters, Beiträge zur Geschichte der
Skulptur im Halberstädter Dom. Hall. Diss. 1911 S. 87 ff. M.
Wackernagel, Basel (Berühmte Kunststätten 57, Leipzig 1912
S. 33) erwähnt „ein von plastischen Figuren umstandenes hei-
liges Grab aus dem 14. Jahrhundert" aus St. Leonhardt in Basel,
von dem sich Bruchstücke im dortigen Museum befinden Es
wäre leicht möglich, dass es sich um eine mit Freiburg ver-
wandte Komposition handelt, doch erinnere ich mich weder
der Originale noch Hessen sich Photographien beschaffen.
Abb. 9. Gmünd: Hl. Kreuzkirche; Heiliges Grab.
Aus: Die Kunst- und Altertums-Denkmale in Württemberg. Paul Neff Verlag (Max Schreiber) in Eßlingen a. N.
bringt Kempf den riemenhaltenden in Verbindung
mit einer eigentümlichen Erhebung des Leichentuchs
hinter dem linken Knie, die durch die Annahme
eines das Tuch mittelst eines angenähten Riemens
hochhaltenden Engels zwanglos erklärt würde (vgl.
Abb. 1). Ganz unten hinter dem linken Fuß des
Christus scheint auch der Zipfel des Bahrtuchs fest-
gehalten worden zu sein. So muss denn in ihrem
ursprünglichen Zustand die Tumba und das Heilig-
grab ein außerordentlich reiches und schönes Bild
geboten haben, und man muss sehr bedauern, dass
von der früheren Herrlichkeit nur mehr so wenig
erhalten ist. Eine Wiederherstellung des alten Zu-
standes würde, ganz abgesehen davon, dass die
kleinen Engel heute spurlos verschwunden sind-0, an
der Verkürzung
der Tumatiefe,
die, wie wir
sahen, vermut-
lich 1733 statt-
fand, scheitern.
Jetzt bietet die
Deckplatte des
Sarkophags
nicht mehr ent-
fernt den nö-
tigen Platz für
die Unterbrin-
gung so vieler
Personen.
Übrigens hatte
zweifellos
schon die
Durchbre-
chung der Hin-
terwand durch
Beringer und
die Einführung einer rückwärtigen Lichtquelle der
alten Wirkung beträchtlich geschadet.
II.
Moriz-Eichborn hat in seinem Buch über den
Vorhallezyklus des Freiburger Münsters auch des
Heiligen Grabes gedacht und dabei auf Beziehungen
zur Vorhalleplastik hingewiesen21. Er findet sogar,
dass dje fünf Figuren zwischen den Wimpergen „das
stilistische Gepräge der Werke aus der Vorhalle getreu
kopiert haben", und erklärt die Unterschiede, die sich
ihm neben einer ungotisch-steifen Haltung „beson-
-'" Die kleinen Engel könnten nach einer Bemerkung Schrei-
bers noch 1820 an Ort und Stelle gewesen sein. Siehe Kempf
a. a. O. S. 4 Anm.
'-' Kurt Moriz-Eichborn, Der Skulpturenzyklus in der Vor-
halle des Freiburger Münsters, Studien zur deutschen Kunst-
geschichte 16, Straßburg 1899 S. 323—324.
9
schieden, in der Gesamtanlage aber wohl vergleich-
bar ist das miniaturhaft kleine Grab der Stiftskirche
zu Oberwesel, dessen architektonische Fassung aller-
dings modern istis. Die Gruppierung der Figuren
kann gleichwohl nicht anders gedacht werden, und
ihre allgemeine Ähnlichkeit mit Freiburg bedarf
keines weiteren Nachweises. Das Oberwesler Grab
zeigt stilistische Zusammenhänge mit dem dortigen
Hochaltar von 1331 und ist vermutlich nicht allzuviel
später, etwa um die Jahrhundertmitte, entstanden19.
Eine Darstellung des Heiligen Grabes in der Art
des Freiburger aus älterer Zeit ist uns nicht be-
kannt geworden.
Interessanterweise war in Freiburg die Zahl der
unmittelbar den Leichnam umstehenden Figuren ehe-
mals noch grö-
ßer als in
Gmünd und
Oberwesel.
Jene mehrfach
erwähnte Bild-
hauerrechnung
vom Jahr 1612
nenntaußerden
großen Engeln
auch kleine,
von denen zwei
Lichtstöcke
hielten und ein
anderer einen
Riemen; von
einem vierten
wird nur be-
merkt, dass er
kniet. Diese
Engel, deren
genaue Zahl wir
nicht kennen, müssen auf der Tumba zwischen den
großen Figuren Platz gehabt haben. Überzeugend
14. Jahrhunderts. Siehe Paul Hartmann, Die gotische Monu-
mentalplastik in Schwaben, München 1910 S. 41 ff.
18 Große Abb. im Illustr. Katalog der Sammlung von Gips-
abgüssen des Zentral-Gewerbe-Vereins für Rheinland und West-
falen, herausgegeben von Heinr. Frauberger. Düsseldorf 1903
Tafel 16. In Oberwesel ist nur ein Engel dargestellt, und zwar
sitzend, ihm gegenüber steht eine Magd mit Eimer.
111 In noch jüngere Zeit (um 1370) gehört eine Anzahl von
Figuren in der Marienkapelle des Halberstädter Doms, die
wahrscheinlich von einer Heiliggrabanlage in Art der Freiburger
stammen. Vgl. Alfred Wolters, Beiträge zur Geschichte der
Skulptur im Halberstädter Dom. Hall. Diss. 1911 S. 87 ff. M.
Wackernagel, Basel (Berühmte Kunststätten 57, Leipzig 1912
S. 33) erwähnt „ein von plastischen Figuren umstandenes hei-
liges Grab aus dem 14. Jahrhundert" aus St. Leonhardt in Basel,
von dem sich Bruchstücke im dortigen Museum befinden Es
wäre leicht möglich, dass es sich um eine mit Freiburg ver-
wandte Komposition handelt, doch erinnere ich mich weder
der Originale noch Hessen sich Photographien beschaffen.
Abb. 9. Gmünd: Hl. Kreuzkirche; Heiliges Grab.
Aus: Die Kunst- und Altertums-Denkmale in Württemberg. Paul Neff Verlag (Max Schreiber) in Eßlingen a. N.
bringt Kempf den riemenhaltenden in Verbindung
mit einer eigentümlichen Erhebung des Leichentuchs
hinter dem linken Knie, die durch die Annahme
eines das Tuch mittelst eines angenähten Riemens
hochhaltenden Engels zwanglos erklärt würde (vgl.
Abb. 1). Ganz unten hinter dem linken Fuß des
Christus scheint auch der Zipfel des Bahrtuchs fest-
gehalten worden zu sein. So muss denn in ihrem
ursprünglichen Zustand die Tumba und das Heilig-
grab ein außerordentlich reiches und schönes Bild
geboten haben, und man muss sehr bedauern, dass
von der früheren Herrlichkeit nur mehr so wenig
erhalten ist. Eine Wiederherstellung des alten Zu-
standes würde, ganz abgesehen davon, dass die
kleinen Engel heute spurlos verschwunden sind-0, an
der Verkürzung
der Tumatiefe,
die, wie wir
sahen, vermut-
lich 1733 statt-
fand, scheitern.
Jetzt bietet die
Deckplatte des
Sarkophags
nicht mehr ent-
fernt den nö-
tigen Platz für
die Unterbrin-
gung so vieler
Personen.
Übrigens hatte
zweifellos
schon die
Durchbre-
chung der Hin-
terwand durch
Beringer und
die Einführung einer rückwärtigen Lichtquelle der
alten Wirkung beträchtlich geschadet.
II.
Moriz-Eichborn hat in seinem Buch über den
Vorhallezyklus des Freiburger Münsters auch des
Heiligen Grabes gedacht und dabei auf Beziehungen
zur Vorhalleplastik hingewiesen21. Er findet sogar,
dass dje fünf Figuren zwischen den Wimpergen „das
stilistische Gepräge der Werke aus der Vorhalle getreu
kopiert haben", und erklärt die Unterschiede, die sich
ihm neben einer ungotisch-steifen Haltung „beson-
-'" Die kleinen Engel könnten nach einer Bemerkung Schrei-
bers noch 1820 an Ort und Stelle gewesen sein. Siehe Kempf
a. a. O. S. 4 Anm.
'-' Kurt Moriz-Eichborn, Der Skulpturenzyklus in der Vor-
halle des Freiburger Münsters, Studien zur deutschen Kunst-
geschichte 16, Straßburg 1899 S. 323—324.