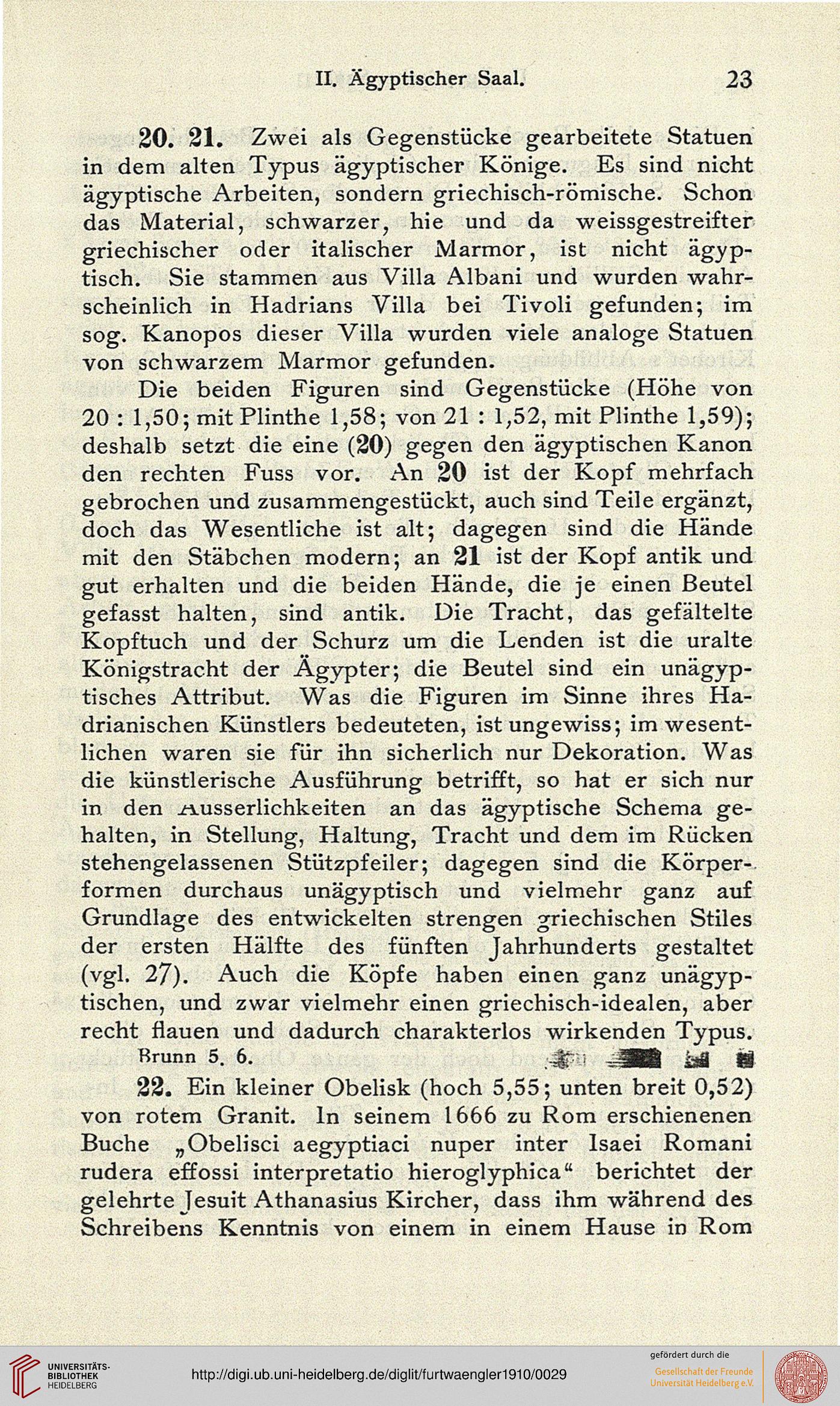II. Ägyptischer Saal. 23
20. 21. Zwei als Gegenstücke gearbeitete Statuen
in dem alten Typus ägyptischer Könige. Es sind nicht
ägyptische Arbeiten, sondern griechisch-römische. Schon
das Material, schwarzer, hie und da weissgestreifter
griechischer oder italischer Marmor, ist nicht ägyp-
tisch. Sie stammen aus Villa Albani und wurden wahr-
scheinlich in Hadrians Villa bei Tivoli gefunden; im
sog. Kanopos dieser Villa wurden viele analoge Statuen
von schwarzem Marmor gefunden.
Die beiden Figuren sind Gegenstücke (Höhe von
20 : 1,50; mitPlinthe 1,58; von 21 : 1,52, mit Plinthe 1,59);
deshalb setzt die eine (20) gegen den ägyptischen Kanon
den rechten Fuss vor. An 20 ist der Kopf mehrfach
gebrochen und zusammengestückt, auch sind Teile ergänzt,
doch das Wesentliche ist alt; dagegen sind die Hände
mit den Stäbchen modern; an 21 ist der Kopf antik und
gut erhalten und die beiden Hände, die je einen Beutel
gefasst halten, sind antik. Die Tracht, das gefältelte
Kopftuch und der Schurz um die Lenden ist die uralte
Königstracht der Ägypter; die Beutel sind ein unägyp-
tisches Attribut. Was die Figuren im Sinne ihres Ha-
drianischen Künstlers bedeuteten, ist ungewiss; im wesent-
lichen waren sie für ihn sicherlich nur Dekoration. Was
die künstlerische Ausführung betrifft, so hat er sich nur
in den Ausserlichkeiten an das ägyptische Schema ge-
halten, in Stellung, Haltung, Tracht und dem im Rücken
stehengelassenen Stützpfeiler; dagegen sind die Körper-
formen durchaus unägyptisch und vielmehr ganz auf
Grundlage des entwickelten strengen griechischen Stiles
der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts gestaltet
(vgl. 27). Auch die Köpfe haben einen ganz unägyp-
tischen, und zwar vielmehr einen griechisch-idealen, aber
recht flauen und dadurch charakterlos wirkenden Typus.
Brunn 5. 6. .^jj .JSÜ isä M
22. Ein kleiner Obelisk (hoch 5,55; unten breit 0,52)
von rotem Granit. In seinem 1666 zu Rom erschienenen
Buche „Obelisci aegyptiaci nuper inter Isaei Romani
rudera effossi interpretatio hieroglyphica" berichtet der
gelehrte Jesuit Athanasius Kircher, dass ihm während des
Schreibens Kenntnis von einem in einem Hause in Rom
20. 21. Zwei als Gegenstücke gearbeitete Statuen
in dem alten Typus ägyptischer Könige. Es sind nicht
ägyptische Arbeiten, sondern griechisch-römische. Schon
das Material, schwarzer, hie und da weissgestreifter
griechischer oder italischer Marmor, ist nicht ägyp-
tisch. Sie stammen aus Villa Albani und wurden wahr-
scheinlich in Hadrians Villa bei Tivoli gefunden; im
sog. Kanopos dieser Villa wurden viele analoge Statuen
von schwarzem Marmor gefunden.
Die beiden Figuren sind Gegenstücke (Höhe von
20 : 1,50; mitPlinthe 1,58; von 21 : 1,52, mit Plinthe 1,59);
deshalb setzt die eine (20) gegen den ägyptischen Kanon
den rechten Fuss vor. An 20 ist der Kopf mehrfach
gebrochen und zusammengestückt, auch sind Teile ergänzt,
doch das Wesentliche ist alt; dagegen sind die Hände
mit den Stäbchen modern; an 21 ist der Kopf antik und
gut erhalten und die beiden Hände, die je einen Beutel
gefasst halten, sind antik. Die Tracht, das gefältelte
Kopftuch und der Schurz um die Lenden ist die uralte
Königstracht der Ägypter; die Beutel sind ein unägyp-
tisches Attribut. Was die Figuren im Sinne ihres Ha-
drianischen Künstlers bedeuteten, ist ungewiss; im wesent-
lichen waren sie für ihn sicherlich nur Dekoration. Was
die künstlerische Ausführung betrifft, so hat er sich nur
in den Ausserlichkeiten an das ägyptische Schema ge-
halten, in Stellung, Haltung, Tracht und dem im Rücken
stehengelassenen Stützpfeiler; dagegen sind die Körper-
formen durchaus unägyptisch und vielmehr ganz auf
Grundlage des entwickelten strengen griechischen Stiles
der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts gestaltet
(vgl. 27). Auch die Köpfe haben einen ganz unägyp-
tischen, und zwar vielmehr einen griechisch-idealen, aber
recht flauen und dadurch charakterlos wirkenden Typus.
Brunn 5. 6. .^jj .JSÜ isä M
22. Ein kleiner Obelisk (hoch 5,55; unten breit 0,52)
von rotem Granit. In seinem 1666 zu Rom erschienenen
Buche „Obelisci aegyptiaci nuper inter Isaei Romani
rudera effossi interpretatio hieroglyphica" berichtet der
gelehrte Jesuit Athanasius Kircher, dass ihm während des
Schreibens Kenntnis von einem in einem Hause in Rom