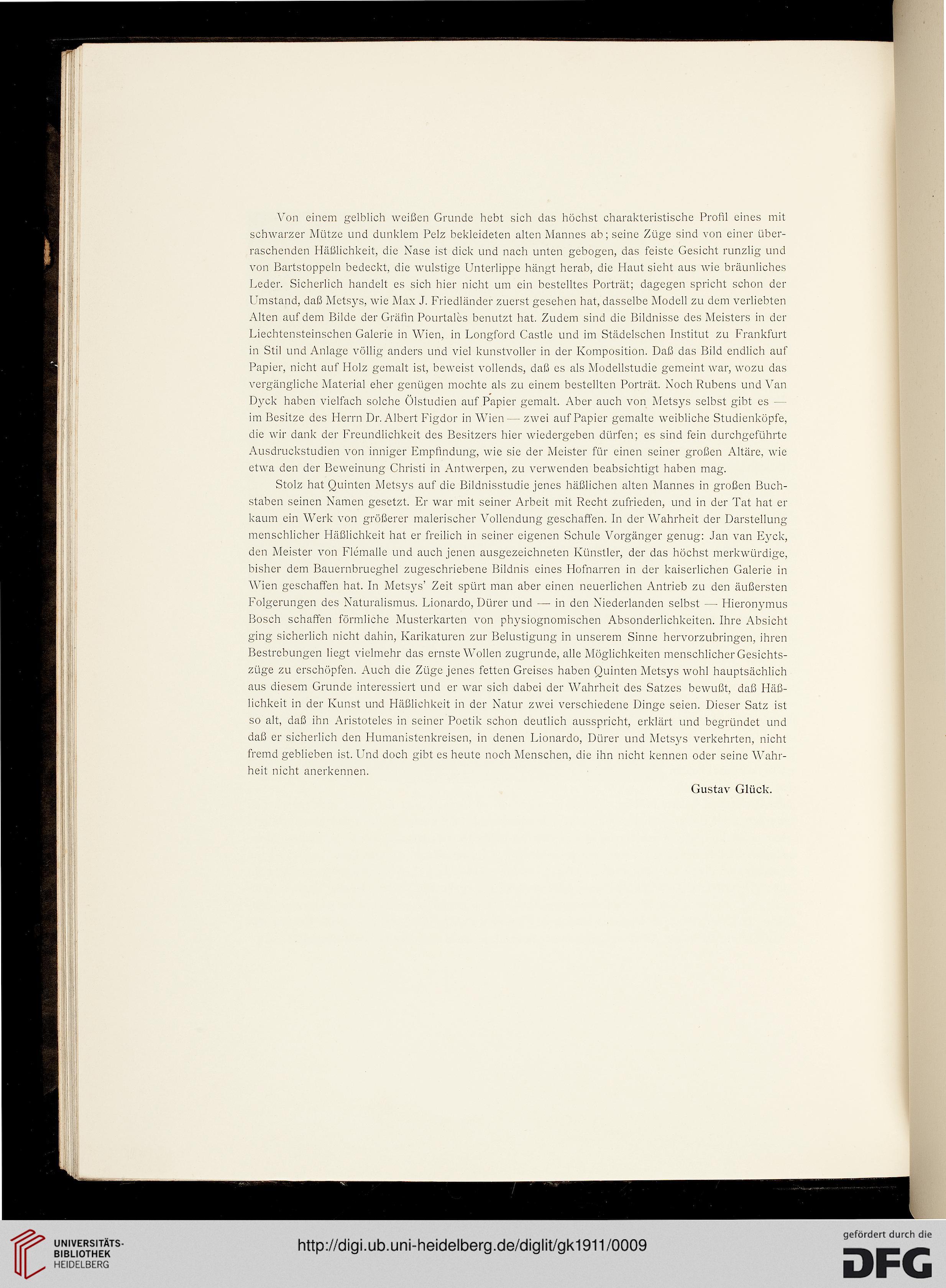Von einem gelblich weißen Grunde hebt sich das höchst charakteristische Profil eines mit
schwarzer Mütze und dunklem Pelz bekleideten alten Mannes ab; seine Züge sind von einer über-
raschenden Häßlichkeit, die Xase ist dick und nach unten gebogen, das feiste Gesicht runzlig und
von Bartstoppeln bedeckt, die wulstige Unterlippe hängt herab, die Haut sieht aus wie bräunliches
Leder. Sicherlich handelt es sich hier nicht um ein bestelltes Porträt; dagegen spricht schon der
Umstand, daß Metsys, wie Max J. Friedländer zuerst gesehen hat, dasselbe Modell zu dem verliebten
Alten auf dem Bilde der Gräfin Pourtales benutzt hat. Zudem sind die Bildnisse des Meisters in der
Liechtensteinschen Galerie in Wien, in Longford Castle und im Städelschen Institut zu Frankfurt
in Stil und Anlage völlig anders und viel kunstvoller in der Komposition. Daß das Bild endlich auf
Papier, nicht auf Holz gemalt ist, beweist vollends, daß es als Modellstudie gemeint war, wozu das
vergängliche Material eher genügen mochte als zu einem bestellten Porträt. Noch Rubens und Van
Dyck haben vielfach solche Ölstudien auf Papier gemalt. Aber auch von Metsys selbst gibt es -
im Besitze des Herrn Dr. Albert Figdor in Wien— zwei auf Papier gemalte weibliche Studienköpfe,
die wir dank der Freundlichkeit des Besitzers hier wiedergeben dürfen; es sind fein durchgeführte
Ausdruckstudien von inniger Fmpfindung, wie sie der Meister für einen seiner großen Altäre, wie
etwa den der Beweinung Christi in Antwerpen, zu verwenden beabsichtigt haben mag.
Stolz hat Quinten Metsys auf die Bildnisstudie jenes häßlichen alten Mannes in großen Buch-
staben seinen Namen gesetzt. Er war mit seiner Arbeit mit Recht zufrieden, und in der Tat hat er
kaum ein Werk von größerer malerischer Vollendung geschaffen. In der Wahrheit der Darstellung
menschlicher Häßlichkeit hat er freilich in seiner eigenen Schule Vorgänger genug: Jan van Eyck,
den Meister von Flemalle und auch jenen ausgezeichneten Künstler, der das höchst merkwürdige,
bisher dem Bauernbrueghel zugeschriebene Bildnis eines Hofnarren in der kaiserlichen Galerie in
Wien geschaffen hat. In Metsys' Zeit spürt man aber einen neuerlichen Antrieb zu den äußersten
Folgerungen des Naturalismus. Lionardo, Dürer und — in den Niederlanden selbst — Hieronymus
Bosch schaffen förmliche Musterkarten von physiognomischen Absonderlichkeiten. Ihre Absicht
ging sicherlich nicht dahin, Karikaturen zur Belustigung in unserem Sinne hervorzubringen, ihren
Bestrebungen liegt vielmehr das ernste Wollen zugrunde, alle Möglichkeiten menschlicher Gesichts-
züge zu erschöpfen. Auch die Züge jenes fetten Greises haben Quinten Metsys wohl hauptsächlich
aus diesem Grunde interessiert und er war sich dabei der Wahrheit des Satzes bewußt, daß Häß-
lichkeit in der Kunst und Häßlichkeit in der Natur zwei verschiedene Dinge seien. Dieser Satz ist
so alt, daß ihn Aristoteles in seiner Poetik schon deutlich ausspricht, erklärt und begründet und
daß er sicherlich den Humanistenkreisen, in denen Lionardo, Dürer und Metsys verkehrten, nicht
fremd geblieben ist. Und doch gibt es heute noch Menschen, die ihn nicht kennen oder seine Wahr-
heit nicht anerkennen.
Gustav Glück.
schwarzer Mütze und dunklem Pelz bekleideten alten Mannes ab; seine Züge sind von einer über-
raschenden Häßlichkeit, die Xase ist dick und nach unten gebogen, das feiste Gesicht runzlig und
von Bartstoppeln bedeckt, die wulstige Unterlippe hängt herab, die Haut sieht aus wie bräunliches
Leder. Sicherlich handelt es sich hier nicht um ein bestelltes Porträt; dagegen spricht schon der
Umstand, daß Metsys, wie Max J. Friedländer zuerst gesehen hat, dasselbe Modell zu dem verliebten
Alten auf dem Bilde der Gräfin Pourtales benutzt hat. Zudem sind die Bildnisse des Meisters in der
Liechtensteinschen Galerie in Wien, in Longford Castle und im Städelschen Institut zu Frankfurt
in Stil und Anlage völlig anders und viel kunstvoller in der Komposition. Daß das Bild endlich auf
Papier, nicht auf Holz gemalt ist, beweist vollends, daß es als Modellstudie gemeint war, wozu das
vergängliche Material eher genügen mochte als zu einem bestellten Porträt. Noch Rubens und Van
Dyck haben vielfach solche Ölstudien auf Papier gemalt. Aber auch von Metsys selbst gibt es -
im Besitze des Herrn Dr. Albert Figdor in Wien— zwei auf Papier gemalte weibliche Studienköpfe,
die wir dank der Freundlichkeit des Besitzers hier wiedergeben dürfen; es sind fein durchgeführte
Ausdruckstudien von inniger Fmpfindung, wie sie der Meister für einen seiner großen Altäre, wie
etwa den der Beweinung Christi in Antwerpen, zu verwenden beabsichtigt haben mag.
Stolz hat Quinten Metsys auf die Bildnisstudie jenes häßlichen alten Mannes in großen Buch-
staben seinen Namen gesetzt. Er war mit seiner Arbeit mit Recht zufrieden, und in der Tat hat er
kaum ein Werk von größerer malerischer Vollendung geschaffen. In der Wahrheit der Darstellung
menschlicher Häßlichkeit hat er freilich in seiner eigenen Schule Vorgänger genug: Jan van Eyck,
den Meister von Flemalle und auch jenen ausgezeichneten Künstler, der das höchst merkwürdige,
bisher dem Bauernbrueghel zugeschriebene Bildnis eines Hofnarren in der kaiserlichen Galerie in
Wien geschaffen hat. In Metsys' Zeit spürt man aber einen neuerlichen Antrieb zu den äußersten
Folgerungen des Naturalismus. Lionardo, Dürer und — in den Niederlanden selbst — Hieronymus
Bosch schaffen förmliche Musterkarten von physiognomischen Absonderlichkeiten. Ihre Absicht
ging sicherlich nicht dahin, Karikaturen zur Belustigung in unserem Sinne hervorzubringen, ihren
Bestrebungen liegt vielmehr das ernste Wollen zugrunde, alle Möglichkeiten menschlicher Gesichts-
züge zu erschöpfen. Auch die Züge jenes fetten Greises haben Quinten Metsys wohl hauptsächlich
aus diesem Grunde interessiert und er war sich dabei der Wahrheit des Satzes bewußt, daß Häß-
lichkeit in der Kunst und Häßlichkeit in der Natur zwei verschiedene Dinge seien. Dieser Satz ist
so alt, daß ihn Aristoteles in seiner Poetik schon deutlich ausspricht, erklärt und begründet und
daß er sicherlich den Humanistenkreisen, in denen Lionardo, Dürer und Metsys verkehrten, nicht
fremd geblieben ist. Und doch gibt es heute noch Menschen, die ihn nicht kennen oder seine Wahr-
heit nicht anerkennen.
Gustav Glück.