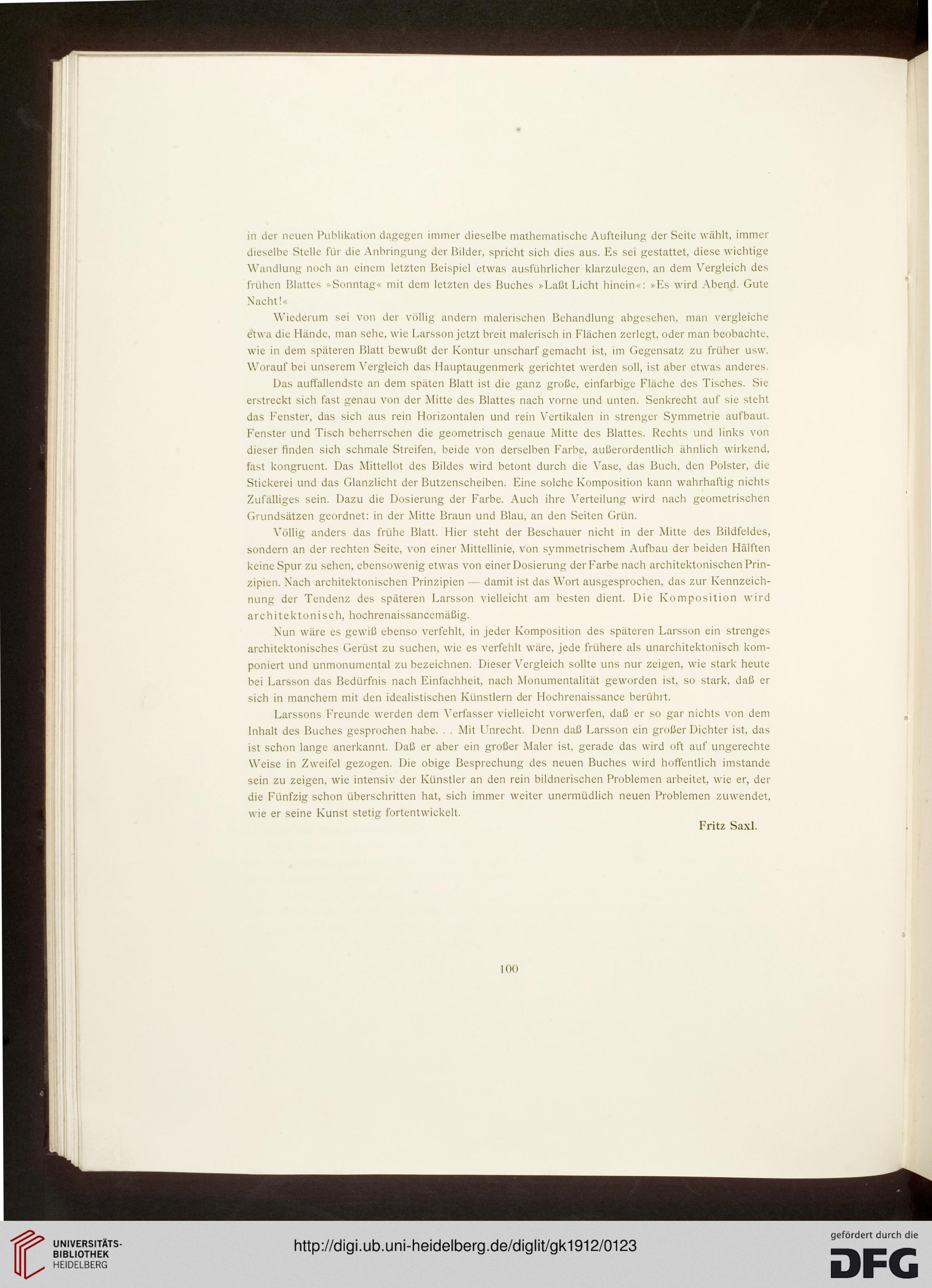in der neuen Publikation dagegen immer dieselbe mathematische Aufteilung der Seite wählt, immer
dieselbe Stelle für die Anbringung der Bilder, spricht sich dies aus. Es sei gestattet, diese wichtige
Wandlung noch an einem letzten Beispiel etwas ausführlicher klarzulegen, an dem Vergleich des
frühen Blattes »Sonntag« mit dem letzten des Buches »Laßt Licht hinein«: »Es wird Abend. Gute
Nacht!«
Wiederum sei von der völlig andern malerischen Behandlung abgesehen, man vergleiche
etwa die Hände, man sehe, wie Larsson jetzt breit malerisch in Flächen zerlegt, oder man beobachte,
wie in dem späteren Blatt bewußt der Kontur unscharf gemacht ist, im Gegensatz zu früher usw.
Worauf bei unserem Vergleich das Hauptaugenmerk gerichtet werden soll, ist aber etwas anderes.
Das auffallendste an dem späten Blatt ist die ganz große, einfarbige Fläche des Tisches. Sie
erstreckt sich fast genau von der Mitte des Blattes nach vorne und unten. Senkrecht auf sie steht
das Fenster, das sich aus rein Horizontalen und rein Vertikalen in strenger Symmetrie aufbaut.
Fenster und Tisch beherrschen die geometrisch genaue Mitte des Blattes. Rechts und links von
dieser finden sich schmale Streifen, beide von derselben Farbe, außerordentlich ähnlich wirkend,
fast kongruent. Das Mittellot des Bildes wird betont durch die Vase, das Buch, den Polster, die
Stickerei und das Glanzlicht der Butzenscheiben. Eine solche Komposition kann wahrhaftig nichts
Zufälliges sein. Dazu die Dosierung der Farbe. Auch ihre Verteilung wird nach geometrischen
Grundsätzen geordnet: in der Mitte Braun und Blau, an den Seiten Grün.
Völlig anders das frühe Blatt. Hier steht der Beschauer nicht in der Mitte des Bildfeldes,
sondern an der rechten Seite, von einer Mittellinie, von symmetrischem Aufbau der beiden Hälften
keine Spur zu sehen, ebensowenig etwas von einer Dosierung der Farbe nach architektonischen Prin-
zipien. Nach architektonischen Prinzipien — damit ist das Wort ausgesprochen, das zur Kennzeich-
nung der Tendenz des späteren Larsson vielleicht am besten dient. Die Komposition wird
arc h itekton i s ch, hochrenaissancemäßig.
Nun wäre es gewiß ebenso verfehlt, in jeder Komposition des späteren Larsson ein strenges
architektonisches Gerüst zu suchen, wie es verfehlt wäre, jede frühere als unarchitektonisch kom-
poniert und unmonumental zu bezeichnen. Dieser Vergleich sollte uns nur zeigen, wie stark heute
bei Larsson das Bedürfnis nach Einfachheit, nach Monumentalität geworden ist, so stark, daß er
sich in manchem mit den idealistischen Künstlern der Hochrenaissance berührt.
Larssons Freunde werden dem Verfasser vielleicht vorwerfen, daß er so gar nichts von dem
Inhalt des Buches gesprochen habe. . . Mit Unrecht. Denn daß Larsson ein großer Dichter ist, das
ist schon lange anerkannt. Daß er aber ein großer Maler ist, gerade das wird oft auf ungerechte
Weise in Zweifel gezogen. Die obige Besprechung des neuen Buches wird hoffentlich imstande
sein zu zeigen, wie intensiv der Künstler an den rein bildnerischen Problemen arbeitet, wie er, der
die Fünfzig schon überschritten hat, sich immer weiter unermüdlich neuen Problemen zuwendet,
wie er seine Kunst stetig fortentwickelt.
Fritz Saxl.
100
dieselbe Stelle für die Anbringung der Bilder, spricht sich dies aus. Es sei gestattet, diese wichtige
Wandlung noch an einem letzten Beispiel etwas ausführlicher klarzulegen, an dem Vergleich des
frühen Blattes »Sonntag« mit dem letzten des Buches »Laßt Licht hinein«: »Es wird Abend. Gute
Nacht!«
Wiederum sei von der völlig andern malerischen Behandlung abgesehen, man vergleiche
etwa die Hände, man sehe, wie Larsson jetzt breit malerisch in Flächen zerlegt, oder man beobachte,
wie in dem späteren Blatt bewußt der Kontur unscharf gemacht ist, im Gegensatz zu früher usw.
Worauf bei unserem Vergleich das Hauptaugenmerk gerichtet werden soll, ist aber etwas anderes.
Das auffallendste an dem späten Blatt ist die ganz große, einfarbige Fläche des Tisches. Sie
erstreckt sich fast genau von der Mitte des Blattes nach vorne und unten. Senkrecht auf sie steht
das Fenster, das sich aus rein Horizontalen und rein Vertikalen in strenger Symmetrie aufbaut.
Fenster und Tisch beherrschen die geometrisch genaue Mitte des Blattes. Rechts und links von
dieser finden sich schmale Streifen, beide von derselben Farbe, außerordentlich ähnlich wirkend,
fast kongruent. Das Mittellot des Bildes wird betont durch die Vase, das Buch, den Polster, die
Stickerei und das Glanzlicht der Butzenscheiben. Eine solche Komposition kann wahrhaftig nichts
Zufälliges sein. Dazu die Dosierung der Farbe. Auch ihre Verteilung wird nach geometrischen
Grundsätzen geordnet: in der Mitte Braun und Blau, an den Seiten Grün.
Völlig anders das frühe Blatt. Hier steht der Beschauer nicht in der Mitte des Bildfeldes,
sondern an der rechten Seite, von einer Mittellinie, von symmetrischem Aufbau der beiden Hälften
keine Spur zu sehen, ebensowenig etwas von einer Dosierung der Farbe nach architektonischen Prin-
zipien. Nach architektonischen Prinzipien — damit ist das Wort ausgesprochen, das zur Kennzeich-
nung der Tendenz des späteren Larsson vielleicht am besten dient. Die Komposition wird
arc h itekton i s ch, hochrenaissancemäßig.
Nun wäre es gewiß ebenso verfehlt, in jeder Komposition des späteren Larsson ein strenges
architektonisches Gerüst zu suchen, wie es verfehlt wäre, jede frühere als unarchitektonisch kom-
poniert und unmonumental zu bezeichnen. Dieser Vergleich sollte uns nur zeigen, wie stark heute
bei Larsson das Bedürfnis nach Einfachheit, nach Monumentalität geworden ist, so stark, daß er
sich in manchem mit den idealistischen Künstlern der Hochrenaissance berührt.
Larssons Freunde werden dem Verfasser vielleicht vorwerfen, daß er so gar nichts von dem
Inhalt des Buches gesprochen habe. . . Mit Unrecht. Denn daß Larsson ein großer Dichter ist, das
ist schon lange anerkannt. Daß er aber ein großer Maler ist, gerade das wird oft auf ungerechte
Weise in Zweifel gezogen. Die obige Besprechung des neuen Buches wird hoffentlich imstande
sein zu zeigen, wie intensiv der Künstler an den rein bildnerischen Problemen arbeitet, wie er, der
die Fünfzig schon überschritten hat, sich immer weiter unermüdlich neuen Problemen zuwendet,
wie er seine Kunst stetig fortentwickelt.
Fritz Saxl.
100