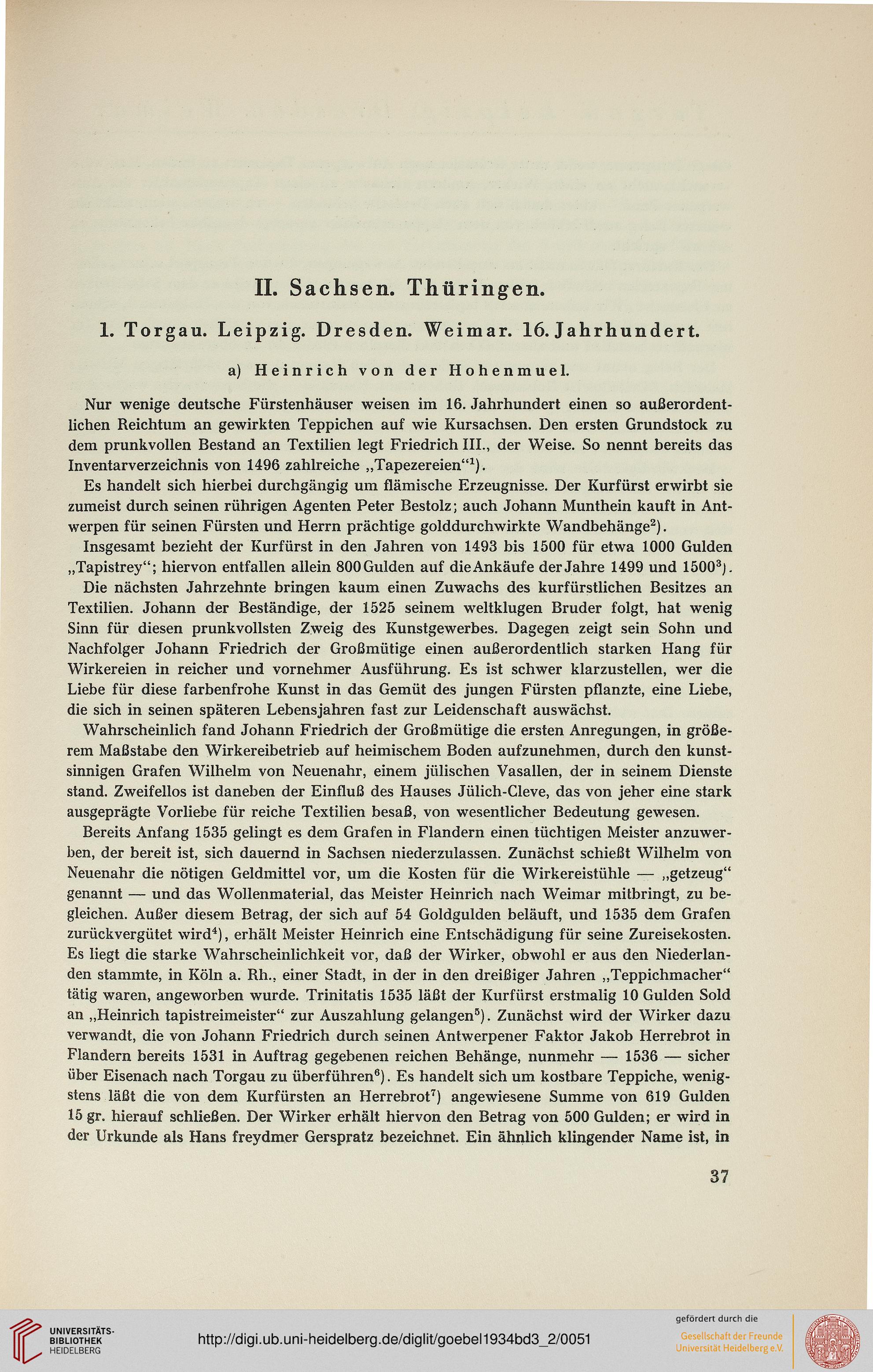II. Sachsen. Thüringen.
1. Torgau. Leipzig. Dresden. Weimar. 16. Jahrhundert.
a) Heinrich von der Hohenmuel.
Nur wenige deutsche Fürstenhäuser weisen im 16. Jahrhundert einen so außerordent-
lichen Reichtum an gewirkten Teppichen auf wie Kursachsen. Den ersten Grundstock zu
dem prunkvollen Bestand an Textilien legt Friedrich III., der Weise. So nennt bereits das
Inventarverzeichnis von 1496 zahlreiche „Tapezereien"1).
Es handelt sich hierbei durchgängig um flämische Erzeugnisse. Der Kurfürst erwirbt sie
zumeist durch seinen rührigen Agenten Peter Bestolz; auch Johann Munthein kauft in Ant-
werpen für seinen Fürsten und Herrn prächtige golddurchwirkte Wandbehänge2).
Insgesamt bezieht der Kurfürst in den Jahren von 1493 bis 1500 für etwa 1000 Gulden
„Tapistrey"; hiervon entfallen allein 800Gulden auf dieAnkäufe der Jahre 1499 und 15003j.
Die nächsten Jahrzehnte bringen kaum einen Zuwachs des kurfürstlichen Besitzes an
Textilien. Johann der Beständige, der 1525 seinem weltklugen Bruder folgt, hat wenig
Sinn für diesen prunkvollsten Zweig des Kunstgewerbes. Dagegen zeigt sein Sohn und
Nachfolger Johann Friedrich der Großmütige einen außerordentlich starken Hang für
Wirkereien in reicher und vornehmer Ausführung. Es ist schwer klarzustellen, wer die
Liebe für diese farbenfrohe Kunst in das Gemüt des jungen Fürsten pflanzte, eine Liebe,
die sich in seinen späteren Lebensjahren fast zur Leidenschaft auswächst.
Wahrscheinlich fand Johann Friedrich der Großmütige die ersten Anregungen, in größe-
rem Maßstabe den Wirkereibetrieb auf heimischem Boden aufzunehmen, durch den kunst-
sinnigen Grafen Wilhelm von Neuenahr, einem jülischen Vasallen, der in seinem Dienste
stand. Zweifellos ist daneben der Einfluß des Hauses Jülich-Cleve, das von jeher eine stark
ausgeprägte Vorliebe für reiche Textilien besaß, von wesentlicher Bedeutung gewesen.
Bereits Anfang 1535 gelingt es dem Grafen in Flandern einen tüchtigen Meister anzuwer-
ben, der bereit ist, sich dauernd in Sachsen niederzulassen. Zunächst schießt Wilhelm von
Neuenahr die nötigen Geldmittel vor, um die Kosten für die Wirkereistühle — „getzeug"
genannt — und das Wollenmaterial, das Meister Heinrich nach Weimar mitbringt, zu be-
gleichen. Außer diesem Betrag, der sich auf 54 Goldgulden beläuft, und 1535 dem Grafen
zurückvergütet wird4), erhält Meister Heinrich eine Entschädigung für seine Zureisekosten.
Es liegt die starke Wahrscheinlichkeit vor, daß der Wirker, obwohl er aus den Niederlan-
den stammte, in Köln a. Rh., einer Stadt, in der in den dreißiger Jahren „Teppichmacher"
tätig waren, angeworben wurde. Trinitatis 1535 läßt der Kurfürst erstmalig 10 Gulden Sold
an „Heinrich tapistreimeister" zur Auszahlung gelangen5). Zunächst wird der Wirker dazu
verwandt, die von Johann Friedrich durch seinen Antwerpener Faktor Jakob Herrebrot in
Flandern bereits 1531 in Auftrag gegebenen reichen Behänge, nunmehr — 1536 — sicher
über Eisenach nach Torgau zu überführen6). Es handelt sich um kostbare Teppiche, wenig-
stens läßt die von dem Kurfürsten an Herrebrot7) angewiesene Summe von 619 Gulden
15 gr. hierauf schließen. Der Wirker erhält hiervon den Betrag von 500 Gulden; er wird in
der Urkunde als Hans freydmer Gerspratz bezeichnet. Ein ähnlich klingender Name ist, in
37
1. Torgau. Leipzig. Dresden. Weimar. 16. Jahrhundert.
a) Heinrich von der Hohenmuel.
Nur wenige deutsche Fürstenhäuser weisen im 16. Jahrhundert einen so außerordent-
lichen Reichtum an gewirkten Teppichen auf wie Kursachsen. Den ersten Grundstock zu
dem prunkvollen Bestand an Textilien legt Friedrich III., der Weise. So nennt bereits das
Inventarverzeichnis von 1496 zahlreiche „Tapezereien"1).
Es handelt sich hierbei durchgängig um flämische Erzeugnisse. Der Kurfürst erwirbt sie
zumeist durch seinen rührigen Agenten Peter Bestolz; auch Johann Munthein kauft in Ant-
werpen für seinen Fürsten und Herrn prächtige golddurchwirkte Wandbehänge2).
Insgesamt bezieht der Kurfürst in den Jahren von 1493 bis 1500 für etwa 1000 Gulden
„Tapistrey"; hiervon entfallen allein 800Gulden auf dieAnkäufe der Jahre 1499 und 15003j.
Die nächsten Jahrzehnte bringen kaum einen Zuwachs des kurfürstlichen Besitzes an
Textilien. Johann der Beständige, der 1525 seinem weltklugen Bruder folgt, hat wenig
Sinn für diesen prunkvollsten Zweig des Kunstgewerbes. Dagegen zeigt sein Sohn und
Nachfolger Johann Friedrich der Großmütige einen außerordentlich starken Hang für
Wirkereien in reicher und vornehmer Ausführung. Es ist schwer klarzustellen, wer die
Liebe für diese farbenfrohe Kunst in das Gemüt des jungen Fürsten pflanzte, eine Liebe,
die sich in seinen späteren Lebensjahren fast zur Leidenschaft auswächst.
Wahrscheinlich fand Johann Friedrich der Großmütige die ersten Anregungen, in größe-
rem Maßstabe den Wirkereibetrieb auf heimischem Boden aufzunehmen, durch den kunst-
sinnigen Grafen Wilhelm von Neuenahr, einem jülischen Vasallen, der in seinem Dienste
stand. Zweifellos ist daneben der Einfluß des Hauses Jülich-Cleve, das von jeher eine stark
ausgeprägte Vorliebe für reiche Textilien besaß, von wesentlicher Bedeutung gewesen.
Bereits Anfang 1535 gelingt es dem Grafen in Flandern einen tüchtigen Meister anzuwer-
ben, der bereit ist, sich dauernd in Sachsen niederzulassen. Zunächst schießt Wilhelm von
Neuenahr die nötigen Geldmittel vor, um die Kosten für die Wirkereistühle — „getzeug"
genannt — und das Wollenmaterial, das Meister Heinrich nach Weimar mitbringt, zu be-
gleichen. Außer diesem Betrag, der sich auf 54 Goldgulden beläuft, und 1535 dem Grafen
zurückvergütet wird4), erhält Meister Heinrich eine Entschädigung für seine Zureisekosten.
Es liegt die starke Wahrscheinlichkeit vor, daß der Wirker, obwohl er aus den Niederlan-
den stammte, in Köln a. Rh., einer Stadt, in der in den dreißiger Jahren „Teppichmacher"
tätig waren, angeworben wurde. Trinitatis 1535 läßt der Kurfürst erstmalig 10 Gulden Sold
an „Heinrich tapistreimeister" zur Auszahlung gelangen5). Zunächst wird der Wirker dazu
verwandt, die von Johann Friedrich durch seinen Antwerpener Faktor Jakob Herrebrot in
Flandern bereits 1531 in Auftrag gegebenen reichen Behänge, nunmehr — 1536 — sicher
über Eisenach nach Torgau zu überführen6). Es handelt sich um kostbare Teppiche, wenig-
stens läßt die von dem Kurfürsten an Herrebrot7) angewiesene Summe von 619 Gulden
15 gr. hierauf schließen. Der Wirker erhält hiervon den Betrag von 500 Gulden; er wird in
der Urkunde als Hans freydmer Gerspratz bezeichnet. Ein ähnlich klingender Name ist, in
37